ACHTUNG! In diesem sehr langen Blog über Nordisches im Allgemeinen und sehr Speziellen werden auch sensationelle Filmemacher*innen „besprochen“, deren Werke in diesem Jahr (2024) bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck laufen: Eallu Girdnu von Elle Márjá Eira (ellemarja.com), Hans Pieski und Ann Holmgren (Ovias 2), siehe unten, die Filmtitel und die Macher*innen sind gefettet.
ORTSZEITEN: 13. – 25. JANUAR 2023 und 1. – 5. NOVEMBER 2023
abfahre Freitag, den 13. – 16:35 – Hamburg –
wie immer ohne Personenkraftwagen oder Luftfahrzeug, mit kariertem Koffer und Beutel von den 57. Nordischen Filmtagen (dieser Veranstaltung bleibe ich treu, habe dort doch sogar Astrid Lindgren beim Q & R erlebt); diesmal noch dazu mit dem ramponierten norwegischen Lederrucksack, der so seine Heimat nach langer Zeit wiedersieht, und der Ü50-Umhängetasche.

Nordische Filmtage Lübeck 1987 mit Astrid Lindgren© Quelle: LN-Archiv
Im Zug fülle ich die erste Zeile in „My Interrail Pass – Go one stop further“ aus. Beim ersten Stop, Lübecks schönem Bahnhof, ist das Warten eine Freude. Dann folgt ein bisschen Abenteuer. Ganz allein im Dunkeln an der Station Skandinavienkai geht eine am besten zuerst ins Vertrauen der Reisenden, dann in die Unterführung. Auf der anderen Seite erreicht sie weitgehend unbeleuchtetes Industriegelände und wird als bis hierher gelangte zu Fuß gehende Finnlines-Kunden aufgefordert, den Linienbus zu nehmen, der hier zweimal pro Stunde vorbeikommen soll. Läuft da nicht ein wolfsähnliches Tier über die vergilbte Brache? Dann erscheinen doch Menschen auf dieser krimitauglichen Bühne, wo als Geräuschkulisse nur irgendwo ein Blech im Wind klappert. Wind? Die Busfahrerin prophezeit Sturm und kollektives Kotzen.

Nein, das ist kein Flughafen, das ist Tromsøs Schiffs- und Busterminal.
Die Dame am Counter im Hafenhaus von Travemünde weiß sofort, wer ich bin, nämlich die der einzige weibliche Passagier auf der Finntrader. Die geräumige Wartehalle bietet eine große Auswahl an Tischen und unbesetzten Stühlen, prima für ein Abendbrot nach alter Art. Hole Brotmesser, Salatblätter, gekochtes Ei, ein Stück Käse aus dem großen Stoffbeutel, der schon mit mir und dem karierten Koffer in Sibirien war. Und den Nachtisch gibt es im Genussmittel-Geschäft dieses nahezu menschenleeren Terminals: Marabou-Schokolade.
ankomme Samstag, den 14. – 07:15 – Malmö –
und werde nach einer völlig ruhigen Nacht auf der Lübecker und Mecklenburger Bucht, der westlichen Ostsee und dem Öresund in fantasievollem Deutsch darauf vorbereitet. Kaffee gibt es auf Deck 6 an der Bar und von der Aussichtsplattform dort betrachtet, liegt mir um kurz vor sieben Schweden zu Füßen.

Für Fans der Finnlines:), Marlene Stadie
Mittig in Fahrtrichtung hängt der Halbmond, eine sehr weiße Möwe zieht weite Kreise vor der Silhouette von Malmö. Meine Mitpassagiere, Truckdriver aus aller Welt, machen sich auf zu ihren Lastern und ich steh da so schön allein während MALMÖ, die Stadt, die mal nur Hafen und Industrie war, dann Universitäts-Standort wurde, jetzt immer mehr Neubürger*innen und Neubauten hat, größer wird, deren Turning Torso, der höchste Wolkenkratzer Skandinaviens, erkennbar wird. Nur in Notfällen informiere ich mich unterwegs – und vor der Abreise auch kaum – im Internet. Lasse mir lieber vor Ort was einfallen.

Malmö, links Ribersborgs Kallbadhus, rechts Turning Torso
So weiß ich ganz plötzlich ganz genau, welches der beste Ort für ein paar Stunden Malmö ist. Diese smultron ställe – smultron heißen auf Schwedisch wilde Erdbeeren, ställe ist die Stelle und smultron ställe das persönliche Paradies -, habe ich schon vor Jahren gefunden: Ribersborgs Kallbadhus. Kallbad heißt Kaltbad, die erste dafür gebaute Anlage entsteht an Malmös Strand schon vor mehr als 150 Jahren. Was ich nicht wusste: die Sauna im Kaltbadehaus öffnet samstags ausnahmsweise nicht erst um 10, sondern schon um 9 Uhr. Passt genau ins Zeitfensterchen. Auf dem weit ins Meer hinausreichenden Laufsteg strömen beutelbehängte Malmöer*innen, der eine in Shorts, die andere im Pelz, dem hellgrünen Holzgebäude zu. Die Frauen führt die für sie bestimmte Tür ins Freie und zugleich ins Innere der Anlage. Auf Sisalteppichen, die vorm Ausrutschen auf dem hölzernen Steg bewahren, schreiten wir einer Umkleide sehr alten Baujahres zu. Beim allerersten Saunagang dieses Wochenendes wollen wir alle nur das eine: vom Ober-, Mittel- und Unterrang durch ein großes Fenster still die Ostsee betrachten. Der Himmel über ihr ist grau, sie selbst wirkt grünlich, als wir hinein steigen auf den Treppen, die in die Kälte führen. Die anderen nehmen dann draußen auf den Holzbänken Platz, als wäre dort geheizt. Ich frage nach einem Ruheraum. Gibt es nicht. In diesem Haus überm Meer gibt es nichts, was eine nicht braucht, und viel von dem, was eine oft vermisst, Schlichtheit, einladende Eintönigkeit. Steige dreimal in die baltische See, hocke auf einer grünen Bank im Inneren der köstlich kahlen Räume, mache mit Block und Bleistift Notizen über Frauen, die aufs Meer schauen und triefe vor Dankbarkeit.

Ribersborgs Kalbadhus, links gehts in die Damenumkleide, geradeaus in die Ostsee
Der Zug nach Stockholm verlässt Malmö Central auf die Minute genau um 13:04. Und schon bin ich in Schonen. Vorbei driften Alleen und dichte Baumgruppen auf Hügeln, Fachwerkhöfe, Birkenwäldchen. Mitten im SKANELÄN (den Kringel auf dem A, der daraus das O für Schonen macht, kann ich nicht erzeugen) liegt laut meiner CARTE ROUTIÈRE TOURISTIQUE Scandinavie Finlande Michelin-Karte SKANDINAVIE-FINLANDE Hässleholm. Mein Großraumwagen-Nachbar zeigt mir auf der Karte seine Lieblingsgegend, „jättefint“, sagt er und ich mache einen Bleistiftkringel drum.
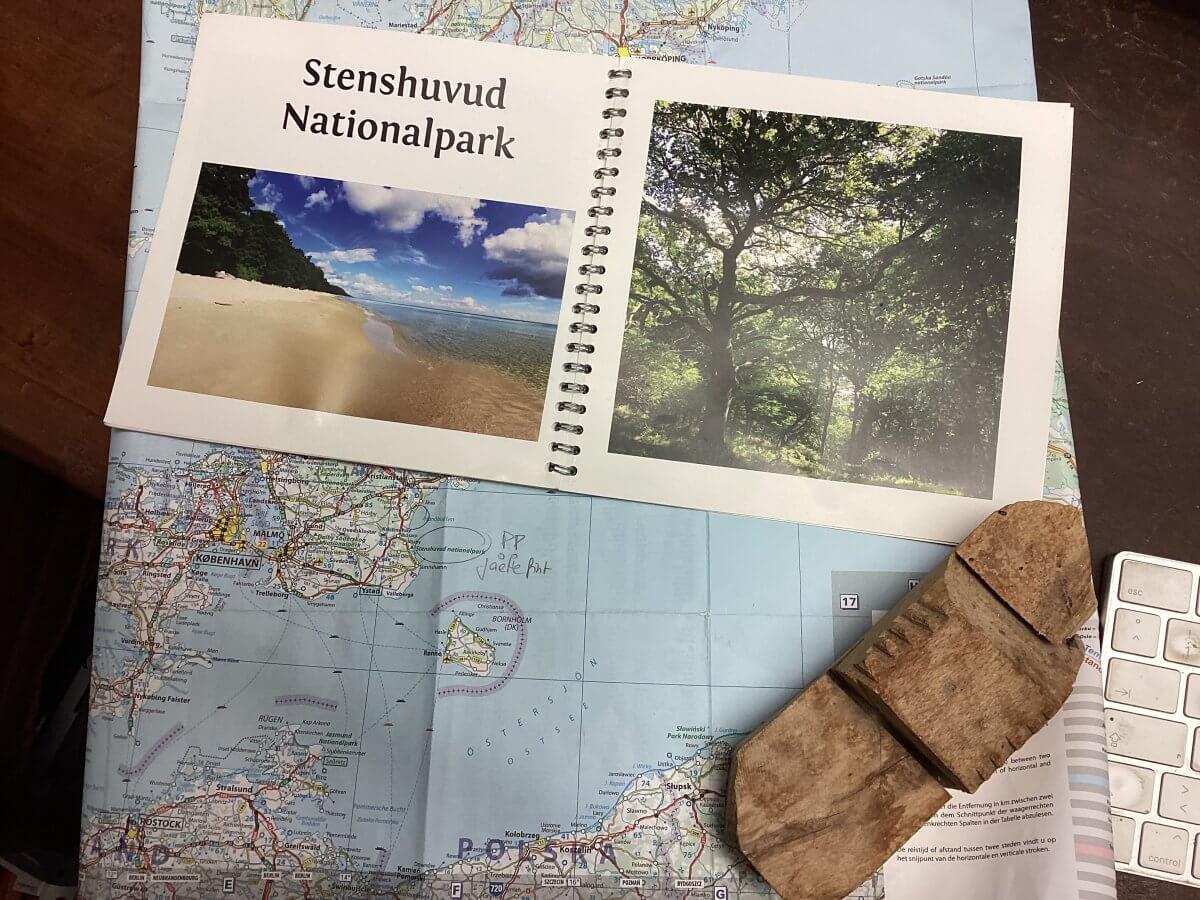
Marlene und mein Mitreisender im Zug nach Stockholm finden Stenshuvud nationalpark „jätte fint“, aus dem Schwedischen übersetzt super, extrem, unheimlich, verdammt schön. Fotos und Schnitzerei: Marlene Stadie
Na gut, ich verrate es euch Naturverrückten aller Länder: Stenshuvud nationalpark. Und siehe da, meine Tochter, der ich viel verdanke, unter anderem ausdrucksstarke Schnitzereien aus ihrer Periode der Schwärmerei für Michel aus Lönneberga und Fotoalben, die es in sich haben, hat auf ihrer Schonen-Reise zwei eindrucksvolle Bilder von diesem Nationalpark gemacht. Eines zeigt dessen vollständig menschenleeren Strand an der ÖSTERSJÖN, Ostsee, das andere seinen steinalten Laubwald, der Hainbuchen birgt, die in den Himmel wuchsen, Orchideen und Nachtigallen. Über Stenshuvud, das steinerne Haupt sagte und schrieb Carl von Linné 1749, dies sei ein hoher Berg direkt an der Küste und damit eine nützliche Landmarke für Seeleute.

Der karierte Koffer und seine Trägerin auf dem Bahnhof von Malmö
Für mich ist richtungsweisend, auf Reisen immer Karten und Pläne aus Papier dabei zu haben, plane meine Reisen mit dem Finger auf der Landkarte, nicht mit dem Finger auf dem Display. Und jetzt kommt ein Werbeblock: ich empfehle ganz offiziell und nicht kriminell „Dr. Götze Land & Karten“ (https://landundkarte.de), weil solche Läden sich fürs Wohl aller auszahlen, und zitiere wörtlich: „Wir lieben die Welt und wollen sie Ihnen zeigen. Im Hamburger Traditionsgeschäft Dr. Götze Land & Karte am Alstertor bekommen Sie Karten von so ziemlich jedem Winkel der Erde. Dazu natürlich die passende Literatur, alles übersichtlich gegliedert nach einzelnen Regionen. Sie finden bei uns weit über 70.000 Artikel rund um das Verreisen und davon Träumen: von antiken und aktuellen Landkarten über Globen, Rad- und Wanderkarten, Navigationssysteme und digitale Karten bis hin zu Sprachcomputern, Sternenkarten und einer Reisewelt speziell für Kinder. Die Wurzeln des größten Geofachgeschäfts Deutschlands – einige Verlage sprechen sogar vom größten Europas – reichen zurück bis in das Jahr 1946, als am Ballindamm eine Buchhandlung unter dem Namen Dr. Götze eröffnete. Seitdem hat sie sich zu einer festen Institution in der Hansestadt entwickelt – besonders für alle diejenigen, die gerne ihre Nase zwischen zwei Buchdeckel stecken, um auf diese Weise die Welt kennenzulernen.“
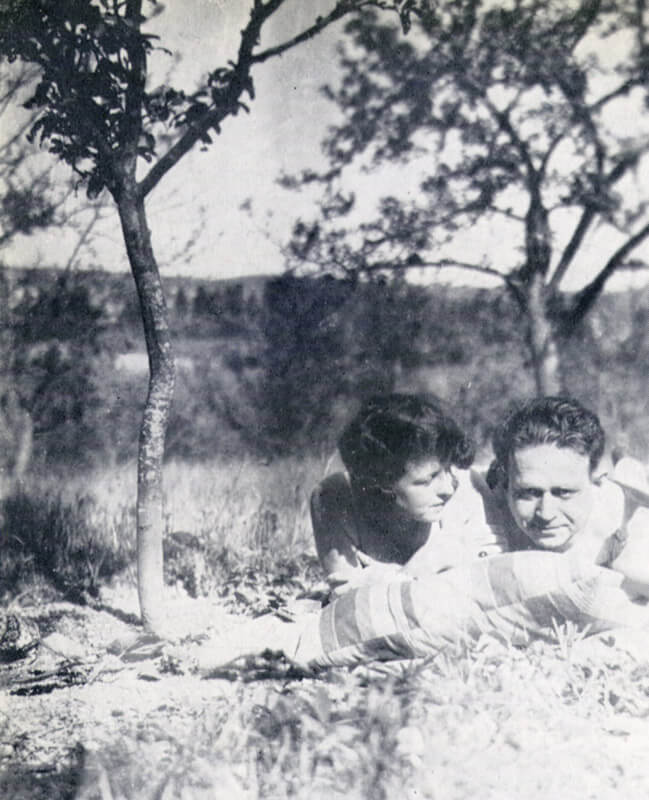
Kurt Tucholsky und Lisa Matthias im schwedischen Läggesta, unweit von Schloss Gripsholm 1929, Sonja Thomassen, CC BY-SA 3.0
Da kommt mir ein anderer Experte für Bücher, die Kunst, richtig zu reisen und für Schweden in den Sinn. Begegnete dem Mann mit den vielen Synonymen leider nur auf dem Papier, zum ersten Mal auf dem bräunlichen Papier eines hellblau gebundenen rororo-Taschenbuches. Diese in Reinbek bei Hamburg gedruckten Rowohlt Rotations Romane sind Optik und Haptik meiner sehr frühen Jugend – habe mir im Neubau-Bungalow das Zimmer am Ende des hinteren Flures ausgesucht, damit ich beim Lesen nicht gestört wurde. „Schloss Gripsholm“ gehörte 1950 zu den ersten Taschenbüchern überhaupt und ich habe es mehrmals verschlungen, auch wenn ich es nicht wirklich verstanden habe:). Der Autor dieser sehr speziellen Liebesgeschichte nannte sich mal Ignaz Wrobel, mal Theobald Tiger, mal Peter Panther, meist Kurt Tucholsky, auch Tucho, später auch „aufgehörter Deutscher“ und „aufgehörter Dichter“. Er warnte schon in den 1920er-Jahren vorm aufziehenden Krieg: „Wir halten den Krieg der Nationalstaaten für ein Verbrechen, und wir bekämpfen ihn, wo wir können, wann wir können, mit welchen Mitteln wir können. Wir sind Landesverräter. Aber wir verraten einen Staat, den wir verneinen, zugunsten eines Landes, das wir lieben, für den Frieden und für unser wirkliches Vaterland: Europa.“ Ignaz Wrobel, Die Weltbühne, 27. März 1928. Und er warnte als als linker Demokrat, Sozialist, Pazifist und Antimilitarist: ausdrücklich vor der Erstarkung der politischen Rechten, vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den mit Hitler aufziehenden Gefahren. Erich Kästner schreibt rückblickend über seinen Kollegen, er habe mit der Schreibmaschine die Katastrophe aufhalten wollen. Dementsprechend wurden in Deutschland seine Möglichkeiten zu kritischen Stellungnahmen so stark eingeschränkt, dass Tucholsky seinen Wohnsitz 1929 nach Schweden verlegte. Die Liebesgeschichte spielt in der Provinz Södermanland, da kommen wir gleich noch vorbei. Tucholsky traf es tief, als ihm im selbstgewählten Exil klar wurde, dass alle Warnungen ungehört verhallt waren. An den Schriftsteller Walter Hasenclever schrieb er im April 1933: „Daß unsere Welt in Deutschland zu existieren aufgehört hat, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und daher: Werde ich erst amal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an.“ Und jetzt habe ich eine Kurzanleitung von Kurt Tucholsky zum Reisen gefunden, die meine Verehrung noch vertieft hat, inzwischen habe ich sie mit Verständnis für diesen klugen und komischen Mann gewürzt. Die Kunst, falsch zu reisen, besteht laut Tucho darin, nur die Sehenswürdigkeiten ansehen, von denen irgendwo geschrieben steht, blind an allem anderen vorüberzulaufen, und viel zu schimpfen. „Ärgere dich“, empfiehlt er in Sachen falsches Reisen, „nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden … Sei überhaupt unliebenswürdig – daran erkennt man den Mann.“ Dieser Mann müsse auch laut sprechen: „Immer gib ihm! … – viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig.“ Für ihn bestehe eine anständige Sommerfrische „in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst“. Und es müsse unbedingt was los ein. „Stille Abendstunden sind Mumpitz; dazu reist man nicht“. Die Kunst, richtig zu reisen, entfaltet Tucho auf wenigen Zeilen: „Entwirf deinen Reiseplan im Großen – und lass dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an. … Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig; bleibst du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist, sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen, und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön: gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben.“
Als ich mich für meinen „Reiseplan im Großen“, die sehr grobe Planung der Schiffs- und Bahnfahrt gen Norden um Weihnachten 2022 herum, in die Hamburger Innenstadt begab, an die Alster, unseren Stadtteich, auf dem zu dieser Zeit immer eine illuminierte Riesentanne schwimmt, fand ich dort im oben beschriebenen Geofachgeschäft auch noch die äußerst detaillierte Lofoten-Karte, auf der mir Franciska dann die genaue Lage ihrer Erdhütte und des liebevoll von Friedensfreund*innen hergerichteten deutschen Bunkers einzeichnen wird. Davon später.
Diverse Lusekofte oder Grenzenloses Sápmi
Wir sitzen jetzt erstmal entspannt im Zug nach Stockholm, wo ich nach Entfalten der Roadmap auf Gegenden blicke, in denen es kaum Straßen gibt. Die Leute bewegten sich ursprünglich dort eher mit Booten und Schlitten, wenn überhaupt. Im Norwegischkurs habe ich gelernt, dass sie nicht ohne Grund total verschiedene Pullis (lusekofte) strickten und total verschiedene Dialekte sprachen in den durch steile Felsen voneinander getrennten Fjordtälern.

NorwegerpulliKofte,_Norsk_Folkemuseum_NF.1911-1228,_bilde_1, Lusekofte brukt i Bykle i Setesdal, Aust-Agder. Innkjøpt av Norsk Folkemuseum i 1911, Von Anne-Lise Reinsfelt – Norsk Folkemuseum: image no. NF.1911-1228, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0
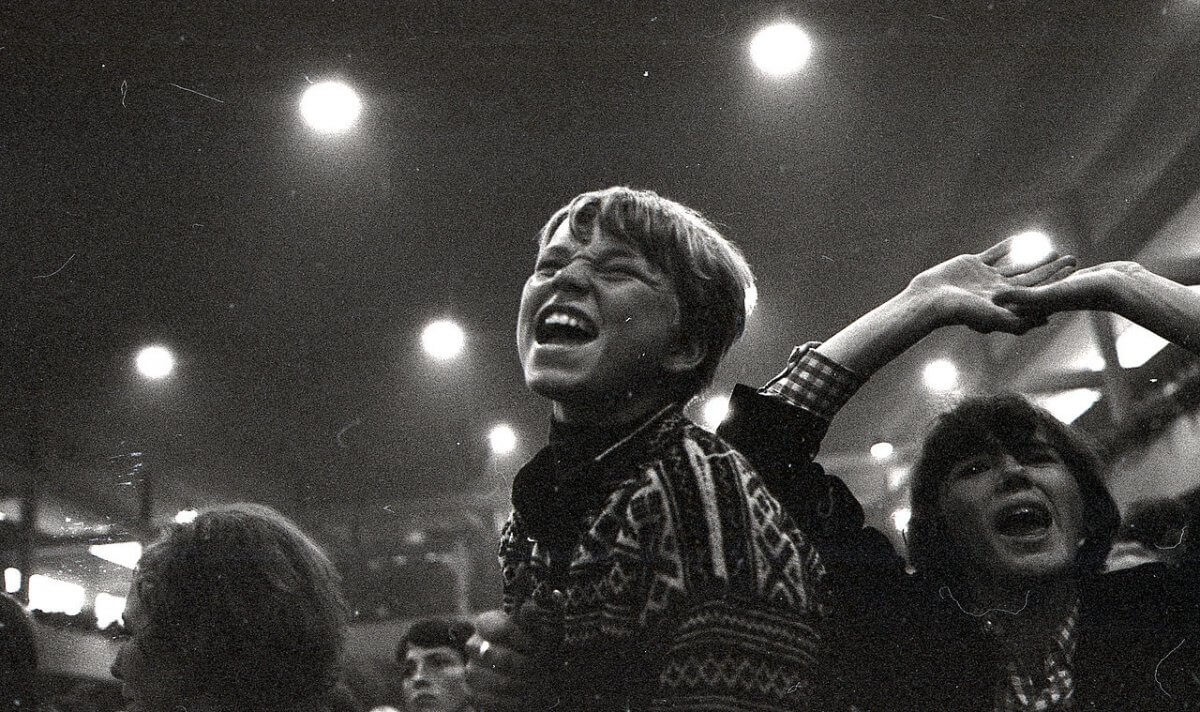
Kann nicht genau schreiben, aus welchem Fjordtal das Muster des Pullis stammt, den dieser damals sehr junge Stones-Fan in der Messehalle von Skøyen (Sjølyst) in Oslo am 24.06.1964 trug. Fotograf: Øderud Fra arkivet etter Billedbladet NÅ i Riksarkivet (RA/PA-0797/U/Ud/L0024/3660)

Skøyen und Sjølyst (Seelust) sind ein weiterhin ein sehr beliebter Kiez in Oslo, wo es heute so aussieht wie oben abgebildet, aber da wollen wir ja gar nicht hin – auch wenn Oslo jede Reise wert ist! – wir wollen in Norwegens Norden, nach Tromsø (das O mit Schrägstrich im Norwegischen steht für Insel).Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67857837
Tromsø (das O mit Schrägstrich im Norwegischen steht für Insel) liegt nördlich des Polarkreises zwischen allerlei Sunden und Fjorden im NORDISHAVET – Michelin verzeichnet die Namen praktischerweise „fremdsprachlich“. Gemeint ist der kleinste Ozean der Erde, der Arktische, auch Nordpolarmeer, Nördliches Eismeer, Arktische See oder kurz Arktik genannt.

NORDISHAVET, Nordpolarmeer, Av Patrick Kelley – https://www.flickr.com/photos/usgeologicalsurvey/4370267907/in/set-72157623467470824, CC BY 2.0
Wenn eine sich von dort – wie ich auf der langen Zugfahrt mit dem Finger auf der langen Landkarte – immer zwischen dem 69. und 70. Längengrad bleibend – gen Osten aufmacht, gelangt sie ein Stück südöstlich und bergauf nach Schweden und passiert damit die erste Grenze. Ein Fluss ist zu überwinden, der Sverige von Suomi trennt, zweite Grenze. Dann wird es plötzlich wieder norwegisch, dritte Grenze. Mitten in der absoluten Wildnis der Finnmarksvidda stößt eine auf die vierte Grenze und erwischt wieder einen Zipfel Finnland. Bewegt sie sich am Westufer des großen Gewässers Inarjärvi nach Nordosten, folgt noch einmal ein Stück Norwegen, fünfte Grenze, gelegen am anderen Meer, dem Austhavet. Und schon gelangt sie, von den Bergen kommend, nach Никель, gesprochen wahrscheinlich ungefähr Niekell, die Endhaltestelle des Zuges nach Мурманск. Und hat die sechste Grenze überschritten.
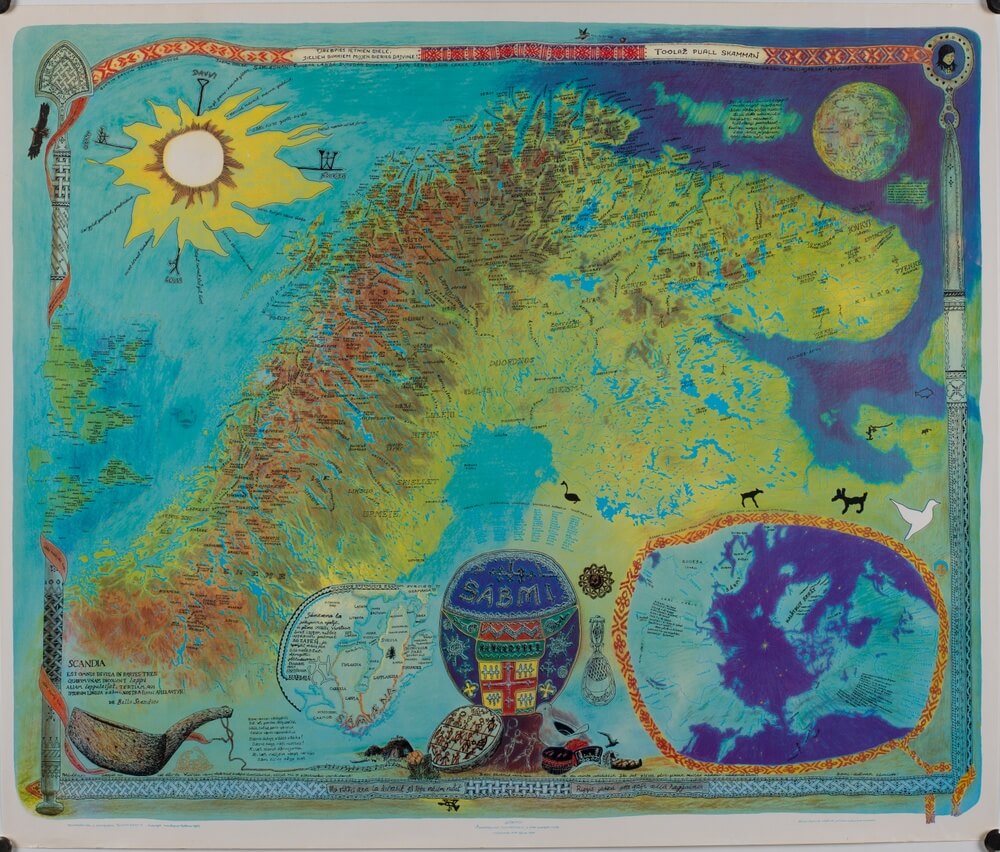
Keviselies Karte vom grenzenlosen Sápmi, Hans Ragnar Mathisen
Über sechs Grenzen musst du gehen, oder du lässt sie weg, wie Hans Ragnar Mathisen. Sein samischer Name ist Elle-Hánsa, alias Keviselie. Er gehört zu den ersten Mitgliedern der Sámi Artist Group, die sich Ende der 1970er-Jahre gründete, um der indigenen Bevölkerungsgruppe der Samen ihre Würde, ihren Stolz, ihre Kunst zurückzugeben. Ihr Siedlungsgebiet umfasst Teile von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Keviselies detaillierte „Sápmi-Maps“ sind quietsch-bunt, mit vielen Fischen, Vögeln und Rentieren – aber ohne Grenzen. Die Namen der Hügel und Landschaften schreibt der Künstler in der Sprache der Sámi – und trägt auch so dazu bei, die Sprache und die Kultur seines Volkes wieder zu beleben. Auf der documenta 14 waren 2017 mehrere seiner Karten zu sehen.

Hans Ragnar Mathisen, Jaconna Aguirre, Oklahoma Post
Auch für eine in Ökosystemen, Rentierherden und Schneehuhnschwärmen Denkende wie mich ist Nationalismus nicht systemrelevant, gefährdet aber vielerorts Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt. In der oben beschriebenen Polarregion kommt die internationale Verständigung über den Umgang mit den dortigen Naturschätzen gerade auf Grund imperialer Abgrenzungen teilweise zum Erliegen. beispielsweise werden Drähte zu russischen Wissenschaftler*innen teilweise gekappt. Das Volk der Sámi war schon vor den Grenzen da und hat, wenn ich das richtig verstehe, gerade einen Rechtsstreit darüber gewonnen, ob bei deren Überschreiten durch Rentierherden, von und mit denen ein Teil der Sámi lebt, besondere Gebühren fällig werden. Kann das gerade nicht exakt nachprüfen, aber ungefähr so absurd war es. Und das von Menschen auf ganz anderen Breitengraden maßgeblich veränderte (Wandel hört sich viel zu nett an für diese planetare Zerstörung) Klima lässt ganze Rentierherden in Seen versinken oder verhungern, weil sie durch unzeitgemäße Schneeschmelze samt überfrierender Nässe nicht mehr ans Futter kommen. Und auch wenn sie besonders stark von menschlichen Eingriffen in die Ökosysteme dieser Welt betroffen sind, sind es wohlmöglich die Indigenen dieser Welt, die Sámi und die Völker, die im Regenwald und anderswo ums Überleben ringen, die für den Weg ins Ungewisse in Zeiten von Artensterben, Erwärmung, Abholzung besonders gut – nein gerüstet klingt so militärisch – gut aufgestellt sind, mit ihrem jahrtausendealten Know-how, das über unzählige Generationen weitergegeben wurde, ihrer Widerstandskraft, ihrem Zusammenhalten, ihrer Anbindung an die örtliche Natur und überlebensfreundlichen erprobten Vorgehensweisen. Zum Beispiel ist das Heiligsprechen von Arealen vielleicht ein empfehlenswertes, nachhaltiges Verfahren. Da sind wir jetzt im Spirituellen gelandet – bei der Fantasiereise mit dem Finger auf der Landkarte.
Markante Hornkrone oder Seltsame Seelenfahrten
Anders war ich bisher nicht in die norwegische Provinz TROMS OG FINNMARK an der Nordspitze Skandinaviens gelangt. Meine letzten Schulsommerferien führten mich Anfang der 1970er-Jahre auf eine Fjordinsel mit nur einer Hütte, knapp unterhalb des Polarkreises, in der Nähe des Küstenstädtchens Brønnøysund in der Provinz NORDLAND. Und ich fing mir beim Multebeerenpflücken und Angeln eine Art Abhängigkeit ein, nennen wir sie Nordlandlust.

Aussicht vom Torghatten auf die Küste bei Brønnøysund (norwegische Provinz Nordland)
Die trieb mich dazu, neben lateinischen Pflanzennamen norwegische Vokabeln zu büffeln mich bei der frisch eröffneten Universität Tromsø zu bewerben. Von dort kamen verheißungsvolle Antworten: sie schlugen mir die Teilnahme an drei Forschungsprojekten vor, zwei biologischen und einem zur Kultur der Sámi. So begann ich also Mitte der 1970er mich unter anderem mit Trommeln zu befassen. Und dieses Interesse am Vorchristlichen begleitet mich seither spirituell und akustisch.

Runebomme, sametromme, noaidetromme, goavddis, gobdis, meavrresgárri (nordsamisch), goabdes (lulesamisch), gievrie (südsamisch), Von Johan Ernst Gunnerus 1773 dem Wissenschaftsmuseum (NTNU Vitenskapsmuseet/NTNU University Museum) übereignet – inzwischen weiß ich Schreckliches über solche Eigentumswechsel, meine ersten Eindrücke von Trommeln verliefen gänzlich unkritisch.
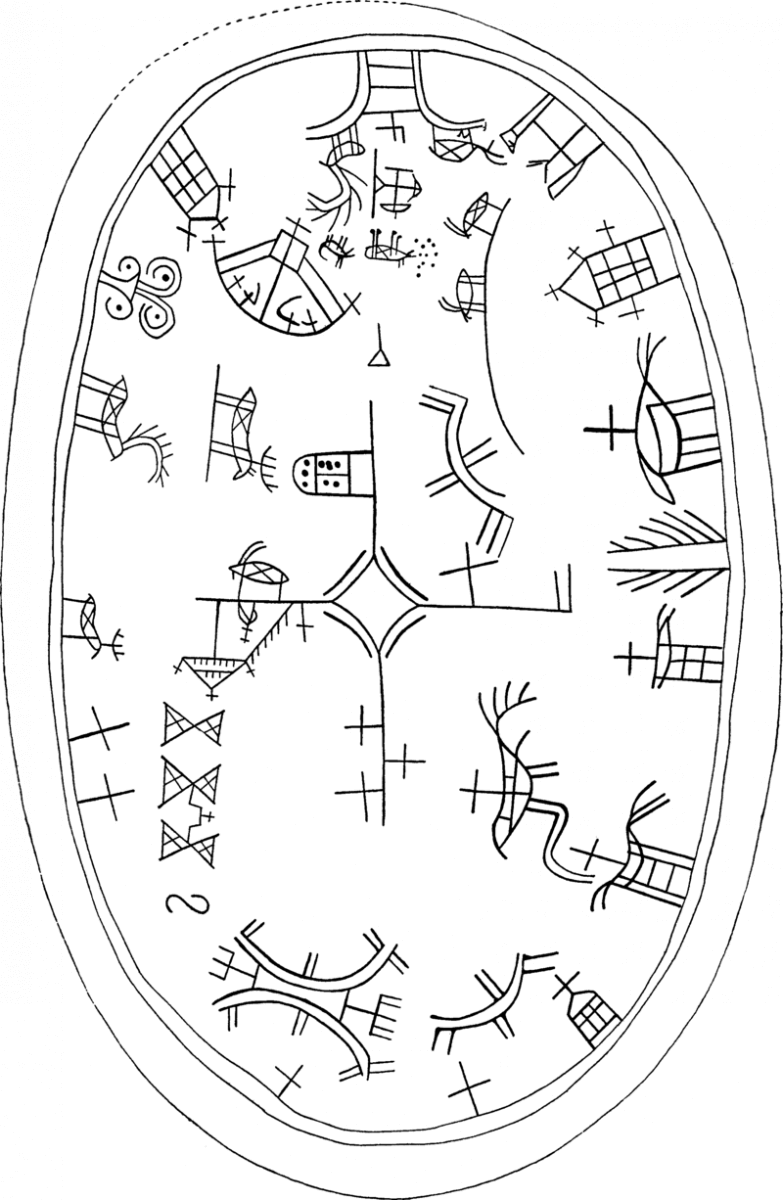
Ernst Mankers Zeichnung von den Motiven auf der Trommel. Foto: Åge Hojem, Av Manker. Scanning, cleaning up minor imperfections in the reproduction and removing the numbers was made by Tor Gjerde at old.no; Christopher Forster made the PNG images white background transparent using ImageMagick on GNU/Linux. – Manker (1938 and 1950); http://old.no/samidrum, Offentlig eiendom, NTNU Vitenskapsmuseet
Und schon transzendiere ich wieder von Menschen gemachte Grenzen und gerate nach Budapest. Dort wurde 1914 Felicitas Goodman geboren. Ab 1968 arbeitete die Anthropologin (Menschenkundlerin) an der Denison Universität in Ohio, befasste sich mit vergleichenden Religionswissenschaften an der Denison University/Ohio und machte knapp zehn Jahre später eine überraschende Entdeckung: Die Körperhaltungen, die uns in Form von Abbildungen auf Felswänden, Tontöpfen und meist kleinen, solitären Statuen und Holzschnitten und von Zeichnungen von Forschungsreisenden aus längst vergangener Kulturen überliefert sind, haben rituellen Charakter. Ein Ritual ist einfach nur eine nach Regeln ablaufende Handlung, die kann feierlich oder alltäglich, weltlich oder religiös sein. Das Spezialgebiet von Goodman war das Religiöse in den Kulturen der Welt und sie erforschte „rituelle Körperhaltungen und ekstatische Trance“. Auch das Wort Trance hat etwas mit dem Überschreiten und Hinübergehen (lat. transire) zu tun. Es bezeichnet einen Bewusstseinszustand jenseits des üblichen Wachbewusstseins und Verstandes, der sich durch hochgradige Konzentration und zugleich sehr tiefe Entspannung auszeichnet. Goodman führte die rituellen Haltungen mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen durch und stellte fest, dass die Trance-Erlebnisse, von denen die Menschen berichteten, nicht mit deren Kultur, sondern mit der jeweiligen Haltung zu tun hatten, die in Verbindung mit Klang und Rhythmus, zum Beispiel Trommeln, Bewusstseinswelten eröffnet. Und nun kriegen wir die Kurve zurück in die Arktis: In Goodmans Buch über Trance als Weg zum rituellen Erleben fand ich in den 1990er-Jahren eine Abbildung, die einen Noaidi (nordsamisch), Nåejtie oder Nåejttie (südsamisch), Noajdde (lulesamisch), Nåidd (skoltsamisch), Niojte (tersamisch), Noojd oder Nuojd (kildinsamisch), Nåjjde (pitesamisch) zeigt, einen Mittler, Heiler, spirituellen und rituellen Spezialisten, Seelsorger, der für jemanden, der mit einer umgedrehten Trommel auf dem Rücken vor ihm liegt, trommelt.
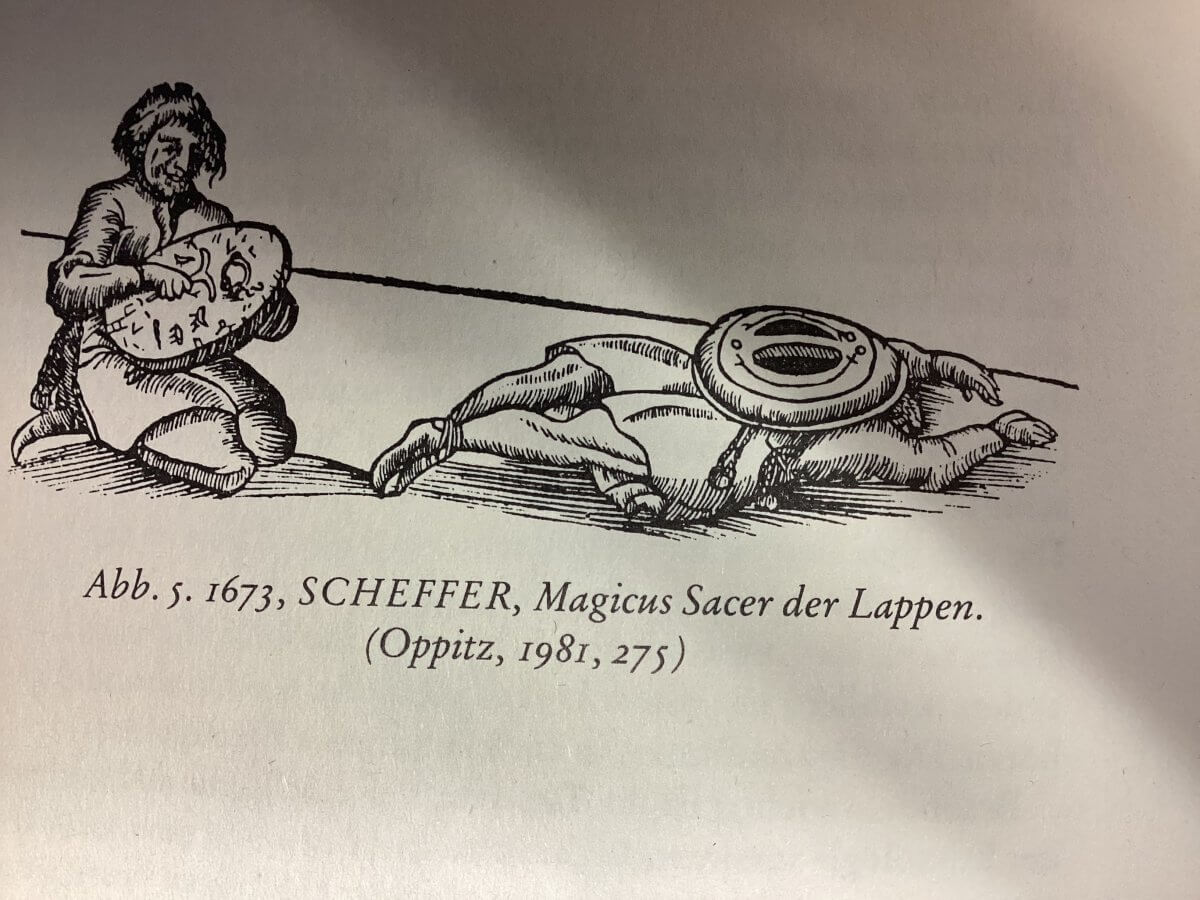
Abbildung mit zwei magischen Instrumenten, mit denen die Beteiligten sich und andere in Trance versetzen, aus dem 1992 erschienenen Buch TRANCE der uralte Weg zum religiösen Erleben von Felicitas D. Goodman
Heute weiß ich, dass es sich um einen Holzschnitt von Johannes Scheffer handelt. Dieser 1621 in Straßburg geborene Mensch muss eine Art Universalgenie gewesen sein, gelehrt in diversen Fächern, fähig solche eindrucksvollen Grafiken anzufertigen. Königin Christina von Schweden holte ihn an die Universität Uppsala, wo er unter vielem anderen auch „Lapponia“ verfasste, eine der ersten und wichtigsten Beschreibung der samischen Völker. Die Mehrzahl stimmt. Es handelt sich bei den Sámi nicht um eine homogene Kultur, die zehn Dialekte und auch Kulturgegenstände aus den verschiedenen Regionen von Sápmi unterscheiden sich deutlich voneinander, wie Nana Nauwald im Praxisbuch „Ekstatische Trance – Rituelle Körperhaltungen“ einleitend zu ihrem Nordeuropa-Kapitel schreibt. Heute würden noch etwa siebzig Trommeln in den Sammlungen von europäischen Museen existieren, schreibt Nauwald. „Ihre teilweise reichhaltigen Bemalungen künden als einzige authentische Quellen von den geistigen Welten dieses Volkes.“ Es habe Trommeln für die Trance im Heilritual gegeben, Trommeln für die Wahrsagung, Trommeln für die Reise in die obere Welt und solche für die Reise in die untere Welt. Diese Welten sind keine materiellen Orte, es sind Anderswelten, energetische Räume.
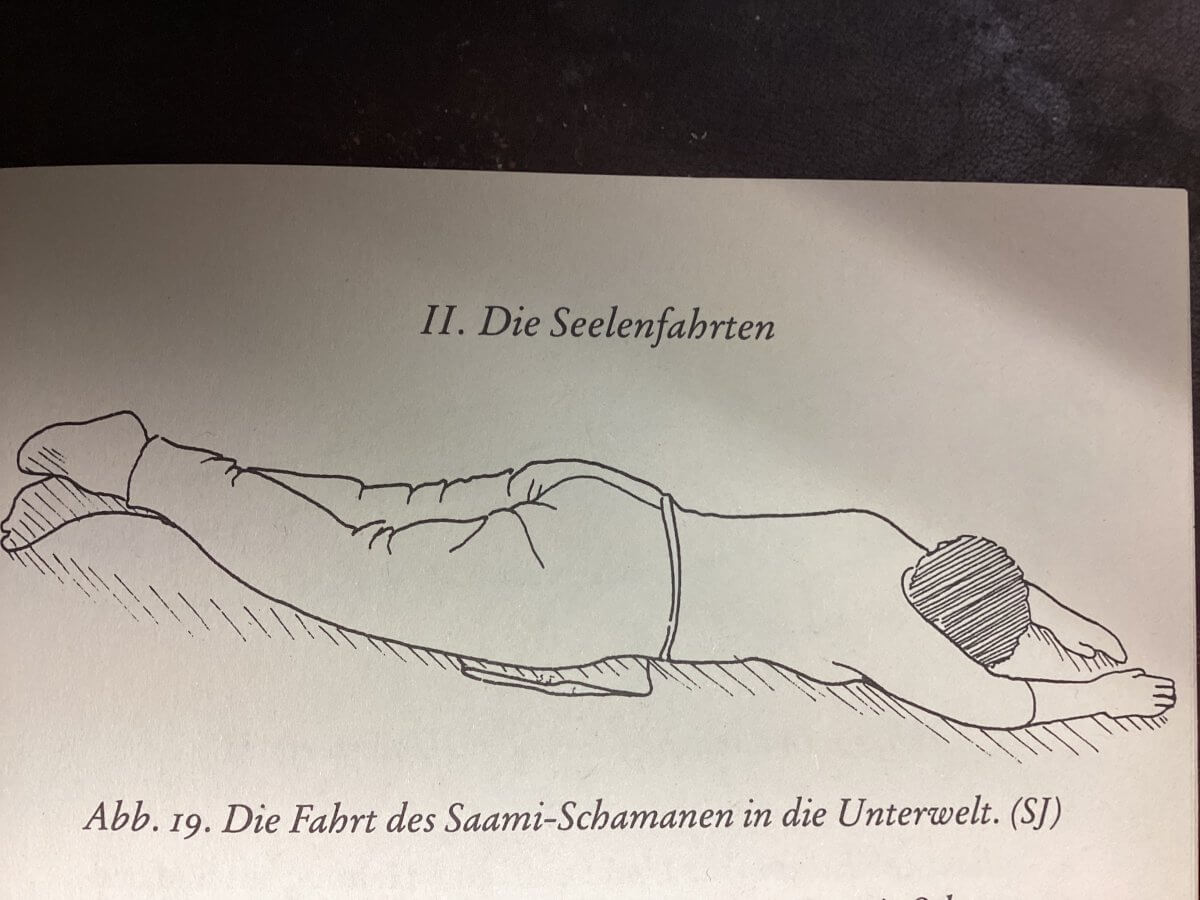
„Die Haltung ist von der Zeichnung eines deutschen Reisenden aus dem siebzehnten Jahrhundert bekannt … Man legt sich auf eine Unterlage flach auf den Bauch, mit ausgestreckten Armen, wobei die rechte Hand etwas weiter nach vorn gestreckt ist als die linke Die Beine sind in Knöchelhöhe gekreuzt, und das rechte Bein liegt über dem linken. Das Gesicht ist nach rechts gedreht.“ Aus dem 1992 erschienen Buch TRANCE der uralte Weg zum religiösen Erleben von Felicitas D. Goodman
Von der Rückkehr des materiellen samischen Kulturerbes ins Siida Sámi Museum im finnischen Inari (https://siida.fi/en/the-sami-museum) handelt ein unglaublich eindrucksvoller Dokumentarfilm, der im November 2023 auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck lief: Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming von Suvi West und Anssi Kömi. Es gehe darum, die Gegenstände und ihre ursprünglichen Besitzer*innen zu respektieren, sagt West. In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm geht es auch ums Durchbrechen von Tabus und Stigmata. Kaum jemand habe gewagt, über diese Dinge laut zu sprechen. Es gehe ihr auch um „the impact of christianity“, die Ein- und Auswirkungen des Christentums. Die Christen hätten diejenigen angeklagt oder getötet, die die Trommeln spielten.
Auch in Lübeck befinden sich Artefakte aus Sápmi. Davon handelte ein Gespräch im Rahmen der Nordischen Filmtage, am 3. November 2023. Das Gespräch zum Film Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming – die auf den Nordischen Filmtagen gezeigte Dokumentation thematisiert die Rückführung von Kulturgütern der Sámi aus verschiedenen Museen in ihre Heimatregion im Norden Skandinaviens – führten die Regisseurin dieses Films und Dr. Lars Frühsorge, der Leiter der Völkerkundesammlung der Hansestadt Lübeck, die über rund 100 samische Objekte verfügt, die zum Teil schon vor mehr als 300 Jahren dorthin gelangten. Und es erschien mit Hilfe des Publikums eine schöne Lösung: Lübeck übergibt dem Siida Sámi Museum im finnischen Inari (https://siida.fi/en/the-sami-museum) die Gegenstände, so dass die Gemeinschaft der Sámi deren Eigentümerin wird. Und dann in großem Stil, nach Erforschung, Sichtung etc., Objekte verleihen kann, in alle Welt.

Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming von Suvi West, 65. Nordische Filmtage, ausgepackt wird hier eine Hornmütze Ládjogahpir (Ladjo)

In der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg ( markk-hamburg.de ) sind die roten Ládjogahpir unter anderem auf einer Stickerei von Britta Marakatt-Labba zu entdecken.
Auch in Hamburg befinden sich Artefakte aus Sápmi. In den 1910er-Jahren umfasste der Bestand dort, im 1871 gegründeten Culturgeschichtlichen Museum (später Völkerkundemuseum), wie das MARKK (MUSEUM AM ROTHENBAUM Kulturen und Künste der Welt) zuvor hieß, 60 Objekte. Heute besitzt das Museum mit 1300 Einträgen einen der umfangreichsten Bestände von Sámi-Artefakten in der BRD. Dazu beigetragen hat, wie in der MARKK-Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte zu lernen ist, das koloniale Machtgefälle. Das nutzte Ludwig Kohl-Larsen (ab 1931 überzeugter Nationalsozialist), wie das MARKK berichtet, zum eigenen Vorteil aus. Der deutsche Arzt, Paläontologe und Forschungsreisende war mit einer Norwegerin verheiratet; bis 1925 als Bezirksarzt im norwegischen Teil von Sápmi, dem Siedlungs- und Kulturraum der Sámi tätig, die damals wirtschaftlich und politisch stark benachteiligt waren, und erwarb kostengünstig deren Erzeugnisse.
Der nordische Kolonialismus begann mit der Christianisierung und Kolonialisierung der samischen Bevölkerung, der Unterdrückung ihrer Traditionen, wie die des Joik-Gesanges, und ihrer Symbole, wie denen auf den Trommeln, um 1600. Es folgte ab 1850 die sogenannte Norwegisierung der Sámi durch Unterdrückung ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihres Wissens. Und bald darauf kam es zu menschenverachtenden Besichtigungen: „Mein Vater erzählte mir oft Geschichten über seinen Großvater, der einst in einem Zoo ausgestellt war. Es gab nicht viele Belege: nur obskure Geschichten über das Leben in einem Zoo und ein Foto an der wand, das eine seltsam aussehende Landschaft im Hintergrund hatte. Die Großeltern meines Vaters, Simoni und Ella-Stiina Laakso, sind auf dem Foto zu sehen, zusammen mit ihrem jüngsten Sohn Verkok, meinem Großonkel. Später fand ich heraus, dass das Foto in einem Zoo in Deutschland aufgenommen wurde und die Fjälls (Berge) bemalte Leinwände waren.“ Dieses Zitat lese ich in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg .
Suvi West hat sich für ihren Dokumentarfilm Máhccan (Homecoming), der auf den 65. Nordischen Filmtagen gezeigt wurde, zum Berliner Zoo aufgemacht, wo Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts Hunderte von Berliner*innen zeigen, die Sámi bestaunen.

„Human Zoo“ heißt ein Stück des Sámi Našunal Teáhter, des samischen Nationaltheaters, zum Thema nordische Kolonialisierung. Es zeigt die bis weit ins 19. Jahrhundert andauernde Phase extremer Übergriffe: Angehörige der Sámi gingen in traditioneller Bekleidung mit lavvo (Jurte) und Rentieren auf Europa- und USA-Tournee. Sie wurden unter anderem in Zoos ausgestellt.
Die Einschränkung der Fischereirechte der Sámi in Norwegen und die Bedrohung ihrer Landrechte und Lebensgrundlagen durch Bauprojekte wirkt sich bis heute aus. Filmemacherin West sagt, die Situation sei schlimmer als zuvor und durch eine hohe Selbstmordrate gekennzeichnet.
Es sei Zeit für einen längst überfälligen Perspektivwechsel auf Geschichte und Gegenwart der Sámi, schreiben die Ausstellungsmacher des MARKK in ihrer Einladung zu Das Land spricht. Sámi Horizonte. Und samische Frauen setzen sich derweil schon mal den Hut auf, wie in dieser Ausstellung zu bewundern ist. Beteiligt an der künstlerischen Rematriation der Ládjogahpir (der samischen Frauenhauben) ist die Künstlerin Outi Pieski.

Outi Pieski: Máhccat eatni lusa I/Return to Máttaráhkká I, die Rückkehr zur Vormutter
Zur Máttaráhku Ládjogahpir, der Hornmütze der Vormutter, schreibt Eva-Kristiina Harlin, die an der Universität Oulu in Finnland die Politik der Rückgabe des materiellen Kulturerbes der Sámi erforscht, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts die samischen Frauen in der heute in Nordnorwegen und Finnland gelegenen Region der Sámi die Ládjogahpir trugen, „eine elegante, einer Krone ähnliche Kopfbedeckung. Das hoch hervorstehende Holzstück am Hinterkopf, Fierra genannt, verlieh der Mütze ein markantes Aussehen. In der Gesellschaft der Samen ist eine überzeugende Erzählung oder volkstümliche Überlieferung bekannt, nach der die laestadianischen Geistlichen das Tragen dieser Mütze mit der Begründung verboten haben, dass der Teufel deren hölzerne Ausbuchtung bewohnt.“
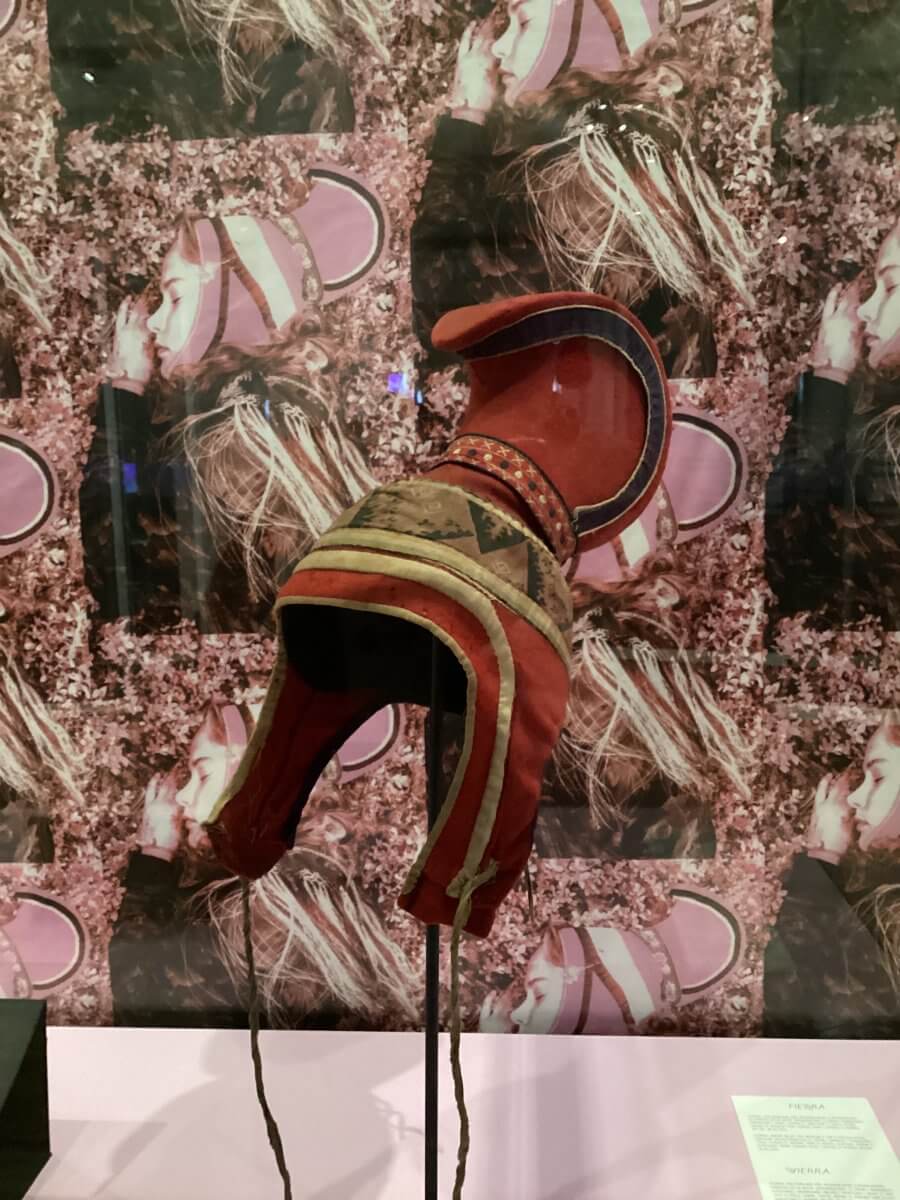
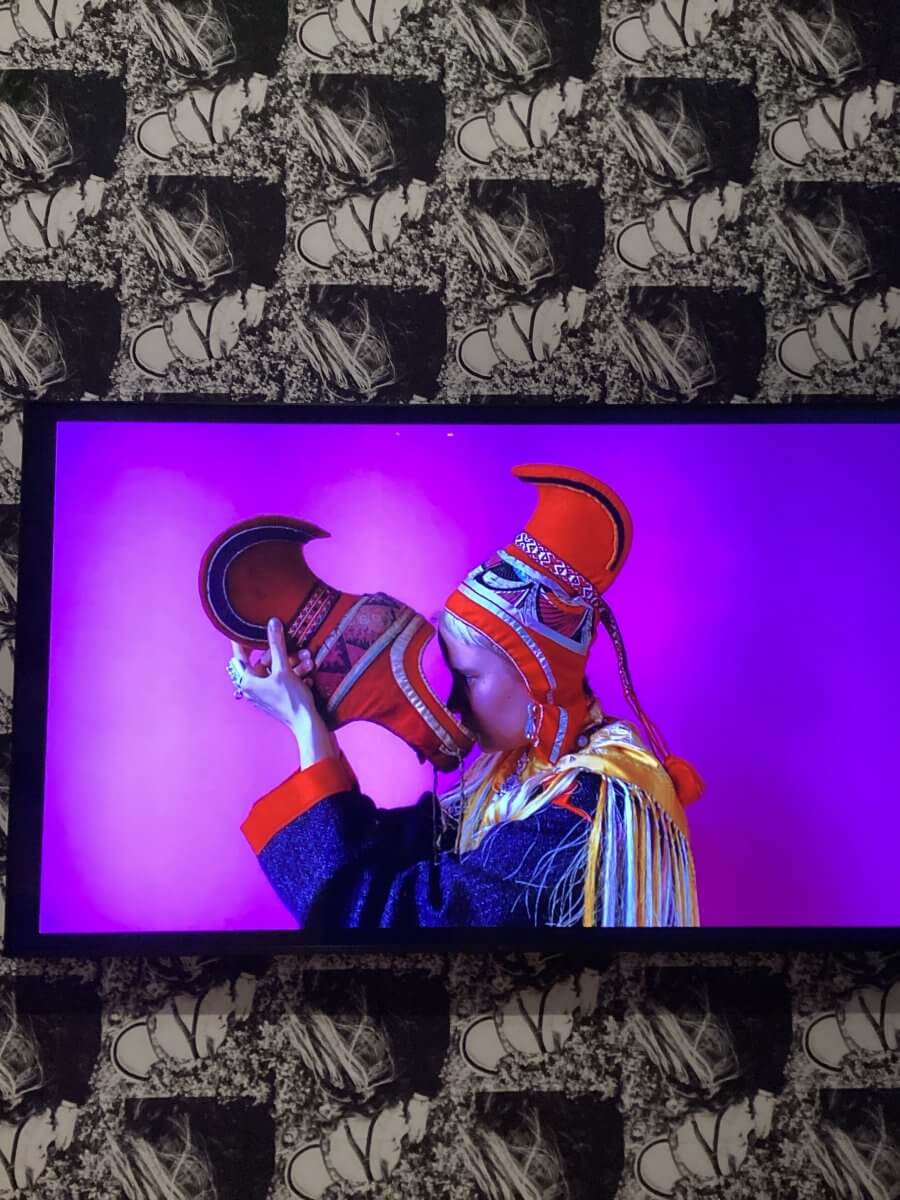
Ládjogahpir, samische Hornmützen, in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg
Im 17. Jahrhundert wurde während der Zwangschristianisierung der Sámi seitens der Kirche die Kopfbedeckung Ládjogahpir als „Teufelshorn“ verboten. Die Erweckungsbewegung der lutherischen Kirchen in Norwegen, Schweden und Finnland, die auf den schwedischen lutherischen Pfarrer und Botaniker Lars Levi Laestadius zurückgeht, der unter anderem bei den Sámi wirkte, legte im 19. Jahrhundert nach und prangerte die Kopfbedeckungen als „Satanszeichen“ an.

„Die Priester sammelten die Mützen ein, die ebenso wie die heiligen Trommeln verbrannt werden mussten“, schreibt Harlin. „Es sollte nichts von der früheren Weltordnung übrig bleiben. Mit dem Ende der Herstellung und Nutzung der Mütze verschwanden auch die damit verbundenen überlieferten Kenntnisse und Bedeutungen.“ Heute seien noch 58 dieser Mützen in Museumssammlungen erhalten, jedoch nur wenige in Sápmi, dem Kulturraum und Siedlungsgebiet der Samen.

Dieses Schultertuch mit Fransen (liidni) der Künstlerin Anniina Turunen erwarb das MARKK 2023. MII LEAT AIN DÁS bedeutet: Wir sind noch da.

Outi Pieskis Malereien und Installationen handeln von der arktischen Region und der gegenseitigen Abhängigkeit von Natur und Kultur. Pieski kombiniert Duodji, die Handwerks- und Kunsthandwerkstradition der Sámi, die Herstellung von Kleidung, Küchenutensilien, Werkzeugen und Dekorationsgegenständen überwiegend aus Naturmaterialien umfasst, mit diversen Praktiken der Gegenwartskunst und trägt den Diskurs übers samische Urvolk ins Transnationale.
Auch Liidni, die Schultertücher, sind bedeutsamer Teil von Duodji, des traditionellen samischen Handwerks und Kunsthandwerks, und sagen: „Wir sind noch da“. So steht es in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg ( markk-hamburg.de ) zu lesen. Und auch, dass zarte Tücher wie ein Panzer fungieren können: Über das von ihr angefertigte Tuch, das das MARKK 2023 erwarb, schreibt Anniina Turunen: „Dieses Seidentuch mit Fransen ist wie eine Rüstung auf unseren Schultern und beschützt uns, während wir unseren gákti (gákti ist das nordsamische Wort für die traditionelle samische Tracht) tragen. Es sagt uns, dass wir noch da sind.“
Legendärer Lausejunge oder Letzter Frühling
Mein Antrag auf ein Stipendium fürs Studium in Nordnorwegen wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst abgelehnt. Ich war damals total beleidigt und verdrängte Tromsø. Ziemlich lange. Im November 2022 sah ich bei den Nordischen Filmtagen Den siste våren /Sister what grows, when Land is sick? das Debut von Franciska Eliassen und wir verwickelten uns in mehrstündige Gespräche. Zum Glück! Sie lud mich ein zum tiff, dem Tromsø International Film Festival.
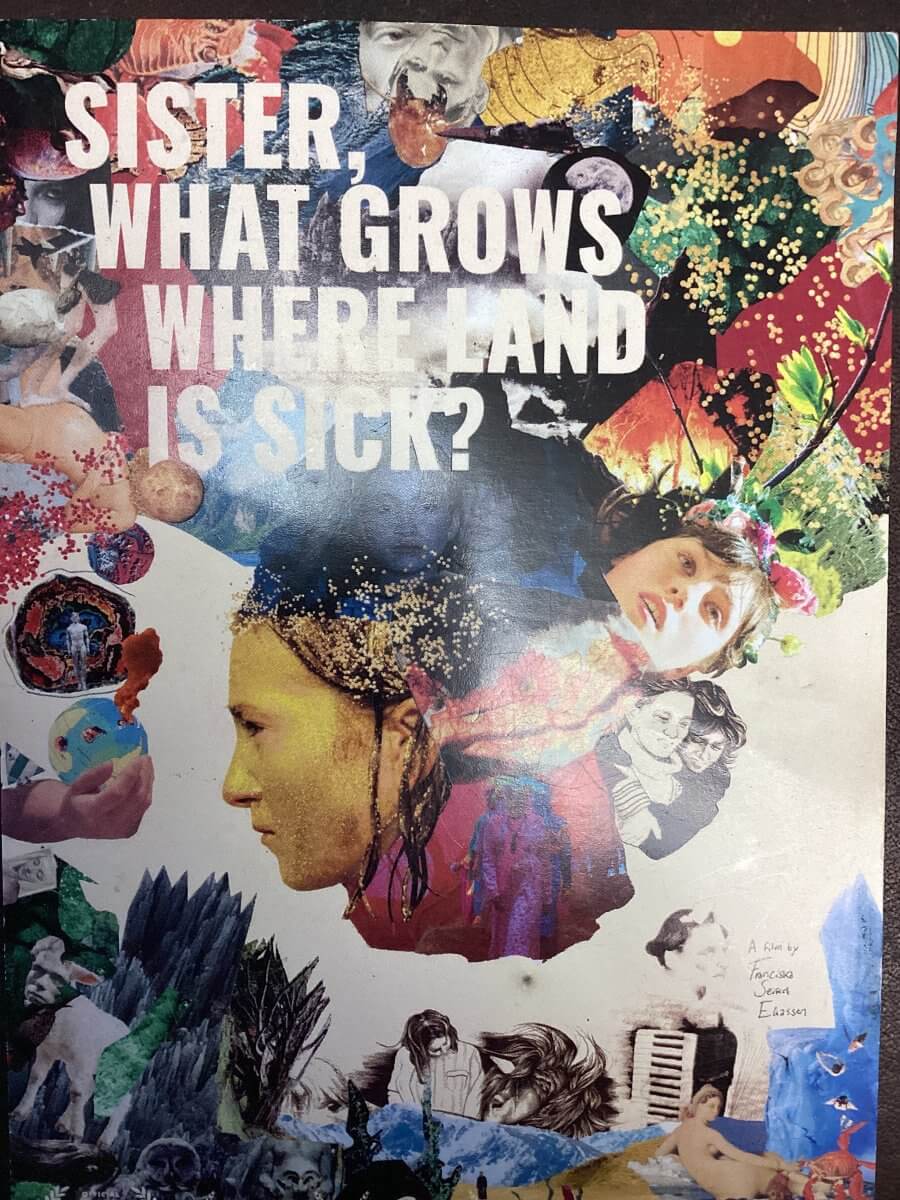

Franciska Eliassen. Ihr Debut-Film Den siste våren /Sister what grows, when Land is sick? lief 2022 auf den Nordischen Filmtagen.
Und so fahre ich nun durch Schweden und vorm Fenster reißen Seen und Feuchtgebiete nicht ab. Auf kleine Birken folgen trockenere Gegenden mit hohen Kiefern im Åsnens nationalpark. Eigentlich wollten die Schwed*innen 1918 in der historischen Provinz Småland die typische Wald- und Wiesenlandschaft unter Schutz stellen, aber ihr Nationalpark Åsnen besteht zu 75 Prozent aus Seen. Und ich freue mich auf der ganzen Reise, immer wenn Licht über der Landschaft ist, dass es soviel Gelände gibt, das sich nicht überbauen lässt. Das sind doch wahre Ressourcen, das lässt doch hoffen.
Im JÖNKÖPINGS LÄN wird’s hügelig, hier liegen Schneereste. Nässjö hat ein bisschen Jugendstil und wird ganz anders ausgesprochen, als eine denkt, „Necho“ sagt der Schaffner. Und es liegt an der Bahnstrecke nach Oskarshamn, wie Michels Wohnort Lönneberga. Ganz in der Nähe ist seine Erfinderin Astrid Lindgren aufgewachsen … mehr Schnee und zum letzten Mal für zehn Tage um 15:30 letzte Helligkeit …
stehenbleibe Sonntag, den 15. – 06:00 – Boden –
das liegt gar nicht weit von der Ostsee in der überwiegend von Samen bewohnten Region NORRBOTTENS LÄN und heißt auf samisch Suttes. Das Bahnhofsgebäude, wie die Stabkirchen ausschließlich aus senkrechtstehenden Holzteilen errichtet, verweist mit den Drachenköpfen in Zeiten vorm Christentum. Hier werden wir Insassen des Nattoget Norrland, des Nachtzuges, der seit 1936 – nur mit einer pandemischen Unterbrechung – täglich von Stockholm in Richtung Arktis fährt, von der Ansage geweckt, dass leider ein Güterzug vor uns einen Elch überrollt habe und nun das Gleis geräumt werden müsse.
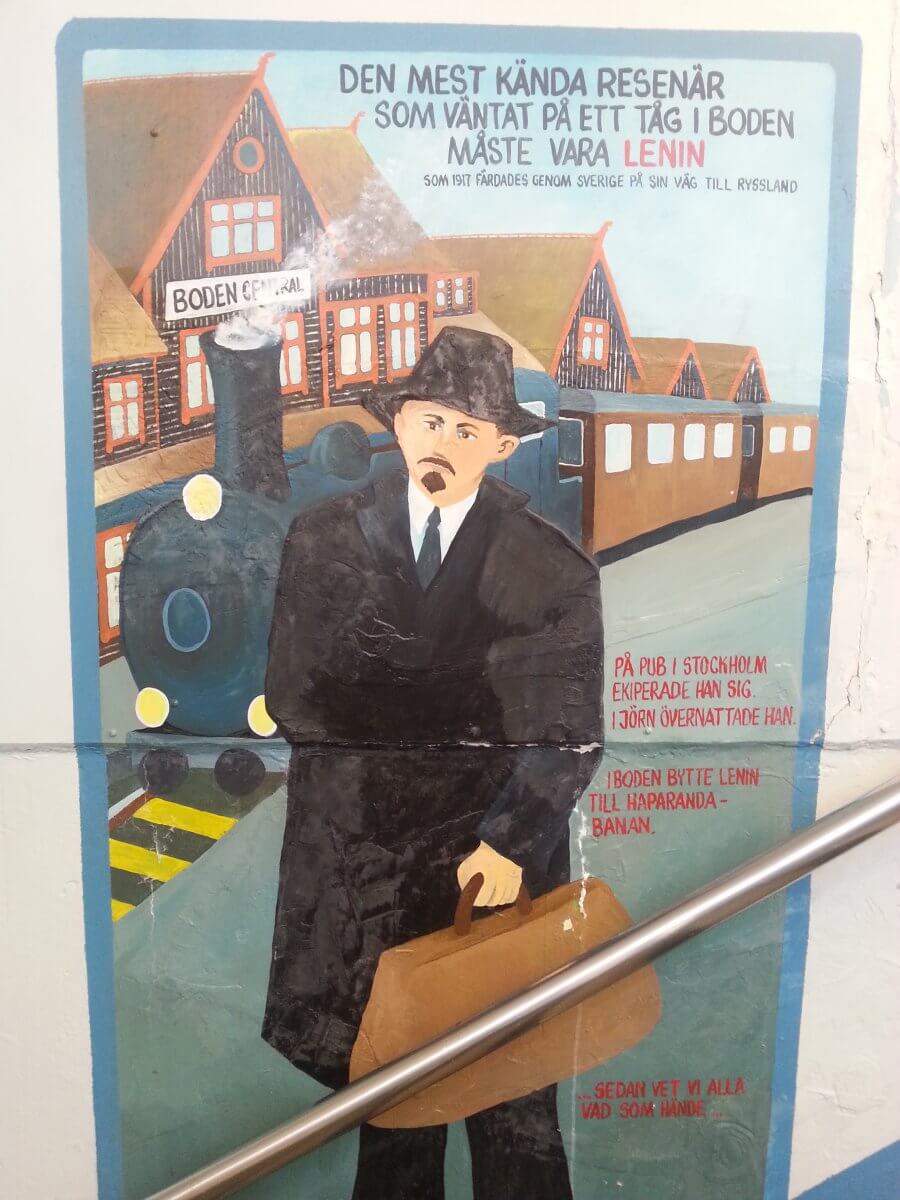
Der bekannteste Reisende, der in Boden gewartet hat, auf dem Weg nach Russland, war Lenin.
Öffne die Zugtür – und steige nicht aus. Mich schreckt nicht die verschneite, menschenleere Gegend, im Gegenteil, aber mir stecken die Warnungen der Schaffner*innen der Transsibirischen Eisenbahn in den Gliedern. Sie ließen uns nur selten aus dem Zug und warnten, der würde gnadenlos weiterfahren, wenn wir nicht rechtzeitig zurück kämen. Christian, 33 Jahre, Unternehmensberater aus Zürich, hat keine Bedenken. Kaum steht er auf dem Bahnsteig, ertönt der Pfiff. Christian schafft den Wiedereinstieg und lädt mich zum Frühstück ins Abteil ein. Annegret, Friedrich, Georg und er sind auf dem Weg zu ihrer jährlichen Winterwanderung. In diesem Jahr wollen sie von Nikaaluokta nach Abisko laufen. Sie wandern durch Sápmi, dessen Landschaft oberhalb der Baumgrenze – auf norwegisch Fjell, auf schwedisch Fjäll genannt, wo im 19. Jahrhundert die oben genannten Grenzen gezogen und der von Studenten aus Uppsala (!siehe unten) gegründete Wanderverein Svenska Turistföreningen zur Erkundung der von ihnen Lappland genannten, heute historischen, Landschaft den Kungsleden markieren. Auf diesem mit Hütten versehenen Königspfad wollen Christian und seine Freunde 15 Kilometer pro Tag zurücklegen. Vorerst teilen wir, was wir dabei haben, kann Rettich, Landjäger und Graubrot beisteuern.
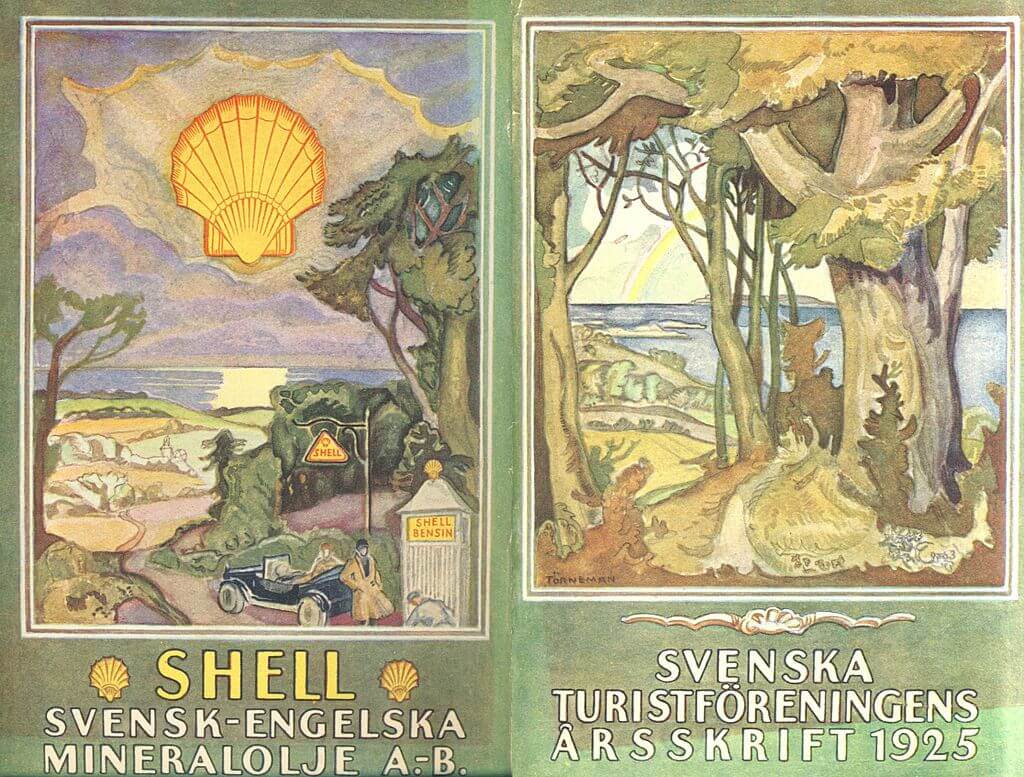
Die 1925er Jahresschrift der schwedischen Touristenvereinigung (STF) hat Axel Törneman ausgerechnet mit einer Benzinreklame illustriert. Dabei besteht das Riesenverdienst der STF im Markieren eines 450 Kilometer langen Wanderweges durch VÄSTERBOTTENS und NORBOTTENS LÄN bis nach Abisko am See Torneträsk, nahe der schwedisch-norwegischen Grenze (riksgränsen). Dieser Königsweg (kungsleden) ist sogar auf internationalen roadmaps eingezeichnet, aber nicht mit Autos zu befahren.
So war das mit dem Teilen im Nachtzug auch am Vorabend, mit Zacharias, genannt Zacka, aus Uppsala. Ein Student aus Uppsala! Ich grinse, das versteht nur, wer in den 1960ern die Charts verfolgt hat. Kirsti Sparboe, 1946 in Tromsø geboren, sang damals von der folgenreichen Begegnung einer Norwegerin mit einem Schweden „auf der Hütte im Schnee“. Der Schlager „Ein Student aus Uppsala“ blieb 14 Wochen in der deutschen Hitparade.

Kirsti Sparboe wurde 1946 in Tromsø geboren. Ihr „Student aus Uppsala“ blieb in meiner vom Rundfunk geprägten Teeniezeit 14 Wochen in der Hitparade. Das gab mir die Gelegenheit, die lyrics unlöschbar auf die innere Festplatte zu speichern: „Meine Freundin rief an, ob ich mitfahren kann, auf die Hütte im Schnee und ich sagte okay.“ Nur ein paar Jahre später sagte ich sofort okay. Und fuhr dann vierzig Jahre lang in der Sonne im März auf die Hütte im Schnee – und verlor mein Herz an die Hardangervidda, aber das ist ein anderer nordischer Schlager.
„Next Stop Kiruna“. Hier liegt die Skipiste gleich gegenüber vom Bahnhof und es verlassen uns der schweigsame Abteilgenosse, die vier Winterwanderer und überhaupt die meisten Passagiere. Zacharias liest in einem sehr großen dicken Buch namens Makro-Ekonomi, er will sich in Tromsø für den Masterstudiengang Staatswissenschaften bewerben und bevorzugt den Kapitalismus. Platziere ein paar kleinere und größere Gegenargumente.
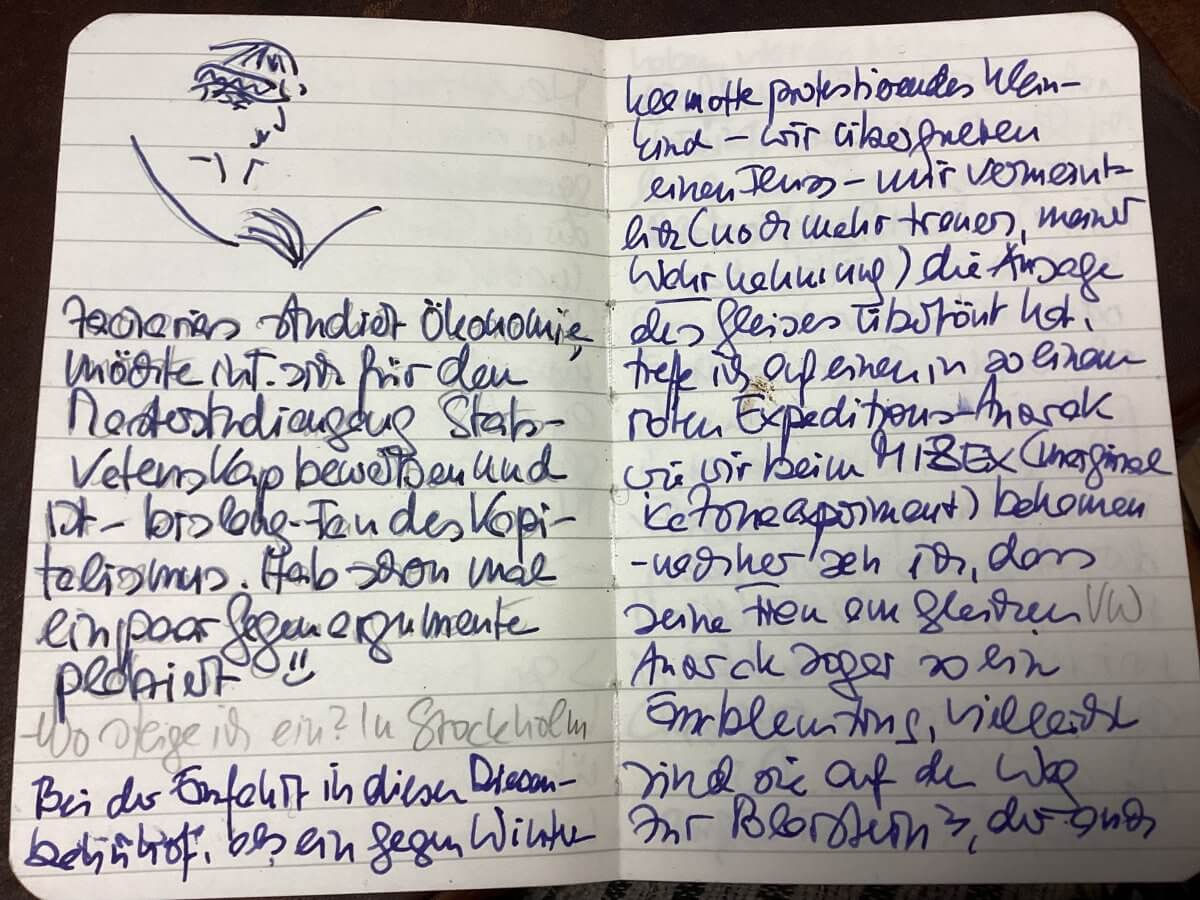
Und futtere im Speisewagen renskav med rorörda lingon och potatismos, das ist Rentier-Ragout mit rohgerührten Preißelbeeren und Kartoffelbrei, während die runden Kuppen des Abisko-Nationalparkes vorbeiziehen, wir einen Nebenfluss des Jukkasjärvi überqueren und durch einen Tunnel fahren. Es ist gerade noch hell gegen 13:00, der Zug hupt in den Kurven, neben den Gleisen geht es steil bergab. Der Himmel im Westen leuchtet. Die Berge zeichnen sich wie ein Scherenschnitt aus weißem Papier vorm blaugrauen Himmel ab. Haben Abisko hinter uns gelassen, hier endet das langgestreckte Gewässer namens TORNETRÄSK, Skandinaviens größter Bergsee, und der Vadvetjokkanationalpark beginnt.

Bahnhof Torneträsk, Von Kabelleger / David Gubler – Eigenes Werk
Der Nattoget Norrland fährt auf einer Anhöhe durch weiße Weiten – und hupt hin und wieder in die unendliche Stille hinein. Wir nähern uns der Grenze, eine ganze Weile schien alles menschenfrei, nun ein paar vereinzelte Hütten. Jetzt hohe Antennen, Scheinwerfer. Wir legen schon mal die wollene Unterwäsche etc. an. Wieder ein Tunnel. Es wird flacher. An der Grenze ein tief verschneiter Campingplatz. Nächster Tunnel. Noch flacher. Eine kleine Siedlung. 14:00, in den Holzhäusern haben sie das Licht noch nicht eingeschaltet. RIKSGRÄNSEN, der Zug ruckelt nach Norwegen, das Abteilfenster eröffnet uns umwerfende Ausblicke. Im letzten Licht dieses Sonntags türmen sich Bergwelten. Zacharias und ich, fast allein in unserem Nachtzug, der nun wieder in die Dunkelheit fährt, fühlen uns angesichts der Zweitausender direkt neben den Gleisen ziemlich klein und unbedeutend und sind uns in von meiner Seite gebrochenen „Skandinavisch“ einig, der junge Wirtschaftswissenschaftler und die alte Biologin, dass es Zeit ist, manches wieder in die richtige Dimension zu rücken, pflanzen ein wenig Zwergen-Feeling in unsere Herzen als Alternative zu menschengemachtem Größenwahn. Und staunen.
In NARVIK rutsche ich erstmal auf Glatteis aus. In meiner verklärten Erinnerung an mich als kleine Schlittschuhläuferin hatte meine Heimatstadt Hamburg früher durchaus brauchbare Winter, in denen eine ausführlich den Umgang mit Glatteis trainieren konnte, die bleiben aber seit Jahren aus. War einfach aus der Übung. Nix passiert. Der Bus trägt uns durch die Dunkelheit, am Ofortfjord entlang, in dem eine Seeschlacht 1940 Zerstörer versenkte. Parallel zur Küste, die auf der Karte aussieht, als hätte wer aus großer Höhe Teig hinabgeworfen, geht es Richtung Nordosten – verfahren kann eine sich nicht, es gibt nur eine Straße, und die ist, wie in Norwegen landesüblich, perfekt präpariert als Autopiste im Schnee. In Nordkjosbotn muss eine links abbiegen, in Fagernes beglitzert die Lichterkette der „Norwegian-Wood-Siedlung“ einen Abzweiger des Balsfjords, der wiederum in diesem Meeresarmgewirr – mit leicht zusammengekniffenem Auge sieht es auf der Karte aus, als habe eine riesige nordische Loreley riesige Bündel Seetang von den Bergen geschmissen – ein Stück südlich in Romsa (norw. Troms) mündet, einer ehemaligen Provinz von Norwegen, die im Süden an die norwegische Provinz Nordland, im Norden an die ebenfalls ehemalige Provinz Finnmárku (deutsch Feld der Samen, norw. Finnmark) grenzt.
eintauche Samstag, den 15. – 22:30 – Romssasuolu (Tromsøya) –
zuvor verspürte ich schon in Narvik das Bedürfnis, diese Luft zu verschlingen, auf der Insel beiße ich zu. Und sie schmeckt dort ein wenig anders, mehr nach Meer. Auch wenn Tromsøya, die Insel, auf der der Tromsø-City liegt, durch eine weitere Insel vom Polarmeer getrennt ist. Auch die Stille hört sich hier anders an. Zacharias bringt mich zur Haltestelle, von der ein Bus in Richtung einer Meeresbucht namens Giæverbukta bringt. Im Nachhinein frage ich mich, ob diese Bucht nach dem Tromsøgutten (Jungen aus Tromsø) John Schjeldrup Giæver benannt ist, einem 1901 dort geborenen Jäger, Polarforscher und Verfasser.
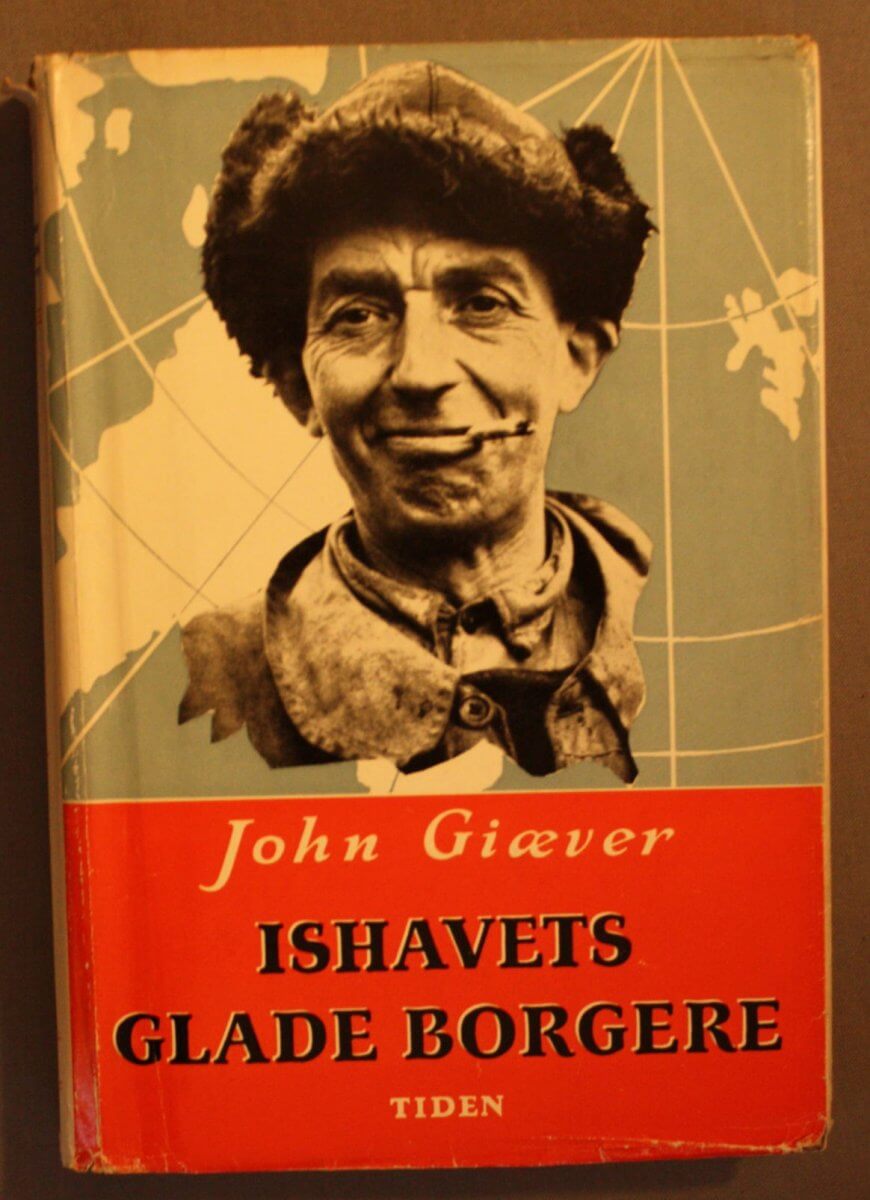
John Schjeldrup Giæver, in Tromsø geborener Jäger, Polarforscher und Verfasser aus Tromsø-City schrieb unter anderem über die glücklichen Anwohner des nördlichen Eismeeres (Arktischer Ozean, Nordpolarmeer, Arktische See oder Arktik)
Am 15. Januar lasse ich mich weiter im öffentlichen Verkehrsmittel treiben – immer am Wasser entlang, an einer Siedlung namens Sorgenfri vorbei zum Alaskasvingen. Dort stehe ich mit dem karierten Koffer im Schnee, zwischen diesen unheimlich heimeligen Häusern, die sich wie ein beleuchteter Weihnachtskalender die Anhöhe hinauf schwingen. Erste rechts, zweite links, hat Zacka noch bei Google ausgependelt.

Laurens Pérol am 21. Januar 2023 beim 33. Tromsø International Filmfestival (oben) und am 2. November 2023 bei den 65. Nordischen Filmtagen im Kolosseum in Lübeck, wo unter donnerndem Applaus sein Debut-Langfilm Å Øve /Practice gezeigt wurde. Er hat selbst zehn Jahre lang Trompete gespielt – auch Oblivion von Astor Piazolla, wie seine Protagonistin – und weiß, was es heißt „å øve“, zu üben. Und er trampt: auch zu den Nordischen Filmtagen in Lübeck ist Laurens per Anhalter angereist.

Trine, die Heldin von Å Øve /Practice verweigert als Klima-Aktivistin das Fliegen. Auf ihrer Heldinnenreise von den Lofoten nach Oslo steigt sie regelmäßig zum Open-ir-Üben aus. Seine Hauptdarstellerin Kornelia Melsæter hat Laurens Pérol mit einem casting call nach einer Trompete spielenden Schauspielerin gefunden. Das Ganze war eine „no-budget-production“ in zwölf Tagen. Alles musste auf Anhieb klappen. „go with the flow“, lautet Laurens´ Rezept. Und das Ende vom Film? Darüber habe jede/r ihre/seine eigene Version, sagt Melsæter. Meine ist: sie spielt nicht vor.
Und dann öffnet mir am Grønlandsvegen Laurens Pérol die Tür zum Holzhaus seiner WG (hier kollektiv genannt), wo ich zehn Tage mitwohnen darf – 1000 takk! Er kommt aus Stuttgart, gleich um die Ecke einer Filmakademie, hat aber die Nordland School of Arts and Film auf den Lofoten vorgezogen und dort zusammen mit Franciska Eliassen, umgeben von wilder Natur im Fischerdorf Kabelvag eine Bachelor-Ausbildung abgeschlossen, die die Absolvent*innen offensichtlich wie angekündigt zu kollektivem Denken und Handeln auf einem Feld, das sich rapide verändert – sowohl in den Inhalten als auch bezüglich der Technik befähigt und dazu, als unabhängige Filmemacher*innen zu arbeiten. Und ich bekomme auf der Stelle die einmalige Chance, die Präsentation für sein Road-Movie zu sehen. Dypdykk, wie die Norweger sagen, tiefes Eintauchen im wahrsten Sinne, zeigt es doch das Innere der jungen Musikerin, die, weil sie absolut kein Flugzeug nehmen will, zum Vorspielen in Oslo trampt, als Unterwasserwelt. Hinreißend ist es, wie ihre teils hindernisreiche, teils erlösende Anreise – der Trip der Künstlerin -, ihr Eintauchen in sich selbst, aus ihrer Trompete strömt!
schliddere Montag, den 16. – 08:45 – Romsa (Tromsø) – Sentrum –
mache mich auf zur Innenstadt (norwegisch: Sentrum) von Tromsø (nordsamisch Romsa) am Ostufer meiner derzeitigen Trauminsel, auf Nordsamisch heißt sie Romssasuolu, werfe von deren Anhöhe einen Blick zur größeren und gebirgigeren Walinsel (Kvalöya), die jenseits des Sandnessundes im Dunkeln ruht, und glitsche dann über eine sehr dünne Schneedecke auf Eishügeln bergab. Eine Schulklasse ist an diesem Morgen mit mir auf dem Bus-Trip um Sydspissen, die Südspitze von Tromsøya, herum in Richtung Sentrum und Havn (Hafen) am Ostufer. Und ich lerne an der Haltestelle, dass ich hier als Ü67 honorar/senior heiße und weniger bezahlen muss. Zum Bezahlen kommt es nicht, denn im Bus wird nur die Handy-App akzeptiert und ich habe weder App noch Handy. Sie befördern mich trotzdem zum sentrum.

Blick über die Insel Romssasuolu (Tromsøya) und den Tromsø-Sund rüber zum Festland vom Bergrestaurant Fjellstua, Svein-Magne Tunli

Blick aus dem mit TIFF-Logo verzierten Klo-Fenster des Storgata Camping schräg über den Tromsø-Sund rüber zum Festland gegen Mittag
Dort führt mein erster Weg zur Rødbanken, einem monumentalen Ziegelgebäude, 1910 – 1915 als Zentrale der Tromsø Sparebanken im Jugendstil errichtet. Im Inneren dieses von außen alten, von innen neuen Gebäudes kann eine den Mitarbeiterinnen von oben in die Kaffeetassen gucken und nach oben öffnet sich der Durchblick auf einen multifunktionalen Treffpunkt, echt einladend. Am guest desk des 33. Tromsø INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (kurz: TIFF) dort ist es um 09:00 noch ruhig und es gibt jede Menge Hilfe von Katharina, Geschichtsstudentin aus Deutschland,, und ihrer Kollegin, zwei der vielen Freiwilligen im TIFF-Staff. Bekomme den Erwerb von Isbrodder empfohlen, das sind Unterschnall-Spikes, und den abendlichen Auftritt von Mari Boine.

Rødbanken an der Storgata, der Hauptstraße von Tromsø . Das rote (rød) Jugenstilgebäude von Norwegens erster Sparebanken wird im Januar 2023 zum Headquarter des TIFF.
Größte Freude! Verehre diese Musikerin, habe all ihre Life-Auftritte in Hamburg besucht und hüte deren Aufnahmen von 1989 – 1990, aufgenommen in die fabulöse Reihe Real World Records. Behalte die alten Tonträger schon allein wegen der Verpackungen. Von Mari Boines „Gula Gula“ blickt aus weißen Federn heraus ein gelbes Auge.
So kann nur eine Schneeeule (Bubo scandiacus alias Nyctea scabdiaca) gucken, vermute ich, und gucke nochmal nach. Als Kennzeichen dieses für die Tundra – diese offene arktische Landschaft auf Permafrostböden, durch menschliches Wirken extrem bedroht, hat ihren Namen von den Sámi auf der Halbinsel Kola im Nordosten Russlands (wo heute nur noch rund 600 Menschen Kildinsamisch sprechen und ihre baumfreie Umwelt tundar nennen, mit Querstrich über dem U) – charakteristischen Vogels werden genannt: Groß; in fast allen Kleidern leuchtend weiß; Iris gelb.
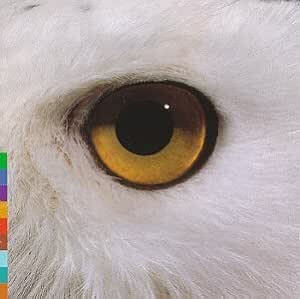
Gula Gula von Mari Boine in der Reihe Real World Records, wir blicken ins Auge einer Schneeeule (Bubo scandiacus alias Nyctea scabdiaca).
Nun zum Text: Im der CD beigelegten Booklet schreibt Keviselie alias Hans Ragnar Mathisen: „Im arktischen Teil Europas, so weit im Norden, dass es oft auf den Wetterkarten fehlt, lebt ein kleines Minderheiten-Volk, genannt Sámi (früher bekannt unter der herabwürdigenden Bezeichnung Lappen). Sápmi oder Sámiland („Lappland“), in den nördlichen Teilen Norwegens, Schwedens, Finnlands und der UDSSR (Anmerkung der übersetzenden Bloggerin: Keviselies Klappentext stammt von 1989), ist unser Heimatland“. Es sei von vielen vergessen, aber nicht von den Sámi, und auch nicht von „prospectors“, unternehmungslustigen Unternehmern (zu den sogenannten Prospektoren zählen unter anderen Edelmetall- und Öl-Sucher bzw. -Schürfer). Obwohl die harsche offizielle Assimilationspolitik in den vergangenen Jahren aufgegeben worden sei, sei das kulturelle Überleben auf keinen Fall einfach für ein Volk, das nach Einheit und Frieden strebe und gleichzeitig durch Grenzen in vier verschiedene Staaten aufgeteilt sei, die extrem unterschiedliche politische Positionen repräsentieren würden. „Aber die Jahrhunderte der Unterdrückung und des Herausarbeitens von Überlebensstrategien haben uns einige Erfahrung verschafft“, fährt der samische Autor fort. „Obwohl viel verloren gegangen ist und oftmals der rasche Untergang prophezeit wurde, haben wir noch unsere Sprache – in einer erstaunlichen Vielfalt von Dialekten.“ Menschen mit einer intakten Muttersprache könnten Reden halten, Geschichten erzählen („storytelling“), unterrichten, Gedichte und Lieder schreiben. „Unsere Musik mag sich simpel anhören, aber sie ist so stark und sicher wie der Wind, der die wilden Berggipfel unserer schönen Heimat berührt, und so alt wie die weichen Wellen, die fortwährend unsere Küste streicheln.“ Mari Boine Persen habe wie andere samische Künstler*innen „auf die traditionelle Dichtkunst und Musik unseres Sámi Erbes zurückgegriffen“, schreibt Mathisen alias Keviselie, „als Basis für neue Interpretationen – mit einer Botschaft für unsere Zeit und die Zukunft.“
Dramatische Konfrontation oder Denkwürdiger Denkweisenkonflikt
Boines Botschaft ist unter anderem eine feministische. 1988 erregte sie Aufsehen, als sie Musik zu einer Performance komponierte, für das Sámi Našunal Teáhter. Dieses Nationaltheater der Sámi, in der Finnmark, in Guovdageaidnu (Kautokaino) gegründet, laut dessen Website „in der intensivsten Phase der neueren norwegischen Geschichte“, als die Regierung in Oslo beschloss, den Alttáeatnu (Alta- oder Kautokeinoelva) zu dämmen und es im Inneren von Finnmárku (der Finnmark, auf Deutsch einst auch „Feld der Samen“ genannt) zur „dramatischen Konfrontation zwischen nationalem Machtapparat und Demonstranten kam“. 1989 gibt Boine diese fürs Theater komponierte Musik als „Gula Gula – Hör stammödrenes stemme (Höre die Stimme der Vorfahrinnen/-mütter)“ heraus.
Ihr Album sei der Ausdruck eines Lebens im Konflikt zwischen zwei Denkweisen, zwei Kulturen, schreibt Keviselie. „Mari wird geboren und wächst auf in Gamehisnjárga, einem Vorgebirge, das der Anarjohka ruhig umfließt. Ihre Eltern lebten von der Lachsfischerei und von der Landwirtschaft und sie wuchs eingetaucht in die Natur der Region auf. . Die Schule, die sie besuchte, spiegelte, obwohl nicht weit von ihrem Elternhaus entfernt, eine völlig andere, fremde Welt wider. Sogar die Sprache war fremd – sie erhielt in ihren neun Schuljahren keinen Unterricht in ihrer Muttersprache.“ 1956 in der Gemeinde Karasjohka (Karasjok), im Hauptsiedlungsgebiet der Sámi in Norwegen, geboren, erlebt Mari Boine Person dort die „Fornorsking av samer“.


Boines Geburtsort Karasjohka (Karasjok) hat(te) offensichtlich romantische Seiten: das untere Bild von einer Bomme, Truhe, ist sicher älteren Datums als das Foto vom Boot auf dem Fluss 1989. Die Truhe wird als russisch bezeichnet, die traditionellen Behälter der Sámi waren oval oder rund, lerne ich im digitalen norwegischen Museum (siehe unten). Das besitzt eine samische Bomme von 1890, die vielleicht auch bald dem Samischen Museum übergeben wird?

Und ich danke neben dem digitalen Museum Wikibrief und kopiere zur Norwegisierung, dies sei „eine offizielle Politik der norwegischen Regierung, die sich gegen die Sámi … in Nordnorwegen richtete. Ziel war es, nicht norwegischsprachige einheimische Bevölkerungsgruppen in eine ethnisch und kulturell einheitliche norwegische Bevölkerung zu integrieren. Der Assimilationsprozess begann im 18. Jahrhundert und war zu diesem Zeitpunkt von einer klaren religiösen Agenda motiviert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde er zunehmend vom Sozialdarwinismus und Nationalismus beeinflusst, in dem das samische Volk und seine Kultur als primitiv und unzivilisiert galten. … Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor das rassenbasierte Assimilationsargument erheblich an ideologischer Anziehungskraft. Dies war auch die Zeitspanne, in der das norwegische Wohlfahrtssystem zementiert wurde. Als solche wurde die fortgesetzte Assimilationspolitik als Teil der sozialen Entwicklung der samischen Gebiete gestaltet.“ Als Mädchen schämt Mari Boine sich für ihr Volk und ihre Herkunft.
Später beginnt sie, gegen ihre untergeordnete Rolle als sogenannte Lappin in der norwegischen Gesellschaft zu rebellieren, schreibt aus eigener Erfahrung das Rezept fürs Herrenvolk: Ziehe Grenzen auf der Landkarte und nenne es den Staat/sei König, Minister, Beschützer und Vater/schicke Verwalter und Geschäftsleute, Priester und Soldaten/ zu den Menschen, denen das Land gehört, das du nimmst. Benutze Bibel, Besäufnisse und Bajonett/ brich Versprechen und Vereinbarungen/ sei ein Diplomat/ nutze Gesetzes-Artikel gegen alte Rechte/ schaffe Vorurteile, Diskriminierung und Hass. Lasse niemanden deine Autorität in Frage stellen/ so unterdrückst du eine Minderheit. Verlagere Sprache und Kultur ins Museum, in die Forschung, mach sie zur Touristenattraktion/ halte flammende Reden bei jedem Fest/ lass es sich zersetzen und sterben, was eine Nation war.“ Kollege Keviselie schreibt: „Sie hörte nicht auf zu fragen – über ihre Herkunft, über die Wege zu einer auf Menschenwürde aufgebauter Gesellschaft.“ Und bekommt Antworten, wie Keviselie in seinem Künstlerinnen-Porträt abschließend schreibt: „Bei ihrer forschenden Suche haben die Stimmen der Vormütter sie erreicht.“

Bestens mit Eingebungen, Erinnerungen, Verknüpfungen (missing links) und Hinweisen sowie mit einem geräumigen TIFF-Sack – aber noch nicht mit Spikes – versorgt, tappe ich sehr vorsichtig auf Tromsøs Hauptstraße, der Storgata, gen Süden und taste mich in diffusem Sonnenlicht zum Storgata Camping vor, zur Apningskonferanse. Die beginnt mit matbit, mingling og minigolf, übersetzt und erklärt: Eröffnungskonferenz mit Essen, Begegnen und Indoor-Golfen in einem ehemaligen Laden für Campingbedarf. Kultusministerin Anette Trettebergstuen verkündet das goldene Zeitalter des norwegischen Films und freut sich auf den Jahreshöhepunkt für alle, die Filme lieben.
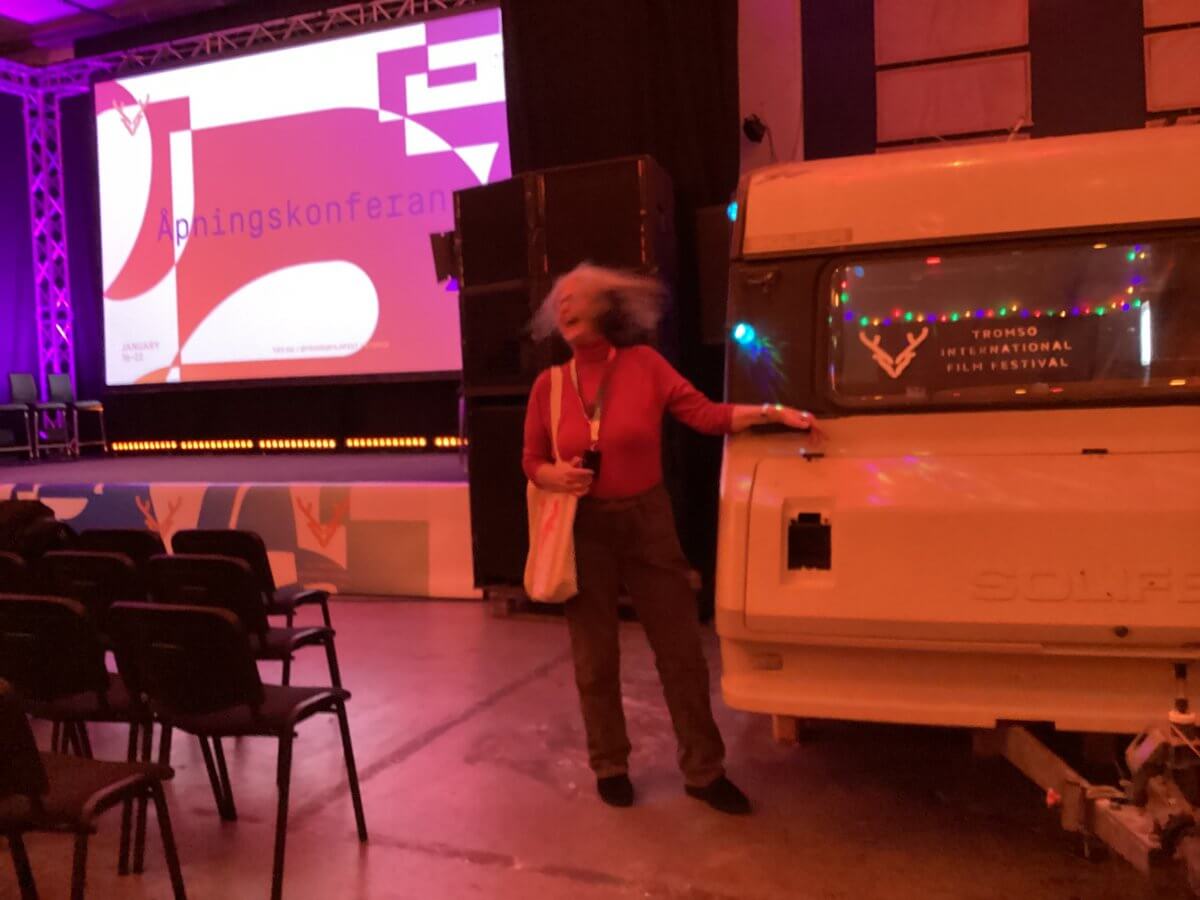
Was ein Vertreter der filmindustri ist, der macht ja nicht einfach ein Foto. Mein Festivalbeutel und ich bei der Eröffnungskonferenz zum 33. TIFF im Storgata Camping am westlichen Ende der Hauptstraße
„Hva skal vi med regionene?“ war die Frage. In den Regionen lägen die Geschichten, sagt Maria Ekerhovd, die sich fürs stationäre Arbeiten in der Region entschieden hat. Das habe auch den Vorteil, dass die Crew nicht ständig umherziehen müsse. Sie ist Produzentin des Eröffnungsfilmes, der von einem heftig geführten Kampf in der Region Alta handelt, wo Ende der 1970er-Jahre die Proteste gegen den Bau eines gewaltigen – eine ist versucht zu schreiben gewalttätigen – Staudammes inmitten der Finnmark zu Gewalttaten der norwegischen Polizei führten, die dort ihre größten Einsatz in der Geschichte des Landes hatte. Ella Marie Haetta Isaksen spielt eine Lehrerin, die zu dieser Zeit nach Alta kommt und in Konflikte gerät, auch auf Grund ihrer samischen Identität. Und dann kam der Trailer aus der Region Alta, wo sich Ekerhovds Film „Ellos Eatnu – la Elva leve“ abspielt. Und ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe, mir kam ein Schluchzen. Da wäre ich wohl als norddeutsche Ökoaktivistin hineingeraten, hätte ich in Nordnorwegen studiert.
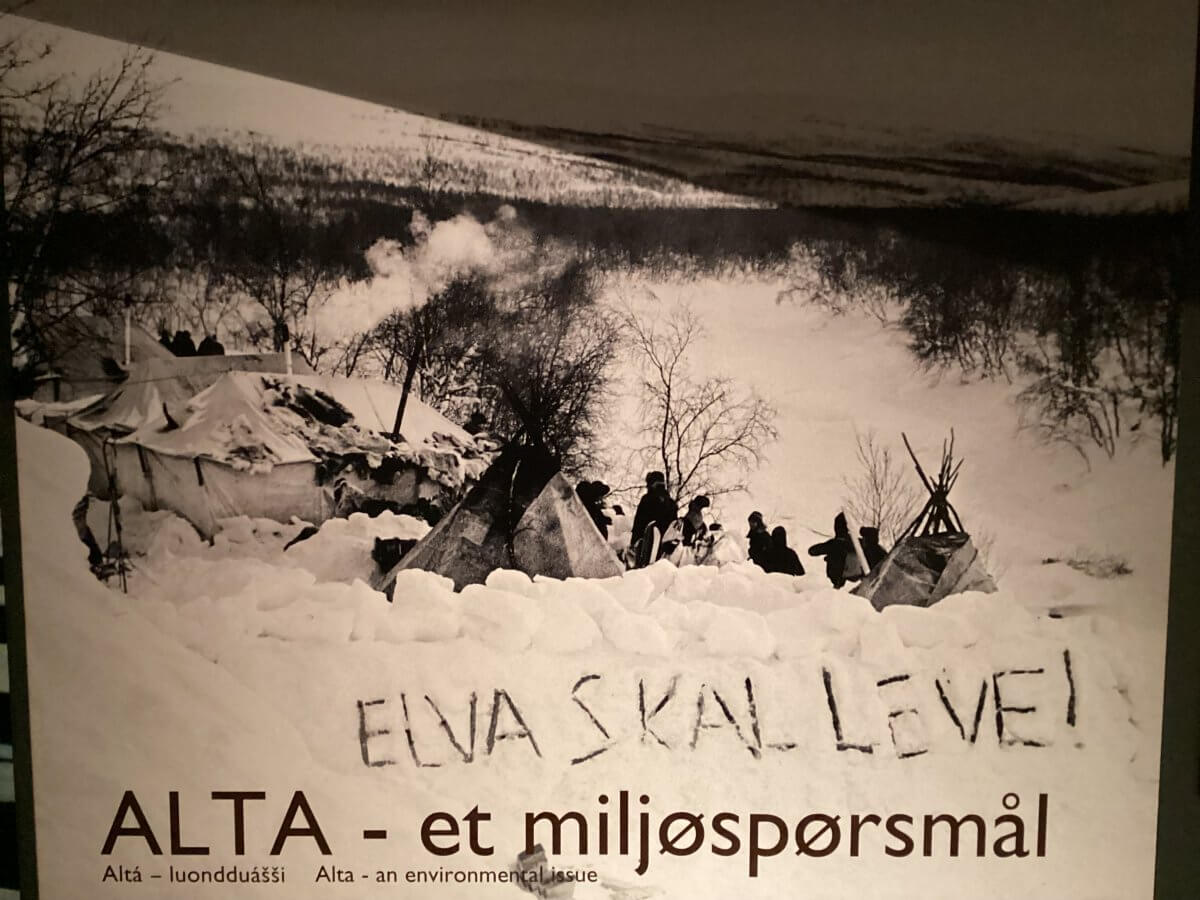
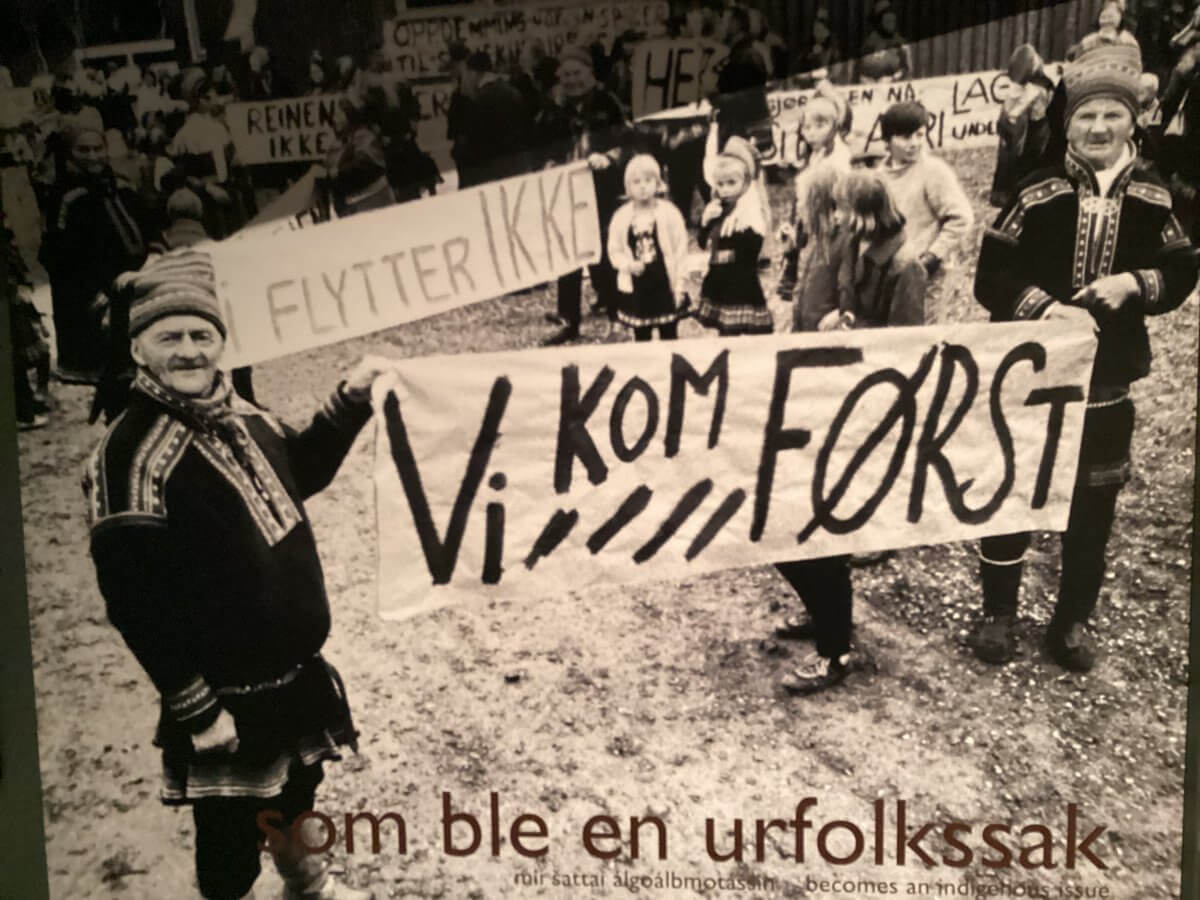
„Eine Umweltfrage, die Sache der Indigenen wurde“, steht in NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM (http://uit.no/tmu), Tromsøs Arktischem Universitätsmuseum, unter diesen Bildern aus den 1970ern. Bei der Eröffnungskonferenz des 33. TIFF bewundere ich den Trailer zu Ellos eatnu, La elva leve, Lasst den Fluss leben, so heißt der diesbezügliche Film, der dort Premiere feiert, der Spielfilm, in dem Ella Marie Haetta Isaksen so hinreißend joikt, dass es auch ein fast ganzes Jahr später die Besucher*innen der 65. Nordischen Filmtage in Lübeck packt.
Die Koinzidenzen rieseln wie Schneeflocken, am nächsten Tag ziehe ich am Grönlandsvegen das Buch von Ella Marie Haetta Isaksen aus dem Regal. Ergreifend und anrührend ist der Trailer, den wir der bei der Eröffnungskonferenz sehen, weist über die historischen Auseinandersetzungen hinaus auf den Überlebenskampf dieses indigenen Volkes, der erst heute, knapp ein halbes Jahrhundert später, wirklich ins Blickfeld gerät. Auch auf der Eröffnungskonferenz tragen Frauen mit Spaß und Stolz ihre Trachten, in Gold und Silber oder kräftigen dunklen Farben und die großen Broschen. Und die Filmproduzentin zeigt auch entspannten Stolz. Ihren Erfolg verdanke sie „kunstners drivkraft og entrepreneurs drivkraft“, das heißt, dem Antrieb, der Power, dem Drive sowohl der Künstlerin, als auch der Unternehmerin. Die beiden Norweger am Nachbartisch im Café des Aurora-Kinos fügen auf Nachfrage hinzu, dass zur drivkraft auch das Durchhaltevermögen gehöre – und dass es hier einen Radiosender namens Drivkraft gibt.

CAMPINGEN (Storgata Camping), wo die TIFF-Eröffnungszeremonie der Filmindustrie 2023 stattfindet, war wirklich mal ein Hort für Campingzubehör. Der Staff des TIFF besteht zum größten Teil aus Freiwilligen. Menschen aus der ganzen Welt, fast jeden Alters, geben sich die Ehre, dieses Fest im hohen Norden zu unterstützen.
Mich treibt es jetzt ins Kino, ins AURORA: benannt nach dem Polarlicht (in Tromsø leuchtet uns manchmal, wenn wir den Weg aus den Lichtspielhäusern in die Dunkelheit finden, wenn wir gar nicht damit rechnen, Aurora borealis, das Nordlicht), das größte und bestbesuchte Filmtheater in Nord-Norwegen, eine „Gemeinschafts-Produktion“ der kommunalen Film-Unternehmen von 2007, wo 365 Tage im Jahr in sechs Sälen Filme gezeigt werden. Im Keller des weitläufigen Betonpalastes an der Storgata, im TIFF-typischen, gut organisierten und entspannten Gewühl, treffe ich Katharina wieder, die berichtet, dass der Staff-Job an der Rezeption im Laufe des Vormittags enorm an Fahrt aufgenommen hat.
Erlesene Eisweisheiten oder Zerstörerische Zeitgenoss*innen
Dem Festival-Programm lässt sich Endzeit-Stimmung entnehmen. Franciska betitelt ihren Debutfilm, der 2022 bei den 64. Nordischen Filmtagen lief, aus dem Norwegischen übersetzt „Der letzte Frühling“ und die Doku, die ich an diesem Nachmittag sehe, bei meinem ersten Tauchgang in die TIFF-Sektion „film fra nord“, die ich mir aus dem üppigen Programm dieses Festivals gefischt habe, heißt „The Last Human“. Aber eigentlich handelt sie vom Leben. Das beginnt in Grönland, sagt Geologe Minik Rosing, 1956 dort geboren. Seinen Beruf habe er vor allem gewählt, weil er so gerne auf grönländischen Gebirgszügen herumschweift. Dabei kommen ihm 1999 östlich der Hautstadt Nuuk extrem alte Ablagerungen unter den Hammer, die ältesten Gesteine der Welt. Als er darin Spuren von Kohlenstoff entdeckt, hält Rosing sie zunächst für Dreck. Aber es handelt sich hier um fast vier Milliarden Jahre altes organisches Material, das auf lebende Organismen, in diesem Fall Bakterien, verweist. Seine Entdeckung wirft alle bisherigen Hypothesen über die Entstehung des Lebens auf der Erde über den Haufen. Auch die Kinder sprechen übers Leben. Der grönländische Regisseur Ivalo Frank gibt ihnen dafür soviel Raum, dass vor treibenden Eisschollen universelle Antworten durchschimmern. In der Polarregion schreitet die Erderwärmung wesentlich rasanter und dramatischer voran als auf dem übrigen Planeten, das macht Grönland zum wissenschaftlichen Hot-Spot. Oder zu Ground Zero? Oder verweist es auf den von Menschen gemachten Anfang vom Ende? Wir hätten die Umwelt ruiniert, sagt einer von Ivalo Franks Protagonisten, und die nächsten Generationen müssten nun sehen, wie sie damit klarkommen.

The Last Human von Ivalo Frank, filmens_thumbnail
Ivalo Frank, die diesen tollen Film – eines meiner absoluten Highlights beim 33. TIFF – gemacht hat, gehört unbedingt in die Liga mostly young – mostly women – mostly fanatstic/brave! Sie wurde 1975 als Tochter dänischer Eltern in Nuuk geboren, wuchs in Dänemark auf, studierte Philosophie an der Uni Kopenhagen und anschließend Anthropologie an der Uni Lund, ließ sich in Berlin nieder, produziert gesellschaftswissenschaftliche Kurzfilme zu Themen wie Krieg und Postkolonialismus und initiierte 2012 das Filmfestival Greenland Eyes, das in den folgenden drei Jahren in Berlin, Skandinavien, Grönland und den USA stattfand.
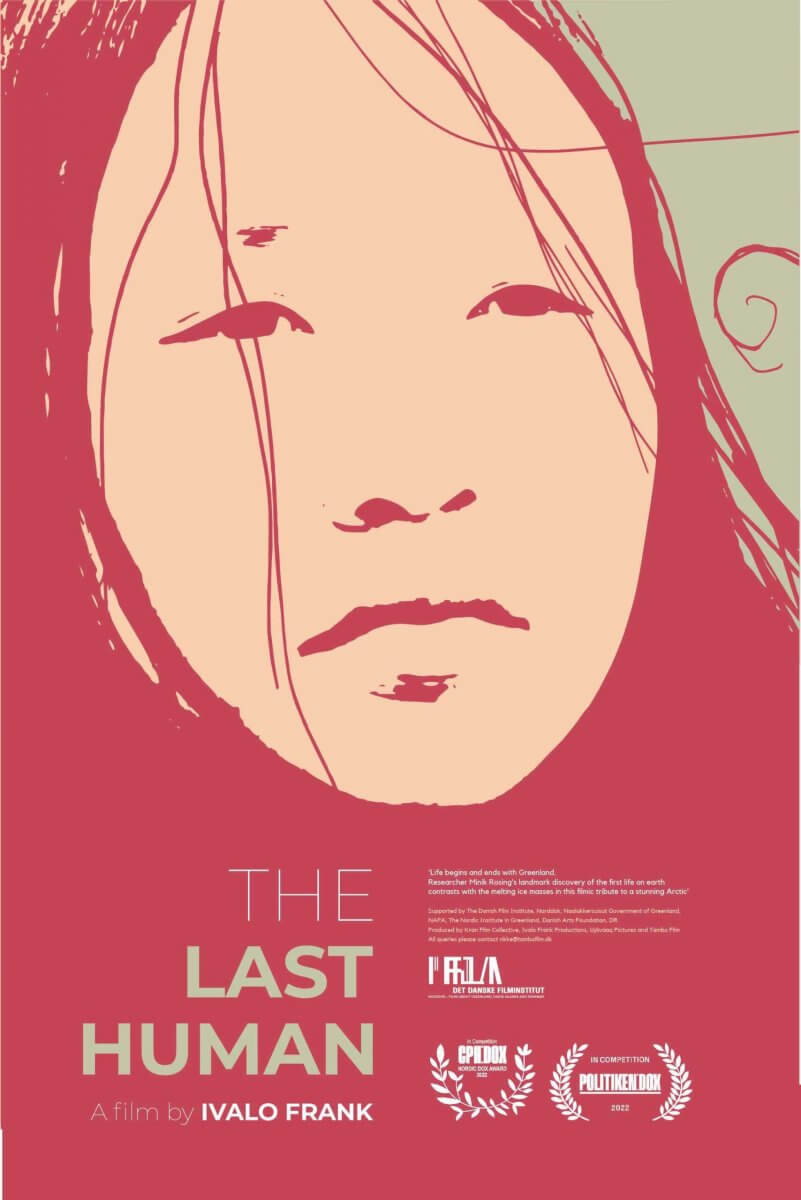

Anthropologin, Philosophin, Filmkünstlerin Ivalo Frank, Foto Heart
Die Site icewisdom.com des grönländischen Schamanen Angaaangaq berichtet vom tiefsten Winter im Jahr 1963 (!), als zwei junge grönländische Männer, die auf Jagd waren, bemerkten, „dass aus dem Großen Eis Wasser abfloss“. Als sie den Ältesten über dieses seltsame Ereignis berichteten, habe ihnen niemand geglaubt, weil die Temperatur seit drei Monaten unter minus 30 Grad Celsius lag. Später im Winter hätten die Ältesten auf ihrer Jagd dieselbe Erfahrung gemacht: Wasser rann aus der Großen Eiswand. „Dieses war das erste Zeichen dafür, dass etwas verkehrt war – nicht zu Hause im Grönland, sondern in der Welt.“ Aus einem Rinnsal seien mittlerweile tosende Flüsse geworden, die sich in den Atlantik ergießen. Die durchschnittliche Höhe der Eiskappe habe um mehrere Kilometer abgenommen, dieser Prozess beschleunige sich. „Heute brechen Hunderte reißender Flüsse übers ganze Jahr aus dem Eis hervor. Aus erdzeitlicher Sicht vollzieht sich die Eisschmelze unmittelbar, augenblicklich. Das Schmelzen des Eiskaps ist der dramatischste Beweis des globalen Klimawandels und seiner exponentiellen Beschleunigung. Grönland ist der „Ground Zero“ des Klimawandels. Gewiss ist, dass sich unsere Welt verändert und diese Veränderungen bestenfalls unsere Lebensweise verändern und schlimmstenfalls zerstören. Das schmelzende Eis in Grönland fordert uns dazu auf, die spirituelle Bedeutung des Klimwandels zu begreifen und unsere Lebensweise zu reflektieren. Es ist Zeit, mit Augen des Vertrauens in unsere Zukunft zu blicken und daran zu glauben, dass wir unsere innere und äußere Umgebung verändern und so die Zukunft unserer Erde neu gestalten können. Wenn wir zu einem Leben in Harmonie zurückfinden, das Eis in unseren Herzen schmelzen und uns wieder miteinander verbinden, dann werden wir überleben.“ Da fällt mir „Der Gesang des Eises“, das Buch der deutschen Archäologin Annabelle Wimmer Bakic. Aus der Archäologie wisse sie, wie kollektives Wissen über Generationen weitergereicht werde. Bei ihrer Schlittenreise mit dem Schamanen Ankaara zu den alten Ritualplätzen auf Grönland, deren Ziel es ist, verloren gegangenes Wissen zu bergen, birgt die junge Wissenschaftlerin „das Wissen des Eises“. Dessen äußerer Teil besagt, dass das Eis die Mutter allen Lebens ist. Auch den inneren „Gesang des Eises“ hört Wimmer Bakic: „Wie das Eis im Herzen Grönlands schmilzt, so soll auch das Eis in euren Herzen schmelzen“. Sie vernimmt auf ihrer Reise durch die Eiswüsten Grönlands, dass dieses innere Wissen für „eine Zeit des großen Miteinanders zwischen den Menschen und allen lebendigen Wesen, einschließlich der Erde und des Universums“ stehe. Zurück ins Aurora-Kino. Geologe Rosing hat die unterschiedlichsten Leute kennengelernt, als Leiter der Galatea-Expedition, einer Weltumsegelung zu Bildungs- und Forschungszwecken, und bei anderen interkontinentalen Tätigkeiten, zum Beispiel der Weltklimakonferenz, zu der er zusammen Eisblöcke gekarrt hat, um aufs Schmelzen des Polareises aufmerksam zu machen. Die wenigsten dieser potenziell letzten ihrer Art, die er getroffen hat, seinen „assholes“.
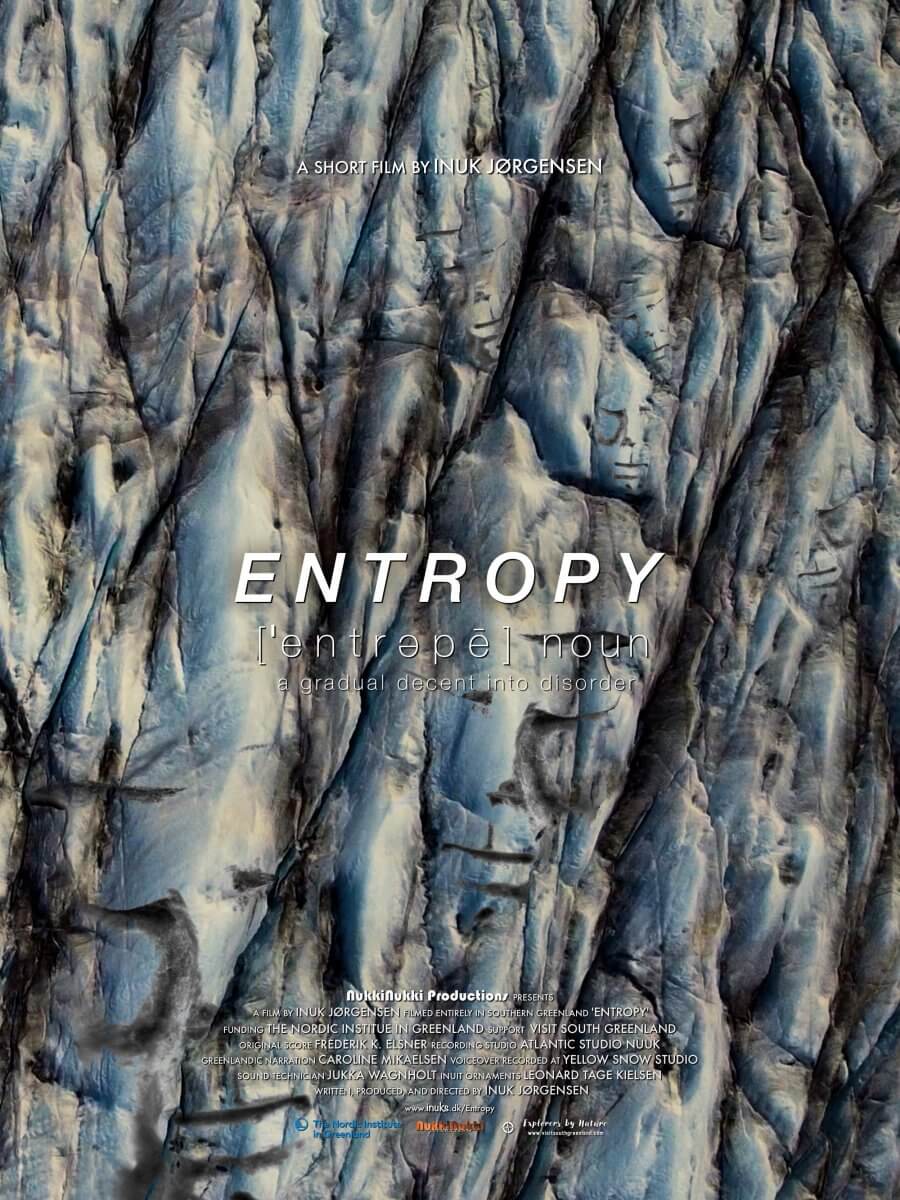

Und der 1981 in Grönland geborene und dort aufgewachsene Filmemacher Inuk Jørgensen (www.inuks.dk/Entropy) legt nach. Bei der Premiere von Future North, der allerersten Ausgabe eines Talentprogamms für Indigenes Filmschaffen am 2. November 2023, zeigte er das Abschmelzen und Wegbrechen von Natur und Kultur in der Arktis. Und zwar zum weltersten Male aus der Perspektive eines Inuit. „Climate change is so much more“, sagt Jørgensen, mit dem Eis würden Kultur und lokale Weisheit schmelzen. „The Inuit are not concerned about Western concerns“. Ihre Erzählungen handeln, wie seine Dokumentation ENTROPY (fast) nicht von Menschen, ihre Sprache und Kultur beruhe auf der Natur. Jørgensens Credits gehen daher an Mutter Gletscher.
Irritierendes Input-Interview oder Beredtes Schweigen
Als ich im Januar 2023 nach dem Gleiten durch Ivalos The Last Human auf die kahle Betontreppe des AURORA Kinos trete, die in die kühle Realität der Gröngata führt, treffe ich Asta Mitkija Balto, leuchtend rot gekleidet, klein, schmal und mit riesiger Ausstrahlung. Sie hat mich an meiner Mütze mit den bunten Wollfäden, die ein bisschen wie Antennen aussehen, „erkannt“. Wir zwei kennen einander nicht und doch erkennen wir einander. Kriege einen Rüffel, weil ich zu viel quatsche. Wenn ich etwas erfahren wolle, müsse ich auch mal den Mund halten. Recht hat Asta. Und erzählt mir, dass Zuhören eher die samische Art sei. „Take a Stone in your Hand and let ist be there until you hear its heart.“ Und dann werden wir uns doch einig bei unserem kleinen Kaffeeklatsch, unter anderem darüber, dass es für uns Ältere in diesen auch verstörenden Zeiten darauf ankommt, ganz genau herauszufinden, was das Universum mit uns vorhat, „how the universe works with us“. Das bedeutet für Mitarbeiterinnen des großen Ganzen beileibe nicht, die Hände in den Schoß zu legen, aber immer wieder, nach innen und nach außen zu lauschen. Und auch mal zu schweigen.

Asta Mitkija Balto, emeritierte Professorin, hat zum traditionellen Wissen, zu Werten, Lebensweisen und vor allem der Pädagogik der Sámi geforscht.
Allerdings macht meine Input-Interview-Methode – ich erzähle ohne Punkt und Komma von Menschen und Ereignissen, von denen ich ahne, dass sie einen Faden zur Gesprächspartnerin spinnen und texte Asta gleich vorm Kino voll mit meiner Begeisterung für Britta Marakatt Labba, geboren 1951 in der Sápmi-Region, deren Stickerei 2017 auf der Dokumenta ausgestellt war – die Welt klein und ich erfahre, dass Asta mit Britta eng befreundet ist.
Marakatt Labba gehört zu einer Gruppe von Künstler*innen, die seit den 1970ern mit ihren Werken Stück für Stück Würde und Stolz der indigenen Bevölkerungsgruppen zurückerobern. Und ich habe ein Déjà-vu: glaube, ich habe gesehen, wie Asta und Britta den Erfolg der Stickerei „Historjá“, die im wahrsten Sinne Fäden zieht von den Ahnen in Sápmi über die Widerstandsbewegung im 20. Jahrhundert bis in die Zukunft, gefeiert haben, im Kino, im Dokumentarfilm über die Textilkünstlerin. Die sagt von sich, angesichts des Durchbruchs nach 40 Jahren Storytelling per Stickerei, dass sie vor allem beharrlich war, nie scharf drauf, ihre Arbeits- und Ausdrucksweise zu ändern, weil etwas anderes „trendier“ war.

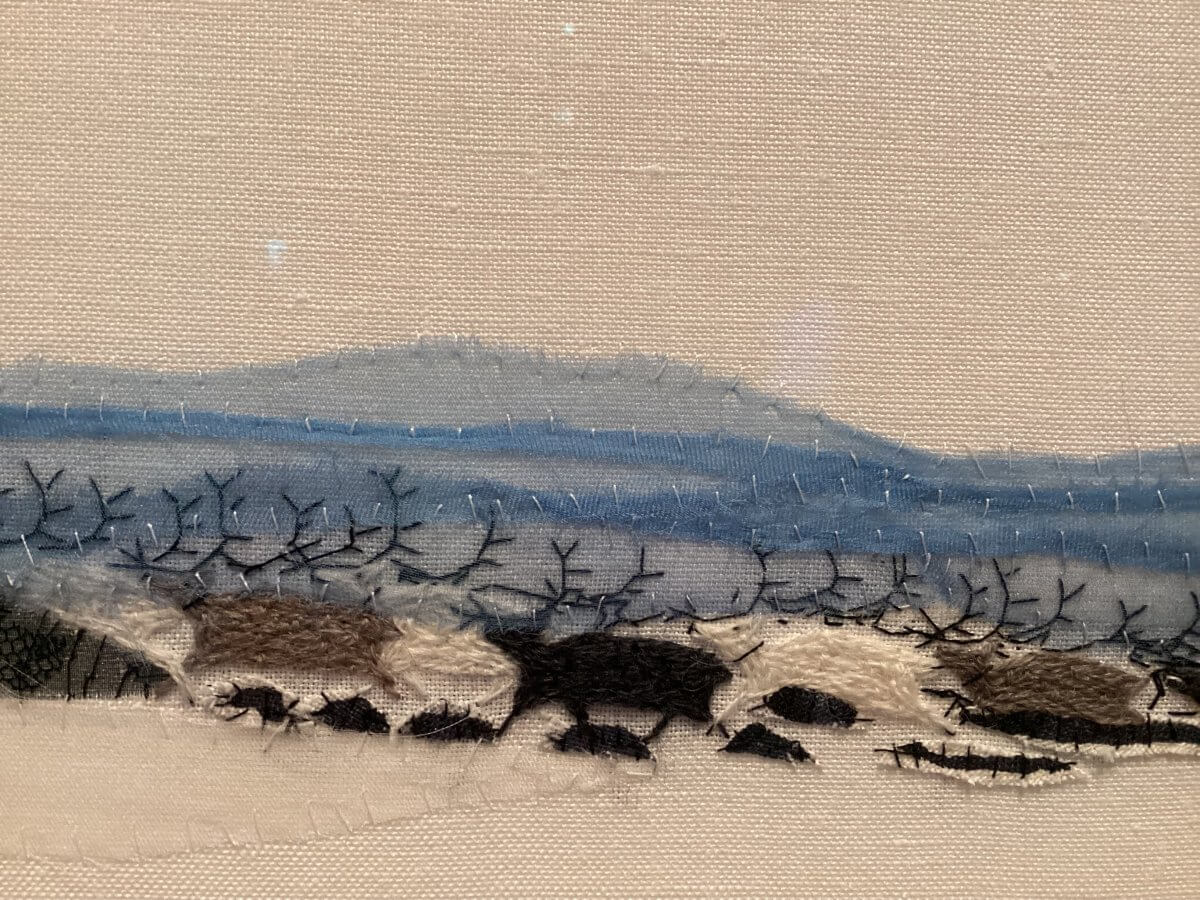
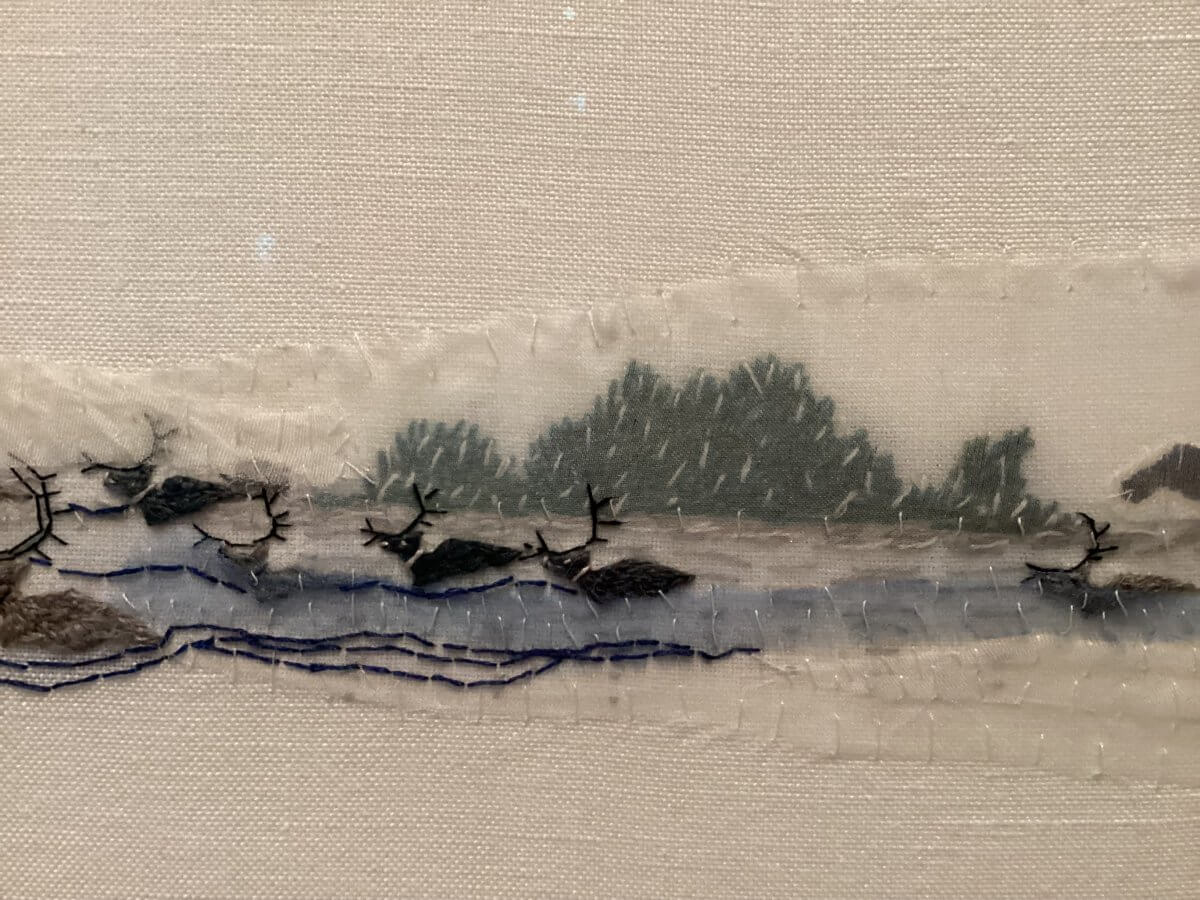
Britta Marakat Labba, 1951 in einem sameby, einer von Sámi bewohnten Ortschaft, geboren, schafft seit Jahrzehnten mit ihren Stickereien Miniaturwelten in sehr großem Stil, in diese gestickten Welten passen Kultur, Geschichte, Politik, Religion, Natur, konstsallskapetvagase.com.
Eines ihrer Werke ist bis zum 25. Februar 2024 in Hamburg ausgestellt, im MUSEUM AM ROTHENBAUM Kulturen und Künste der Welt (MARKK).
Die Welt wird wieder sehr weit, als Asta mir von der Denk- und Lebensweise der Sámi erzählt. Ist es ein Wunder, dass sie als Nomaden Weitgeistigkeit und stillen Tiefsinn über unzählige Generationen weiterentwickelt und -gegeben haben? Als wir über den Film „The last human“ sprechen, lerne ich über diehtu und dieda – und freue mich, dass Asta mir die Vokabeln in mein schwarzes Notizbuch mit dem TIFF-Logo, dem Rentiergeweih, schreibt, weil ich digital keinen Querstrich beim D produzieren kann, und vor allem, dass sie mir als erfahrene Lehrerin die samischen Wörter für Wissen und Wissenschaft praktisch auf die Zunge legt, verbunden mit einem Hinweis auf das Feld „native science“. Dem werde ich nachkommen, inspiriert durch das, was ich im November bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck, aus den Dokumentationen über Brittas künstlerische und politische Arbeit und über ein indigenes Volk im brasilianischen Dschungel herausgehört habe über das alte Wissen, kundskap auf Norwegisch, knowledge auf Englisch. Mein diesbezüglicher Kurzbericht aus der Republik Altai im südwestlichen Sibirien erzeugt ebenfalls Resonanz. Asta erzählt, ihr Volk stamme ursprünglich von dort: „Altai is the Origin of the Sámi culture“. Das trifft sich. Auch die Vorfahren meines Vaters, das von den Kreuzrittern nahezu restlos überwältigte baltische Volk der Prußen, sind, zumindest nach ungefähren Angaben der lettischen Ethnologin Marija Gimbutas, aus dieser Region an die Ostsee vorgedrungen – und hatte damit den kürzeren Weg. Da die Prusai, wie sich der westbaltische Volksstamm, von dem ich abstamme, selber nannte, ausgestorben (manche schreiben „assimiliert“, mir fällt auch ausgerottet ein) ist, sind die Sámi nun das einzige indigene Volk, das in Europa überlebt hat. Und Asta gehört zu der ersten Generation von Sámi mit universitärer Ausbildung. Sie ist emeritierte Professorin der 1989 gegründeten Sámi University of Applied Science in Guovdageaidnu (nach ihren Worten sprachlich „kolonialisiert“ als Kautokeino), arbeitet dort auch in der Sámi National Theatre Company, die sich nun während des TIFF in Tromsø trifft und muss jetzt los zu deren Meeting. Am Montag war Asta gerade angekommen – und es war aber vom Universum so gedacht, dass wir noch einmal aufeinander stoßen sollten, kurz vor ihrem Abflug. Davon später.

Die Rentierbrühe nach uraltem samischen Rezept muss mindestens fünf Stunden kochen. Sie heizt von innen im Außenkino (utekino) und die Rentierfelle auf den Palettenbänken wärmen uns Outdoor-Cineast*innen von unten.
Bin gut eingestimmt für die Opening Ceremony im Winter Cinema. Stapfe zum Stortorget und bekomme dort einen Becher heiße Brühe, fünf Stunden aus Rentierfleisch und -knochen gekocht nach ganz altem Sámi-Rezept von Schüler*innen aus dem kleinen Ort Lakselvbukt, dessen Schule insgesamt 17 Schüler hat, und fotografiere, ohne zu wissen, wenn ich vor mir habe, zwei Frauen in der ersten Reihe des Utekino – Outdoorkino, wo sie auf Rentierfellen sitzen. Links auf dem Bild ist Silje, sie trägt gákti, die Tracht der Sámi, soviel weiß ich inzwischen. Erst als Silje die Bühne aus Schnee betritt, erfahre ich, dass sie Silje Karine Muotka ist, Präsidentin des Sámi-Parlamentes. Seit meinen Norwegenreisen als Studentin in den 1970ern ist im Norland viel passiert, von dem ich wenig mitbekam. In Karasjohka (Karasjok) wird 1989 das Sámediggi (Sametinget), das Parlament der Sámi in Norwegen konstituiert und 1997 entschuldigt sich König Harald V. von Norwegen als erster Regierungsvertreter offiziell bei den Sámi für die Handlungen des norwegischen Staates: „Der Staat Norwegen wurde auf dem Territorium zweier Völker gegründet – des samischen Volkes und der Norweger. Die samische Geschichte ist eng mit der norwegischen Geschichte verflochten. Heute drücken wir im Namen des Staates unser Bedauern für das gegen das samische Volk begangene Unrecht aus seine harte Politik der Norwegisierung.“

Silje Karine Muotka, Präsidentin des Sámi-Parlamentes, des Sámedggi
Parlamentspräsidentin Muotka spricht bei der Eröffnungszeremonie in Tromsø über den TIFF-Eröffnungsfilm „Ellos eatnu – La elva leve“, mit dem Regisseur Ole Giaever den Konflikt um den Alta-Staudamm und zugleich den Kampf der Sámi um ihre Rechte und ihr Überleben aufgreift, spricht von einer „great historic première“, und hofft, sie möge die junge Generation dazu bewegen, immer bessere Fragen über die Sámi zu stellen. Und die Hauptdarstellerin des Films sagt, diese Rolle sei die größte Ehre ihres Lebens für sie, die nun den Kampf ums Überleben der Natur der Finnmark und ihres Volkes am Reppar-Fjord fortsetzt.

Ella Marie Hætta Isaksen, Hauptdarstellerin in Ellos eatnu, La elva leve, Lasst den Fluss leben, und dessen Regisseur Ole Giæver bei der Eröffnungszeremonie des 33. TIFF
Ella Isaksen bleibt dran an diesen komplexen und komplizierten Herausforderungen, hat sie sich doch schon in der Grundschule in Deanussaldi (norwegisch Tana), einer Ortschaft mit knapp mehr als 700 Einwohner*innen in Nordostnorwegen, an der Grenze zu Finnland – vehement dafür eingesetzt, dass alle Sámi Sámi sprechen, genauer genommen Nordsamisch. Diese Sprache ist in der zu nahezu 80 Prozent von Sámi bewohnten Provinz Deatnu (norwegisch Tana) dem Norwegischen gleichgestellt. Die Region, ist ein wichtiges Weidegebiet für Rentiere, dort werden Inlandsfischerei und Jagd betrieben, dort stellt der Rásttigáisá mit gut 1000 Metern die höchste Erhebung dar – und einen heiligen Berg. Ausgerechnet dort soll nun die ausgedehnte Windkraftanlage Davvi errichtet werden. Ein weiterer Eingriff sowohl in die Rechte des indigenen Volkes als auch in bisher von menschlichen Eingriffen verschonte Gebieten in der Arktis. Sámi-Aktivist*innen sind durch den geplanten Windpark beim wichtigsten heiligen Berg ihres Volkes alarmiert.

Umstrittene Windräder in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
Isaksens sehr lesenswertes Buch „Derfor ma du vite at jeg er same“ – es ist noch nicht übersetzt, der Titel bedeutet: Deshalb musst du wissen, dass ich Sámi bin – ist 2021 erschienen. Da war sie 23, Umwelt-Aktivistin und Frontfrau ihrer Band ISÁK. Isak heißt ihr Großvater. Den habe sie hinter sich gefühlt, schreibt die junge Multi-Künstlerin, ebenso wie ihre Großmutter und viele Generationen von Vorfahren, beim Stjernekamp 2018, dem Sänger*innen-Wettbewerb des NRK (Norsk rikskringkastning, in etwa „Norwegischer Reichsrundfunk“). Isaksen fühlt sich von einer ihr bis dahin unbekannten Kraft durchdrungen. „Sie joikten mit mir“.
Joiken, das Wort stammt vom samischen Verb „juoigat“ ab, ist mit dem Jodeln verwandt. Die rau klingende Stimmtechnik wird auch throatsinging, Kehlgesang, genannt. Der traditionelle Gesang der Sámi geht auf die Steinzeit zurück und stellt eine der ältesten Vokaltraditionen Europas dar. Gesungener Text wechselt sich ab mit bedeutungslosen Silben, die Töne sind dabei oft wichtiger als die Worte, stellen eine Möglichkeit dar, sich dem Besungenen zu nähern, während die oder der Joikende sich der Landschaft, der Natur, der Umgebung anpasst. Der Joik existiere einfach, so beschreiben es die samischen Sänger*innen. Zwar sei ihr Joik für die Ortschaft Mazé (norwegisch Masi), ein fast ausschließlichen von Sámi bewohntes Dorf am Fluss Altaelva, das 1987 mit dem Bau des Staudamms dort überflutet wurde, für viele eine Art Katalysator für unerlöste Gefühle, Aufruhr und Mut geworden, schreibt Isaksen, aber sie fühle aufrichtig, dass sie nichts damit zu tun habe, keinerlei Verehrung oder Bewunderung verdiene. Der Joik entstehe ohne ihr Zutun. Sie stelle sich nur zur Verfügung, der Joik finde sie, sei aber nicht zu erzwingen. Das unterscheide ihn auch vom Gesang. Der Gesang sei Musik, der Joik sei viel mehr, eine eigene Sprache, „mit einer zentralen Rolle – und vielen unterschiedlichen Funktionen – in der samischen Gesellschaft. Joiken ist auch ein wesentlicher Bestandteil der ursprünglichen Religion der Sámi. Die Noaidi, die männlichen Schamanen dieser Tradition und die Frauen mit übersinnlicher Verbindung guap, kweppckas, gåbeskied oder framåt genannt, riefen als Mittler*innen, Heiler*innen, spirituelle und rituelle Spezialist*innen, Seelsorger*innen mit ihrem Joik Geister und Götter und baten sie um Hilfe. Auch bei privaten Zusammenkünften und Festen wurde gejoikt. Aber auf der Bühne wäre luohti (das ist das nordsamische Hauptwort zum Verb juoigat) ursprünglich nie vorgetragen worden. Und als Popsängerin fühle sie, „dass die westliche Popskala die ganze Zeit drohe, die traditionellen Joik-Töne zu überwinden. Ja, genau so wie die norwegische und die nordsamische Sprache um den Platz in meinem Hirn kämpfen.“ Als „Szene-Joikerin“ trage sie dazu bei, das Joiken einem großen Publikum zugänglich zu machen, aber auch dazu, es aus seinem „natürlichen Habitat“ zu entführen. „Heute verschwindet die alltägliche Joik-Kultur mehr und mehr, und darum machen sich viele große Sorgen, fragten sich, was mit der samischen Gesellschaft geschehen würde, wenn sie ganz verschwinde. „Wie bei der Klimaveränderung, rechnen wir immer mit dem schlimmsten Wetterextrem. Wir spielen mit der Kraft der Erde und setzen Kettenreaktionen in Gang, von denen wir noch nicht einmal die Konturen erahnen. Geben wir den Joik auf, fürchte ich, dass wir einen ganz zentralen Tragbalken in unserer Kultur verlieren. Er trägt mehr als wir ahnen. Weil wir ohne Joik den Klebstoff verlieren, der in tausenden von Jahren Beziehungen gepflegt und Familien zusammengehalten hat. Wir können nicht länger Porträts der Vergangenheit malen, um für die Zukunft zu lernen.“
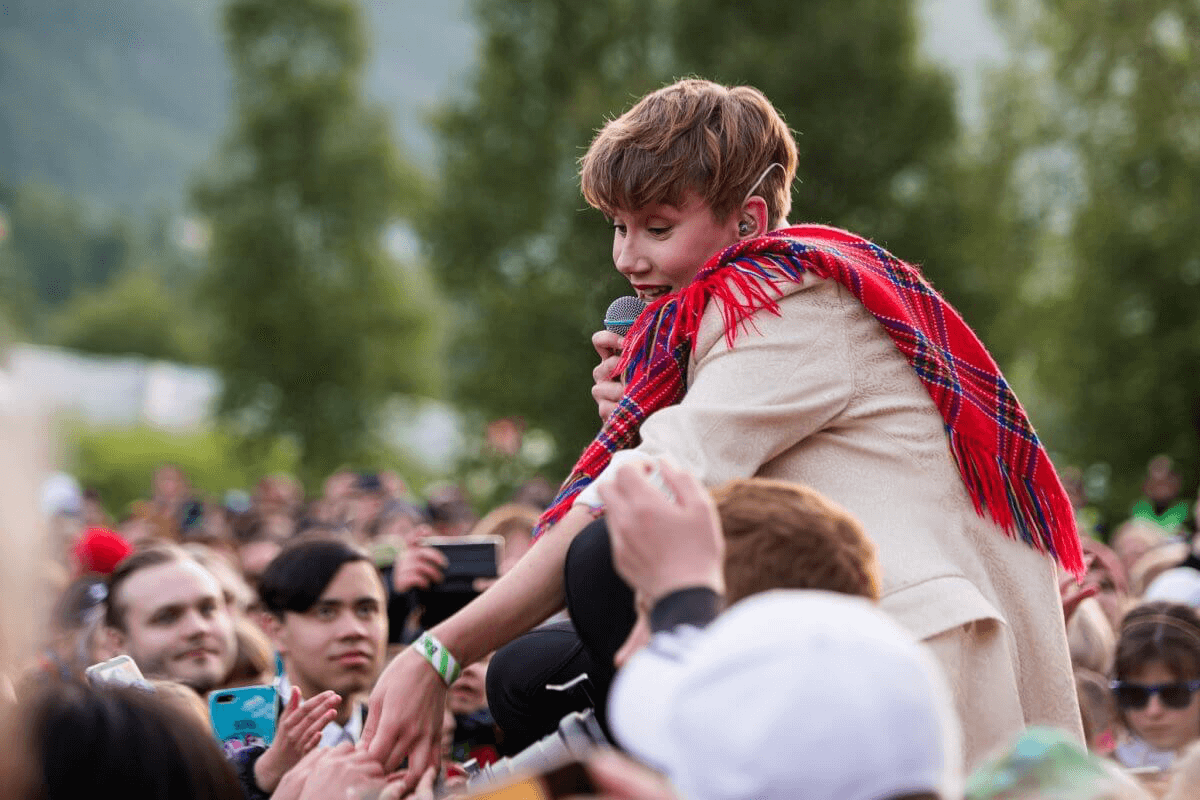
ISÁK at Riddu Riđđu 2019, ISÁK ist die Band von Ella Isaksen, Riddu Riđđu ein jährlich stattfindendes Urvolk-Festival, Andreas Kalvig Anderson
Bei den Arctic Winter Games der Bewohner*innen des zirkumpolaren Nordens, eine der weltgrößten Urvolk-Veranstaltungen, wie Isaksen schreibt, hat sie 2014 zum ersten Mal „ihren Großvater Isak gejoikt“. Ein persönlicher Joik ist in etwa ein musikalisches Porträt ohne Worte. Und der 16-jährigen Musikerin war daran gelegen, dass ihre Urvolkschwestern und -brüder ein „kleines Bild vom Leben bekommen, das er gelebt hat.“ Ihre Band, die sie mit Produzent Daniel Eriksen und Schlagzeuger Aleksander Kostopoulos, 2017 gründet, nennt sie ISÁK, nach dem Vornamen des Großvaters und dem Nachnamen ihres Vaters.
Zuvor gewinnt sie 2016 den Sámi Grand Prix in Guovdageaidnu (Kautokeino). Was sie dafür gemacht habe, habe ein Mann sie gefragt, berichtet Isaksen. „Hast du Lasso geworfen?“ Nein, sie wirft die Provokationen beiseite und joikt. So siegt sie auch 2018 im Stjernekamp, einer norwegischen Musik-Sendung. Der Sänger*innen-Wettstreit läuft im NRK, norsk rikskringkasting, das war mal der „Reichsrundfunk“, ist heute öffentlich-rechtliches Fernsehen und das größte Medienunternehmen des Landes. „Die Reaktion, die ich bekam, nachdem ich Máze gejoikt habe, angezogen mit meinem geliebten gákti (der samischen Tracht) und mit einer höheren Zuschauerzahl, als Menschen in Nord-Norwegen wohnen, war auf jede Weise überwältigend“, schreibt die Künstlerin. Ihr Gewinner-Joik gilt einem Dorf in der Kommune Guovdageaiduu (Kautokeino) in der Provinz Troms og Finnmark in Norwegen. Es heißt auf nordsamisch Máze, auf norwegisch Masi, liegt am Ufer des Altaelva, wird fast vollständig von Sámi bewohnt und sollte mit dem Bau des Alta-Staudammes geflutet werden. Der Text des Joiks handle von den großen Demonstrationen während des Alta-Konfliktes um 1980, schreibt Isaksen, von „rasender Wut und den Ohnmachtsgefühlen, die aufkamen, als das Dorf unter Wasser gesetzt werden sollte.“ Und er sei eine Art Katalysator geworden für unerlöste Gefühle von Zorn, Aufruhr und Mut. So wirkt auch der Film „Ellos eatnu – La elva leve – Let The River Flow“, in dem Isaksen die Hauptrolle spielt. Mir kam schon beim kurzen Trailer, den wir bei der Eröffnungs-Konferenz sahen, das Schluchzen – und ich war froh über meinen Sofaplatz an der unbeleuchteten Rückwand des Saales. Sie ihre gesamte Seele, „every part of my soul“ hineingelegt. „Learn from ist with open hearts and open mind!“ Sie ruft uns auf, mit offenem Geist und offenem Herzen daraus zu lernen. Der Regisseur Ole Giaever betont, es sei ihm um die samische Perspektive im Alta-Konflikt gegangen. In 40 Jahren habe niemand diese Geschichte so erzählt, wie sie erzählt werden muss.

Mari Boine und Band im utekino (Winterkino des 33. TIFF)
Mari Boine erhebt bei dieser Eröffnungszeremonie einmal mehr ihre Trommel für die Sache ihres Volkes, ruft uns auf, die Stimmen der Vormütter zu hören, die uns fragen, warum die Erde vergiftet und verbraucht ist, uns daran erinnern, woher wir gekommen sind, und daran, dass die Erde unsere Mutter ist. „Wenn wir ihr das Leben nehmen, werden wir sterben“, heißt es in ihrem Lied „Gula Gula“. An diesem Abend übersetzt die samische Jazz-, Folk-, Rock-Sängerin Bob Dylans Working Class Heroe in ihre Muttersprache und dankt ihren Brüdern und Schwestern für den ausdauernden Widerstand.
Gleich um die Ecke vom Winter Cinema gerate ich zu meinem Glück ins Kaia. „Vi serverer lunsjretter, middager og desserter hver dag“, lautet das Angebot. Und ist erklärungsbedürftig: von hinten: hver dag heißt täglich, desserter sind klar, aber middag ist für die Norweger*innen das Abendessen, während das Mittagessen lunsj heißt; gut zu wissen bei Verabredungen. Eine Studentin aus Lettland, die auch beim TIFF volontiert, fragt mich, ob ich eine der Filmmacherinnen sei. Es zieren tatsächlich enorm viele Frauen das umfangreiche Programm und wir entwerfen ein paar Tage später den Slogan „Mostly women – mostly young – mostly fantastic“ – sei. Dabei bin ich ja nur eine Filmeguckerin, das aber seit fünfzig Jahren, insofern habe ich Erfahrung vorzuweisen. Jetzt brauche ich dringend anderen Input. Entscheide mich gegen Hvalbiff (Walfleisch) und Reinskav (Finnebiff) für ein Gericht mit viel Pommes frites und gucke dann stundenlang aus dem Fenster über die städtische Landungsbrücke hinweg zwischen den Masten riesiger und robuster Yachten hindurch über den Tromsøysund zu den steilen Bergen am Festland.
tanze Dienstag, den 17. – 23:00 – Hålogaland Teater – Tromsøysundet –
viele Stunden zuvor bewundere ich vormittags ein Stück blauen Himmel und eine orange aufleuchtende Wolke und hole ich mir Isbrodder, Spikes für die Stiefel. Es hat getaut, das macht die Sache auf Tromsøs von Mensch und Natur ganz unterschiedlich gestalteten Bürgersteigen eher schlimmer. Gehöre jetzt zu denen, die ihre Hacke mit den kleinen Nägeln fest einschlagen und in den jeweiligen Etablissements die Isbrodder ablegen, um nicht das Parkett zu ruinieren. Im Aurora Kino Fokus an der Hauptstraße (Storgata) – das 1973 eröffnete Kino war mit mehr als 700 Sitzplätzen damals eins der größten im Lande – wird an diesem zweiten TIFF-Tag Den siste våren (übersetzt: Der letzte Frühling, aber Franciska Eliassen setzt für den internationalen Auftritt auf den Titel Sister, What Grows Where Land Is Sick) gezeigt. Im Grunde ist dieser Film, das Debut der jungen Filmemacherin, die ihr Handwerk und mehr in der Nordland School of Arts and Film auf den Lofoten gelernt hat, der Grund, warum ich überhaupt soweit gekommen bin – bis zum Polarkreis. Hatte ihn ja im November bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck gesehen, woraus sich stundenlange universale Gespräche und ein Besuch in Hamburg ergeben hatten. Wir zwei konnten einfach nicht aufhören, einander schwierige Fragen zu stellen. Und ganz knapp, bevor Franciska in Hamburg in die Bahn stieg (auch sie benutzt kein Flugzeug, das ist aber nur eine von diversen Generationen-überbrückenden Gemeinsamkeiten), habe ich ihr die Q & R-Standardfrage nach ihren nächsten Plänen gestellt. Da fiel mir Tromsø vor die Füße. Gute Idee! Die Geschichte erzählt nicht genug über die Wirkung ihres Spielfilms, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auch unsichtbaren und übersinnlichen spielt. Erzähle sie trotzdem: In einer kleinen Stadt in Nordnorwegen, wohin die kleine Familie gezogen ist, weil die Mutter die städtische Umwelt nicht mehr erträgt, tasten sich meine Namensvetterin Vera, ein rebellischer, sehr sensibler und begabter Teenie, und ihre jüngere Schwester, völlig auf sich gestellt, hintereinander durchs Leben. Eira folgt Vera, versucht ihr auf die Spur zu kommen, liest deren Tagebücher, gerät in deren mystische, verzweifelte, futuristische Bild- und Wortwelten – sie haben etwas von Dada, von Surrealismus, von Hippieträumen, von Science Fiction. Veras intensive Reaktion auf die allgegenwärtige Umweltzerstörung, ihre selbstzerstörerische Rage führen dazu, dass sie in eine Klinik gebracht wird. Eira hat nun eine Art hindernisreichen Heldinnenweg hinter sich und richtet sich auf, um in Eigenständigkeit vorwärts zu gehen.

Franciska Eliassen beim Q & R (Frage und Antwort) zu ihrem Film Den siste våren /Sister what grows, when Land is sick? beim TIFF 2023
In Lübeck, bei den 64. Nordischen Filmtagen im November 2022, machte ich, sehr bewegt von diesem im wahrsten Sinne fantastischen Film, der mich zu Tränen rührte – mich packt und schüttelt oft das Mitgefühl für diese Generation, aber auch die Tatkraft und Hoffnung der Jungen – Franciska erstmal ein Kompliment in eingerostetem Norwegisch und frage sie nach den Hexen, nach deren Botschaften ihre Filmheldinnen suchen – auf norwegisch spricht die ältere Schwester von den Formoedre, den Vormüttern, deren Sprache sie gerne verstehen würde. Ja, es geht auch ihr um die Anbindung ans alte Wissen. Nach der Vorführung bei den nordischen Filmtagen erfährt das Publikum auch, wie die junge Macherin, die neben Kunst/Film auch Philosophie studiert, aus einem 7-Tage-Dreh einen solchen Film macht: Eine müsse der Magie Raum geben. So sei es auch geschehen, dass sie ein Lied einer russischen Musikerin gehört, und sich spontan für diesen Film ausgesucht habe. Nun war sie scheu, die bekannte Akkordeonspielerin anzusprechen, tat es dennoch und erfuhr, dass diese gar nicht weit entfernt vom Drehort wohnt, bekam den herzzerreißenden Song, der tatsächlich von Schwestern handelt (was wiederum Franciska, die kein Russisch versteht, gar nicht wusste) und einen Zauberhaften Auftritt der Russin in einem norwegischen Birkenwäldchen, bei einer Performance, die zart andeutet, wie fröhlich und fesselnd ein Eintauchen in die Natur wirken könnte, uns vielleicht verwandeln. Als potenzielles Lieblingshaustier gibt Franciska in Lübeck einen Drachen an und heißt uns herzlich willkommen, die Grenzen zwischen Realität und Imagination, Vergangenheit und Gegenwart, Mensch und Natur zu überschreiten, wie es die Hagazussen, die Zaunreiterinnen, die machtvollen Vorgängerinnen in alten Zeiten professionell taten.

In Tromsø entdecke ich die fortschreitende Einweihung der kleinen Schwester in Achtsamkeit und Aufstand. Das hatte Franciska so nicht geplant, aber es gefällt ihr. Zumal sie auch die Idee teilt, dass wir vielleicht manchmal gerade denen folgen sollten, die in unserer Gesellschaft in die Schublade „psychisch krank“ gesteckt werden, wie es auch mit ihrer eigenen, älteren Schwester geschah, die nun die sensationellen Kostüme für den Film entwickelt und geschneidert hat. Im Aurora Fokus 2, dem sogenannten Bonordsalen, gibt es in der ersten Reihe dick gepolsterte Liegesessel, und so liegen wir ihr zu Füßen, wie sie da oben steht, so schmal, in ihrem dünnen armfreien roten Hosenkleid mit den dicken, arktistauglichen Stiefeln. Die Männer fragen nach dem Femininen, einer stößt sich gar an der fiktiven Hexendarstellung als Performance im Birkenwald. Ja, nachdem dem eigenhändigen Bau und einer earth cabin (eine mit Erde bedeckte Hütte) auf den Lofoten und einem zeitweisen Eremitinnendasein dort, habe es sie innerlich auf ihre weibliche Seite gezogen. Ihre Hauptdarstellerinnen sind ebenfalls weitgehend autark. Weder durch Familie, noch durch Boyfriends oder Gesellschaft definiert, steht und geht dieses heterogene Schwestern-Duo zusammen. Soviel zum Feminismus.

Carolina Cavalli ist aus Italien zum 33. TIFF angereist, weitaus fester bekleidet als auf dem Foto. Ihren Film Amanda habe ich nicht gesehen und empfehle ihn trotzdem.
Die nächste junge Macherin treffe ich im Foyer. Carolina Cavalli sitzt da ganz allein, gerade aus Milano angereist, ein wenig aufgeregt. Ihr Film läuft gerade, unter uns im Fokus 2. Um dessen Aufnahme beim Publikum muss sie sich sicher keine Sorgen machen – später höre ich begeisterte „Kritiken“ im Kino-Café – nicht machen, Cavallis Debut „Amanda“ wurde für die Sektion Horisonter gewählt, denn diese Horizonte bieten Einblick in die derzeitige Festival-Welt und das einzige Kriterium für die Auswahl sei Qualität, so steht es im wunderschönen TIFF-Katalog. Und Cavalli liefere mit „Amanda“ einen der frischesten Debutfilme seit langem. Der skurrile Humor und die bizarren Bildkompositionen würden an ihren Landsmann Paolo Sorrentino erinnern. Da ich mich ja auf die Film fra Nord fokussiere und zwischendurch immer mal wieder Blicke auf Meerengen und Hochgebirge werfen muss, lese ich die Story im Programm nach: Die 20-jährige Amanda, Non-Konformistin und chronische Cineastin, stammt aus einer reichen und dysfunktionalen Familie und verdirbt es sich mit ihrer exzentrischen Art mit den vielen Freund*innen. Als Leidensgenossin von Cavalli (?), auf jeden Fall ihrer Heldin, hoffe ich jetzt, dass Amandas Reise aus der Einsamkeit in die deutschen Kinos kommt.
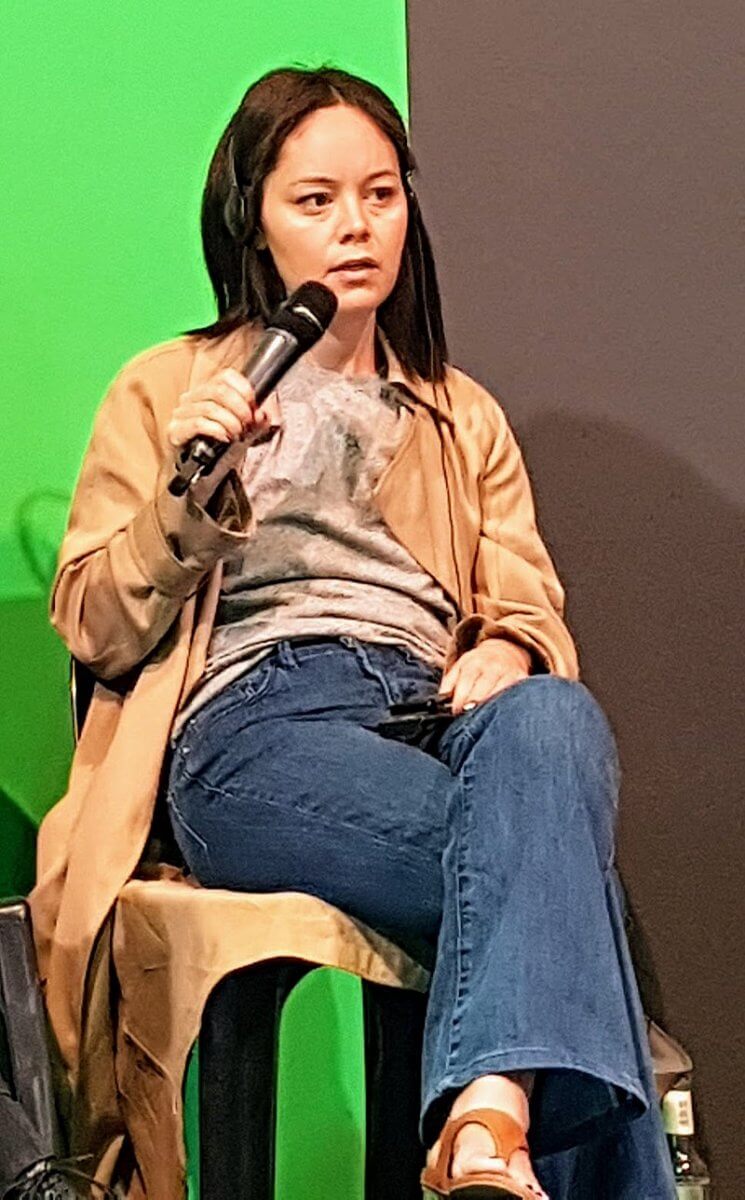
Nyla Innuksuk during re:publica 2018, Berlin, Panel VR:RV Stories We tell
Nächster Programmpunkt in meiner nordischen Sektion ist „Slash/Back“. Eine echte Herausforderung für eine mit ausgeprägtem Horror-Film-Horror. Gehe das Wagnis ein, weil ich nicht nur die (Bild-)Sprache der Ahninnen, sondern auch der derzeit anwesenden weiblichen Wesen begreifen möchte. Und im Nachhinein gebe ich ehrlich zu, dass die Mädchengang von Pangnirtung einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen und Nyla Innuksuk, die das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und Slash/Back produziert hat in die Reihe meiner TIFF-Superheldinnen einreiht (eine von ihnen, von der später noch die zu schreiben ist, besteht auf meine spontan rausgehauene Headline: Mostly Women – Mostly Young – Mostly Fantastic! There you are:) Innuksuk kommt in einem Dörfchen namens Iglulik (Igloolik, das bedeutet: es gibt dort ein Haus, bewohnt ist diese artische Ecke schon seit mindestens 4000 Jahren) zur Welt, in Nunavut, einem Territorium im Norden Kanadas mit besonderen Rechten für die dort lebenden Inuit.
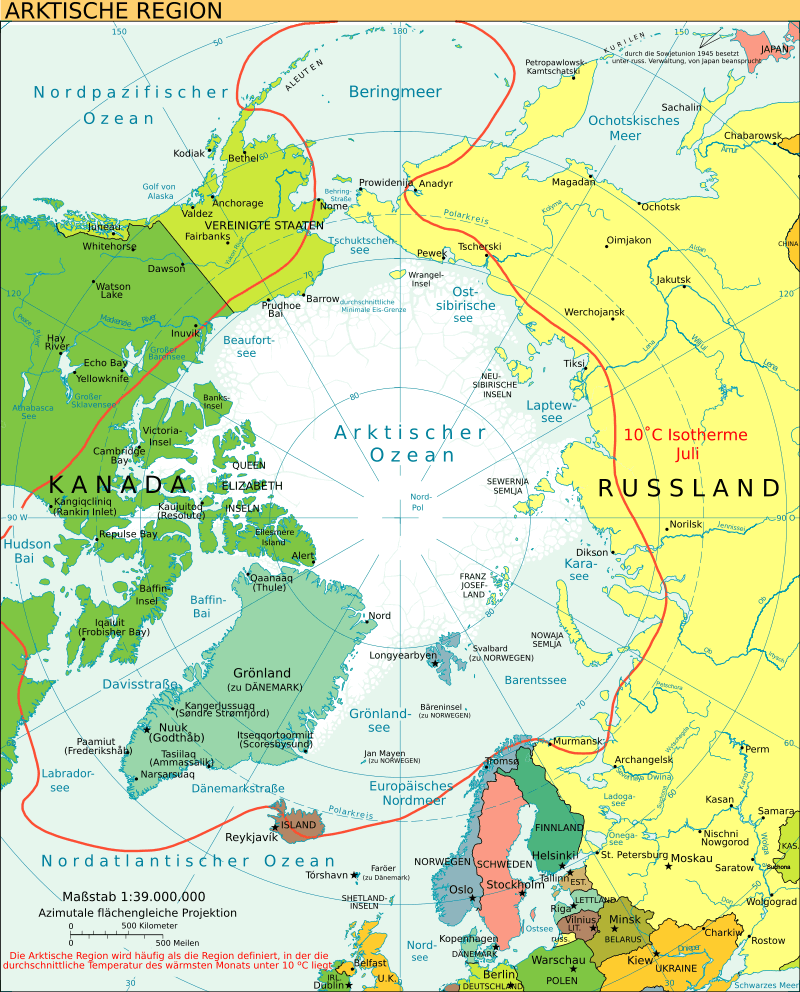
Nächtliches Nunavut oder Märchenhafte Mädchengang
Nunavut sei ein wundervoller Platz, um aufzuwachsen, die Kinder würden größtmögliche Freiheit genießen, und jeder würde sich jederzeit um sie kümmern. Bis auf diese Mittsommernacht, in der ihr Film – wie sie sagt, eine Mischung aus „Coming of age, action, adventure, sci-fi“ (body horror & lo-fi monster effects erwähnt Innuksuk nicht, aber ich: „Körperhorror“ ist ein Genre, in dem radikale, destruktive Veränderungen des menschlichen Körpers im Vordergrund stehen (für die Älteren z.B. Frankensteins Monster, für die Jüngeren z.B. Crimes of the Future übers beschleunigte Evolutions-Syndrom); lo-fi steht für low fidelity und ich gucke mir jetzt nicht bei You Tube an, wie eine ungenaue Monster filmreif macht…:)) – spielt. Und zwar in Pangniqtuuq (Panguirtung), übersetzt aus der Sprache der Inuit am „Platz des Karibubullen“. Und der fordert jetzt erstmal die Biologin in mir heraus. Rangifer tarandus groenlandicus, auch Barrenground-Karibu (die Barren Grounds – übersetzt karges Land – sind eine riesige nahezu unbewohnte und von unzähligen Seen gesprenkelte Tundra in Nunavut, in der sich auch Innusuks Mädchengang gerne rumtreibt) genannt, lebt in Kanada und Grönland. Das bunte zwischendurch zickige Mädchenteam, dessen Eltern sich für mindestens 24 Stunden in Sachen Mittsommerbesäufnis verabschiedet haben, begegnet in dieser karg genannten, blühenden Kältesteppe und zwischen den teils bunten, teils verfallenen Hütten von Pangniqtuuq Kreaturen jenseits von Karibu und Eisbär und bündelt alle Kompetenzen: Schwesterlichkeit, Mut, Horror-Film-Know-how, Charme und Jagdtraditionen der Inuit. Und besiegt die blutrünstigen Aliens. Die Laiendarstellerinnen sind es gewohnt, für Touristen Inuit-Kultur zu präsentieren, und sie bringen zugleich die Folgen jahrhundertelanger Kolonialisation, ständiger sozialer Herausforderungen unterschiedlichster Art und die eingefleischte Scham ihrer Indigenen-Identität rüber. Mich berührt der unbedingte Mut und Zusammenhalt über alle Streitigkeiten hinweg.

Nyla Innuksuks Film Slash/Back mischt Coming of age, action, adventure, sci-fi, body horror & lo-fi monster und wird mir beim 33. TIFF wider alle Erwartungen zum Highlight.
Und ich bin neugierig auf die Macherin. Sie sagt, sie sei „eine Produzentin von Film und Virtual Reality Content“ und habe ihre Firma Mixtape VR „mit nur einemRucksack voller Headsets“ gegründet, und einer nachhaltigen Leidenschaft für Technologie, für Genre Storytelling, für interaktive Graphic Novels. „Nebenbei“ entwickelt sie für den New Yorker Verlag Marvel Comics, bei dem Spider-Man und Ghost Rider erschienen sind, eine/n indigene/n Superheld*in. Bei der digitalen Jagd stöbere ich Wendy Jewells Projekt MY HERO auf. Jewell schreibt über ihre Heldin Innusuk, sie habe in ihrem jungen Leben viel durchgemacht und sei „auf der anderen Seite herausgekommen, immer noch lächelnd, immer noch inspirierend, immer noch „creating“, schaffend. Wie kommt´s? Ihre Mutter, „always thinking bigger“ – immer weiter und größer denkend – sei ihr ein Vorbild, und „wir hatten immer Künstler im Haus und im Norden bist du immer von Geschichten umgeben.“ Und den noch Jüngeren ruft sie zu: „Just try making stuff!“ Wie soll eine das nun sachdienlich übersetzen? Mach dich ran an deine Sachen? Hau rein? Ihr werdet es schon verstehen. Sonst einfach mal Slash/Back angucken. Oder sich in die FUTURE NORTH Talentshow der Nordischen Filmtage in Lübeck reinsteigern, die im November 2023 vom Stapel gelaufen ist.
Arktische Student*innen-Organisation oder Zunehmendes Ortsverständnis
Derartig mit weiblicher Power aufgeladen, mit Isbroddern unter den Sohlen und mit zunehmendem „Ortsverständnis“, wie Clara es nennt – sie studiert in Deutschland, ist Volontärin im TIFF-Staff und wir unternehmen die eine oder andere Tromsø-Tour zusammen – mache ich mich auf gen Südende meiner Lieblingsinsel, dorthin, wo die Hauptstraße in den Strandvegen übergeht, der an der Ostküste der Insel Richtung Sydspissen führt. Die Altersgrenze im Caféen BAR, wo ich jetzt hineingerate, liegt bei 18, da mache ich mir keine Sorgen, und durchschlage scheinbar auch die obere Grenze nicht. Werde total herzlich aufgenommen im studenthuset DRIV, das Norges arktiske studentsamskipnad gehört.

Auftritt der norwegischen Band Tinnitus im studenthuset DRIV, Mick Neupart
Und mir wird schlagartig klar, dass ich genau zu so einer Tromsøer Student*innengemeinschaft gehört hätte, hätte mir damals der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst – die weltweit größte und wahrscheinlich auch reichste Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern – das beantragte Stipendium für die UiT = Universitetet i Tromsø bewilligt. So wäre ich in die 1972 eröffnete Uni, die auch Noregs arktiske Universitet heißt. Noreg ist das neunorwegische Wort fürs Land und Nynorsk (Neunorwegisch), Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt als „Dachsprache“ für die vielen Dialekte – um es anschaulicher zu machen: die Norweger*innen lebten einst in durch hohe Berge voneinander getrennten Tälern, die jeweils ihre eigenen Strickmuster und Slangs hatten/haben – lerne ich neben Bokmal (wörtlich „Buchsprache“, sie geht eher auf die dänische, literarische Tradition zurück, von der sich manche im 19. Jahrhundert, als die Dänen Norwegen an die Schweden abtreten und die Norweger das kleine Zeitfenster vor der nun folgenden gut 90-jährigen Fusion mit Schweden prompt für eine Nationalversammlung nutzen ) an der Hamburger Uni. Fange damit sofort in meinem ersten Biologie-Semester an, weil ich nämlich meine allerletzten Schulferien bei Brønnøysund verbracht hatte.
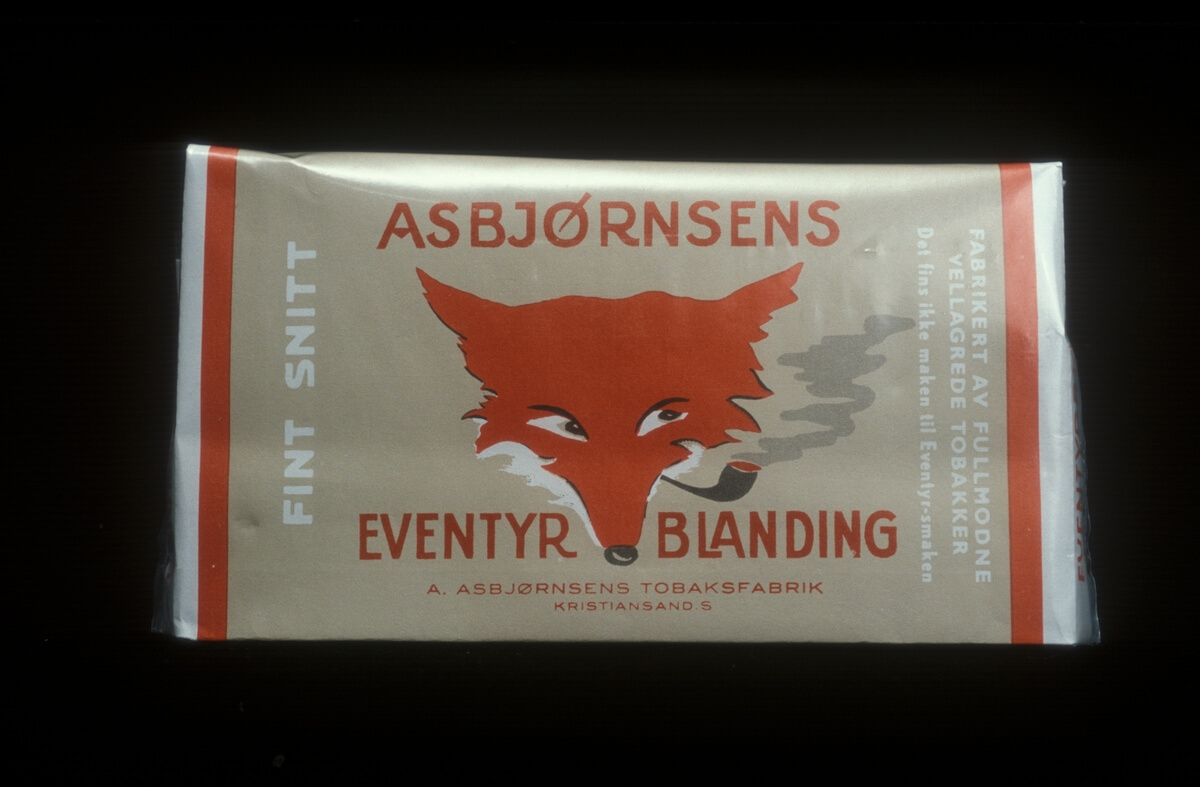
Meinen damaligen Lieblingstabak gibt es jetzt auch in Norwegens digitalem Museum, eventyr bedeutet Abenteuer oder Märchen, und beim rauchenden Raubtier könnte es sich auch um einen Polar-, Schnee- oder Eisfuchs (Vulpes lagopus) handeln, im Sommerkleid.
Unter anderem mit dem Pflücken von Myltebeeren, dem Angeln von Meerforellen, dem Dösen in der Mitternachtssonne und dem Versuch, ein Schneehuhn zu jagen, von diesen Vögeln nahm ich an, sie seien auch zu Mittsommer weiß. Auf einer Insel mit einer Hütte in der Meerenge Brønnøysundet, auf der Skandinavienkarte eine Handbreit unterm Polarkreis. Mehr Infos hatten wir nicht – konnten uns ja auch nicht durch hunderte von bunten Bildchen klicken vor 50 Jahren – , als wir, nachdem der einzige Norwegisch-Sprechende in unserer Vierergang die Hüttenmiete telefonisch mit einem dortigen Fischer und Landwirt klar gemacht hatte (teuer kann es nicht gewesen sein bei unserem damaligen DM-Beutel) -, uns mit dem Gebrauchtwagen in die norwegische Küstenprovinz Nordland – die Reisende nicht mit dem schwedischen Norrland verwechseln sollen, das irgendwo oben oder unten erklärt wird – aufgemacht. Küsten über Küsten.

Meerforelle, Salmo trutta trutta
Die Kleinstadt Brønnøysund ist weitgehend vom Meer umgeben, vom Vegafjorden mit dem 6500 Inseln zählenden gleichnamigen Archipel, das die UNESCO 2004 zum Weltnaturdenkmal ernannt hat und von „unserem“ Sund. Unser schweigsamer Vermieter, was mich als Kippendreh-Anfängerin – in Norwegen rauche ich aus Prinzip nur Asbjørnsens Eventyrblanding (wegen des Fuchses und weil Eventyr für Märchen und gutes Erlebnis steht) – nachhaltig beeindruckt, rollt sich die Zigarette mit einer Hand in der Hosentasche. Und dann rudert er uns rüber, zeigt uns das Gewehr, das Boot und die Angelausrüstung, die nur aus einer auf ein Holz gewickelter Schnur mit vielen Haken besteht, und lässt uns für die nächsten Tag und Nacht hellen Sommerwochen allein.

„Brønnøysund, her sett fra Mofjellet, strekker seg ut som en halvøy omkranset av øyer, holmer og skjær“, so lautet die Bildunterschrift in wikipedia.no: Brønnøysund, hier gesehen vom Berg Mofjellet, streckt sich aus als von Inseln und Schären umkränzte Halbinsel.
Auf Latein heißt sie Rubus chamæmorus L., auf Deutsch Moltebeere. In Norwegen heißen sie multe oder viddas gull – das Gold der Vidda (Hochebene) – und werden dort als die vorzüglichsten aller Beeren verehrt. In Nord-Norwegen dauert die Multejagd von Anfang Juli bis Ende August. Reife Moltebeeren glänzen in unterschiedlichsten Orangetönen. Und sie sind echte Commons, denn das norwegische allemannsretten erlaubt allen, Beeren zu pflücken und vor Ort zu verzehren. So schmecken sie auch am allerallerköstlichsten. Echtes eventur! Zumal die Delikatesse mit dem Geschmack von Apfelmus, Aprikose und noch allerhand eine reine Wildfrucht darstellt. Schon in alten Zeiten schätzten die nordischen Seeleute und Inuit die Beeren als Proviant. Der hohe Gehalt an Vitamin C sorgt Skorbut vor, die Benzoesäure macht die multer haltbar. Sie wachsen nur zwischen dem 54. und dem 78. Breitengrad, häufig in Moor und Heide. All das wusste ich als Prä-Abiturientin natürlich noch nicht, aber ich glaube, das wilde Erleben auf der kleinen Insel im nordländischen Sund hat mich zur Biologie geleitet. Und wie leite ich uns jetzt wieder in den arktischen Winter, in die mørketid, die Polarnacht? Vielleicht so: Meine Brieffreund*innen vom 1967 gegründeten studentsamfunnet in Tromsø – ja, richtig gelesen, wir kommunizierten auf Papier – waren liebevoll um mich besorgt, als ich mich an ihrer UiT bewarb, die Mitte der 1970er erst ein paar Jahre alt war, aber schon die landesweit progressivste Medizinerausbildung bot und sich gerade einen Ruf als „det røde universitet“ erwarb, weil im von mir zitierten fürsorglichen Studentenverbund die „Roten“, linke Student*innen dominierten. Fürsorglich deshalb, weil sie mir eine ausführliche Anleitung für die winterliche Dunkelzeit schickten. Vor allem solle ich nicht allein bleiben, schrieben sie, sondern mich auf der Stelle bei ihnen einfinden.
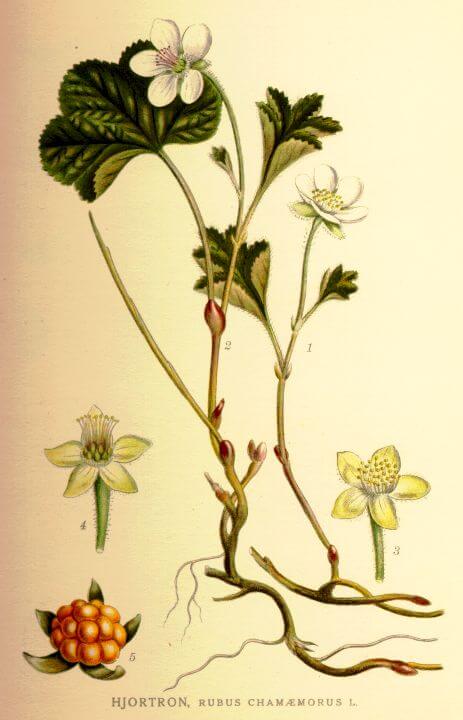
Multebeere!
Das hat ja 50 Jahre lang nicht geklappt. Und nun stehe ich in der Kneipe des studenthuset DRIV und sie schicken mich um die Ecke zur großen scene (Bühne). Das ist ihr Saal im ersten Stock. Die 200 Sitz- und 300 Stehplätze sind dort alle belegt an diesem späten Dienstagabend, beim Sing-along. Singen find ich gut, aber Adjø Montebello, angekündigt im TIFF-Programm, hatte ich nicht nachgeschlagen. Sonst wäre ich vielleicht geblieben, als ich statt gemeinsamem Singen auf der riesigen Leinwand zwei Männer in einem nordafrikanischen (?) Gefängnis prügeln. Mich beschleicht das Gefühl, mich hier musikalisch an Gewalt und Leiden zu ergötzen und ich laufe davon. Nachgelesen habe ich, dass Adjø Montebello ein Musikfilm der Regisseurin Thea Hvistendahl ist, die Fiction vermischt mit Konzertaufnahmen von Karpe. Karpe, früher Karpe Diem, sind die beiden Rapper Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid und Chirag Rashmikant Patel. Und Hvistendahl nutze, so lese ich im Programm, sowohl das Publikum, als auch die Fiction-Filmteile, um das Maximum aus dem Konzert herauszuholen. Die Zuhörer sind aufgefordert, ihren Flow zu finden und mitzusingen. Da habe ich sicher die obere Altersgrenze überschritten. Clara, die vor der Tür die Tickets kontrolliert, zeigt deutschsprachig Verständnis über die Generationen hinweg. Wir zwei wählen statt Sing-along das Hålogaland Teater.

Hålogaland Teater, ich beschließe, irgendwann mal herauszufinden, was dieser seltsame Name bedeutet. Jetzt ist irgendwann …
… und das forsknings-eventyr („Forschungserlebnis“) entführt mich an eine teilweise im Nordmeer versunkene Küste. Finde ein Bild des norwegischen Landschaftsmalers Peder Balke. Dessen Reise ins Hålogaland und weiter gen Nordkap im Jahr 1832 war von Unwettern geprägt, die er für damalige Verhältnisse in ungewöhnlich reduzierter Farbwahl darstellt. Das Nordlicht gibt er in Schwarz-Weiß wieder. Als junger Mann entzieht er sich dem Militärdienst und engagiert sich zeitlebens neben diversen Reisen und Umzügen sozialpolitische, schlägt Rentenkasse und Stipendien vor und errichtet in Christiania, so hieß Norwegens Hauptstadt seinerzeit, einen Arbeiterstadtteil.

Peder Balke unterwegs im Hålogaland
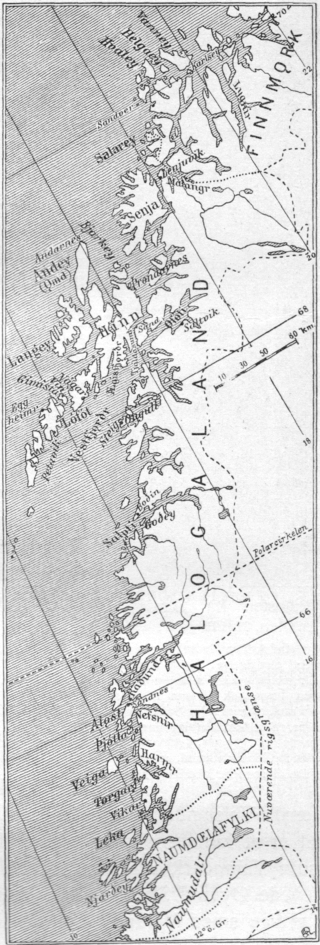
Finde auch eine Karte von Hålogaland – es umfasst laut der altnordischen Erzählungen (Saga) im Mittelalter zeitweise das gesamte Territorium nördlich vom heutigen Trondheim bis in das von Sámi besiedelte Gebiet in den heutigen Provinzen Troms und Finnmark, schließt sowohl die Lofoten als auch Tromsø ein – und die Ansage, dass diese zerklüftete Gegend mit ihren bergigen Inseln und Fjorden das exzellente Rückzugsgebiet für die Wikinger war. Vom Hålogaland aus starteten sie ihre Reise übers Weiße Meer nach Russland, wo die Zugereisten pflegten konstruktive Beziehungen und bauten gemeinsam mit den Slawen einen staat auf, der immerhin in Nord-Süd-Richtung vom heutigen St. Petersburg bis nach Belgrad und in west-östlicher Richtung von der Weichsel bis nach Nischni Nowgorod reichte. sich diese Teilgruppe der Wikinger als Waräger (варяги) einen Namen machte, der ebenfalls eine Fremdbezeichnung ist – die übrigens wie andere Elemente skandinavischer Kultur von Rechtsextremen missbraucht wurde, die Waffen-SS wollte eine ihrer Divisionen nach den nordischen Händlern und Kriegern benennen.

Unten die Fische, oben die Ruderer: Ankunft der Wikinger in England
Und in Sachen zeitgenössischer Wikinger-Verherrlichung schlage ich noch mal im Wälzer von Rudolf Pörtner nach, der beim Vater gleich nach dem Erscheinen im Regal stand – von mir damals unbeachtet, mit 17 war ich an Nordmännern nicht interessiert. Vielleicht schwang bei unserem jugendlichen Desinteresse auch das von Pörtner selbst beschriebene „Übersoll an Heldenbeschwörung, Brauchtumsverklärung und rassischem Hochmut“ der 1920er- und 1930er-Jahre mit. Um zu entlarven, was deutsche Rechtsextreme, Neu- und Alt-Nazis sich zu den Wikingern ausdenken, konsultiere ich eine, die ausreichend Abstand hat: Clare Downham, Professorin für Geschichte an der Universität Liverpool. Was heißt hier Abstand? In England begann offiziell die Wikingerzeit. An der Nordost-Küste der Insel Britannien erfolgte Ende des 8. Jahrhunderts der erste dieser berühmten Raubzüge. Den Überfall zum Zwecke der Plünderung verübten Männer, die damals noch nicht Wikinger hießen. Downham schreibt, das Wort Viking trete „erst in 1807 in die Sprache des modernen Englisch ein, in einer Zeit wachsenden Nationalismus“ im wachsenden Empire. Der mittelalterliche Begriff wird seither mit den zur sogenannten Wikingerzeit – wie in Nordeuropa die Zeit zwischen dem Ende des 8. bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts genannt wird – reisenden männlichen Skandinaviern verbunden. Es heißt, die Bezeichnung víking sei eher eine Fremdbezeichnung, und zwar die der Überfallenen. Der mittelalterliche Begriff deutet laut Downham zunächst nicht auf eine Person: „to go a-viking“ kommt vom altnordischen Wort víking (Erkundung, Piraterie, Raubzug) und bezeichne damals eine Aktivität, einen Überfall, Streifzug, Angriff zum Zweck des Beutemachens. Dazu schloss man sich zusammen. Genaues wissen wir nicht darüber, was sie zusammenhielt. Vielleicht war es der Hang zur Mobilität – und dies schließt schon mal den Großteil der skandinavischen Bevölkerung aus, die zu Hause blieb. Pörtner schreibt über die Nordmänner im Allgemeinen: „sie besaßen einen ungeheuren Aktionsradius. Ihre unverbrauchte Natur setzte viele Kräfte frei. … Sie waren von allem etwas: Bauern, Entdecker und Kolonialisatoren.“
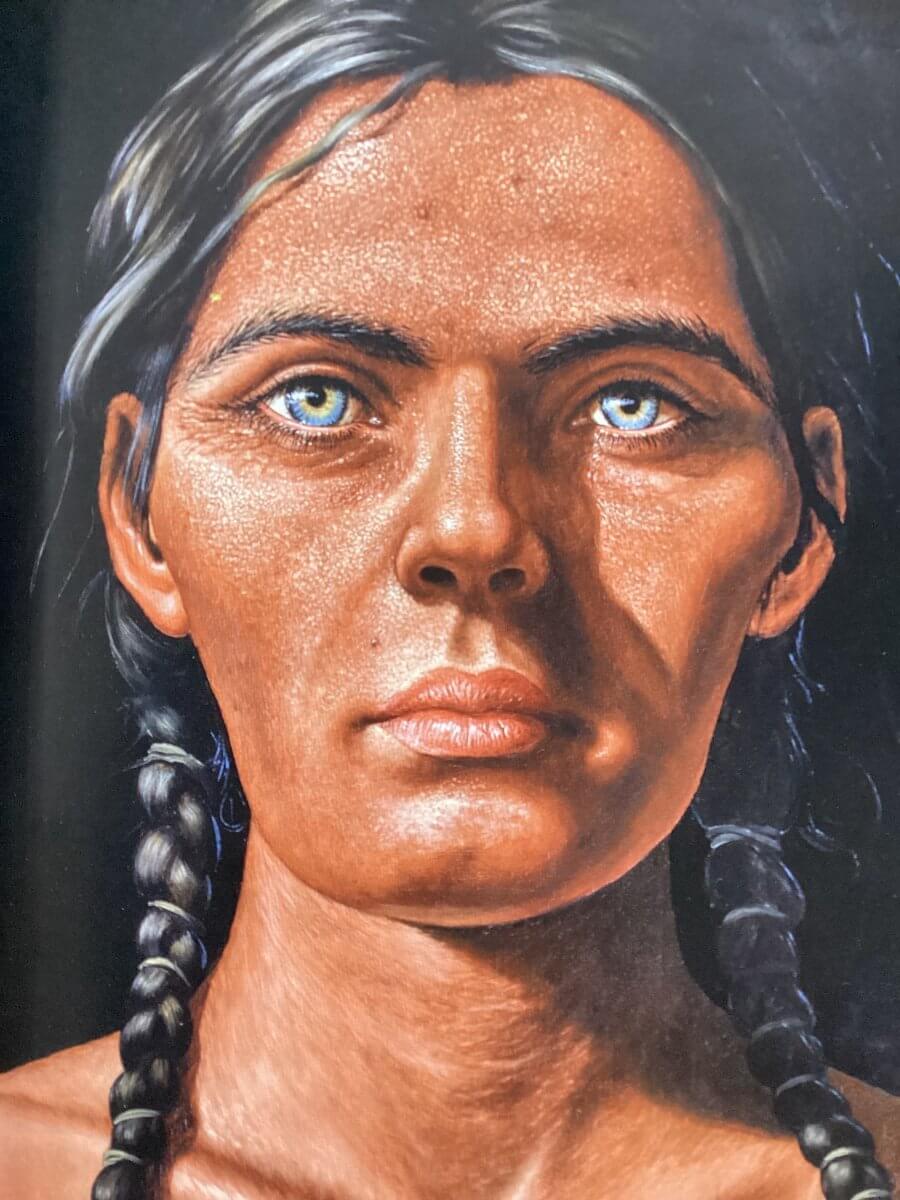
Kraftvoll durchaus, aber kein Nazi-tauglicher hellhäutiger und -haariger Kraftprotz, Rekonstruktion der rätselhaften Schamanin
Aber die sind damals nicht wirklich Nazi-tauglich – nicht unbedingt groß und blond. Ihre Handelswege würden sich von Kanada bis Afghanistan erstrecken und „die Mobilität der Wikinger führte zu einer Verschmelzung der Kulturen innerhalb ihrer Reihen“, schreibt Downham. Ein bemerkenswertes Merkmal des Erfolgs der frühen Wikinger sei ihre Fähigkeit, sich mit einer breiten Palette von Kulturen, „ob das die christlichen Iren im Westen oder die Muslime des Abbasiden-Kalifats im Osten sind“, zu vermischen. Dennoch würden während des 19. Jahrhunderts Wikinger als Prototypen und Ahnenfiguren für europäische Kolonisten gepriesen. Diese Idee wurzele in einer germanischen Herrenrasse, die wiederum von rohen wissenschaftlichen Theorien und der Nazi-Ideologie in den 1930er-Jahre genährt würde. Diese in jeder Weise rohen Theorien sind entlarvt: „Aus der genetischen Analyse geht ziemlich klar hervor, dass die Wikinger keine homogene Gruppe von Menschen sind“, sagt Eske Willerslev, Professor für Ökologie und Evolution an der Universität Kopenhagen. „Viele Wikinger sind gemischte Individuen“. Sie hätten beispielsweise Vorfahren sowohl aus Südeuropa und Skandinavien oder sogar samischen und europäischen Ursprungs. Dieses Forschungsergebnis beruht auf den genetischen Daten von mehr als 400 Menschen, deren Überreste in Gebieten ausgegraben wurden, in denen die Wikinger sich einst ausgebreitet haben, an archäologischen Stätten zwischen Grönland und Italien. Die DNA-Analyse zeigt, dass dieser bunte Haufen nicht einem Volk angehört. Auf ihren ausgedehnten Reisen vermischten sich die See- und Landfahrer mit einer Vielzahl von Völkern, eher nicht innerhalb von Skandinavien. „Wir haben sogar Menschen,die in Schottland mit wikingischen Schwertern und Ausrüstung begraben sind, genetisch aber überhaupt keinen skandinavischen Einschlag haben.“ Kosmopoliten halt. Dennoch scheine der Begriff der ethnischen Reinheit der Wikinger beliebt zu sein bei „weißen Rassisten“, schreibt die englische Historikerin Downham.
Bei der PR für den großen Blonden mit den breiten Schultern dürfte der 1912 geborene Pörtner als Journalist mitgewirkt haben, war er doch für den Völkischen Beobachter, das Parteiorgan der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), tätig und als Kriegsberichter für einen von dieser Partei kontrollierten Zeitungsdienst. Aber in Deutschland hatte ja mittlerweile – Pörtners Wikinger Saga erscheint 1971 – das organisierte Vergessen eingesetzt. So nenne ich es. Und verhöre mich auch unbewusst, als ich davon höre, dass Nazi-Verbrechern die Strafe erlassen wurde, verstehe statt Amnestie (Straferlass) zunächst Amnesie (Gedächtnisverlust). Als Tochter eines ehemaligen Angehörigen der im Nürnberger Prozess 1946 als „verbrecherische Organisation“ eingestuften sogenannten Schutzstaffel (SS) beschäftige ich mich intensiv damit, dass schon zu Beginn der 1950er-Jahre in der BRD sich Nationalsozialisten wieder in die Öffentlichkeit trauten, vor allem solche, die sich selbst als „ehemalige Elite“ sahen. Das Erinnern an die Kriegsverbrechen dieser Elite wollten sie durch eine „Generalamnestie“ ein für alle Mal beenden. Und hatten schnell Erfolg: Mit dem Straffreiheitsgesetz vom 17. Juli 1954 – da war ich schon einen Monat auf der Welt – wurden nationalsozialistischen Tätern und auch der gesamten oben genannten verbrecherischen Organisation Strafverfolgung und Strafen erlassen. So konnte mein Vater seinen falschen Namen ablegen. Aber das steht auf anderen Blättern (genauer im zweiten Band meiner Buchreihe in Arbeit, „Der karierte Koffer fährt nach Klein Baum“).
Bestseller-Autor Pörtner hat scheinbar auch einiges vergessen, er kritisiert nicht sich, nur seine ehemaligen Arbeitgeber als „Rassenapostel“. Als ich das lese, taucht in mir eine alte Frage auf. Bin schon seit meiner Grundschulzeit an Sprachen und Biologie interessiert, dazu kam im Teeniealter die Neigung zum – nach Christentum und Islam – drittgrößten Religionskomplex der Welt, dem Hinduismus, und so habe früh von dessen in Sanskrit verfassten religiösen Texten gehört, den Veden. Darin taucht das Wort arya auf, wird übersetzt als Arier und als Selbstbezeichnung einer Gruppe zentralasiatischer Menschen interpretiert. Die Sprachwissenschaftler*innen ordnen ihr eine Gruppe von Sprachen zu, die indoiranischen. Dazu gehören das im heutigen Iran gesprochene Farsi, das in Afghanistan gesprochene Dari, aber auch Kurdisch und die Sprache einer europäischen Bevölkerungsgruppe, die seit mindestens 700 Jahren hier beheimatet ist, in ihren jeweiligen Heimatländern stets eine Minderheit, in Europa allerdings insgesamt die größte ethnische Minderheit bildet, das Romani, die Sprache der Roma. Das ist ein wichtiges Detail, was wir aber kurz beiseite legen, weil wir erstmal nachschauen wollen, was die Nichtwissenschaftler*innen, die Ideolog*innen daraus gemacht haben, und uns meiner alten Frage nähern: nordisch by nature? Wieso sind für Nazis die Arier blond? Angefangen hat alles mit einem italienischen Kaufmann und Gelehrten, der sich auf Handelsreise nach Indien begab und dort begann, sich für Sanskrit zu interessieren und Gemeinsamkeiten dieser Sprache mit dem Italienischen entdeckte. Daraus entstand sprachwissenschaftlich dann das Indogermanisch. Das meinten die Forscher gar nicht völkisch, zumal die Angehörigen dieser weltgrößten Sprachfamilie – die möglicherweise einmal eine gemeinsame Ursprache hatte – in der Mehrzahl weder aus Indien noch aus dem ehemaligen Germanien stammen. Sie haben nur eine geographische Klammer gesucht, die die am weitesten voneinander entfernt lebenden „Familienangehörigen“ – wissenschaftlich Sprechergruppen – umfasst. Und so gerieten die Veden aus dem 2. Jahrtausend vor Christus mit altnordischen Sagas (die altnordischen Sprachen zählen wissenschaftlich zum Germanischen, das in Skandinavien vom Beginn der Wikingerzeit bis ins 14. Jahrhundert gesprochene Altnordisch gehört zu den germanischen Dialekten) in ein Regal. Und mittendrin stehen Zeugnisse aus Zentralasien, verfasst in den der Sprechergruppe der Arier zugeordneten Sprachen.
Um das alles in Richtung „nordische Rasse“ zu verrücken, mussten die Ideologen anrücken. Sie hegten und pflegten andere Annahmen als die meisten Sprachwissenschaftler*innen und Archäolog*innen und verlegten die sprachliche Urheimat aus den Steppen nach Skandinavien und umzu. Und sie verbreiteten erfolgreich die kaum wissenschaftlich gestützte Annahme, Menschen nordischen Aussehens seien die reinste Ausprägung der Arier. Nun war der Weg nicht weit zu den verherrlichten Nordiden. Aber halt! Bevor wir ins Völkisch-Rassistische geraten, habe ich als Biologin einen dramatisch wichtigen Einwurf: Molekulargenetische Untersuchungen haben die Einteilung der Art Homo sapiens in Rassen widerlegt! Damit ist diese umstrittene Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen, der Individuen anhand von gewählten (!) Ähnlichkeiten im Aussehen und Verhalten zugeordnet werden, erfunden von Rassentheoretikern im 19. Jahrhundert, vom Tisch. Und auch die Zuordnung von Individuen zu sogenannten Großrassen wie Europiden und Kleinrassen wie den Nordiden. Aber angesichts heutiger Erscheinungen in Europa, wo widerliche Widergänger unterwegs sind, gucken wir nochmal nach: hochwüchsig, schlank, langer schmaler Kopf, blaue Augen, hellblondes bis hellbraunes Haar, diese Merkmale wurden der sogenannten Kleinrasse der Nordiden, wohnhaft von Skandinavien bis Österreich, woher ein weltberühmter dunkelhaariger Ex-Nordide kommt, zugeordnet. So also wurden die Arier und Arierinnen blond. Und nun kommt´s und freut die Freundin schamanischer Praktiken: Mal abgesehen davon, dass es sich heutzutage verbietet, Menschen nach Äußerlichkeiten zu sortieren, waren „die ersten Menschen“ – um es mal unwissenschaftlich zu formulieren – in Europa waren vielleicht blauäugig, aber wahrscheinlich weder hellhäutig noch hellhaarig. Das haben wir nun molekulargenetisch. Schuld ist die Schamanin. In den 1930er-Jahren, in Deutschland beherrscht von der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialist*innen, kurz Nazis, wird im Kurpark von Bad Dürrenheim in Sachsen, ziemlich mittig im damaligen deutschen Reich gelegen, ein Grab entdeckt. Die Nazis witterten Material für ihren Kult im den Ur-Arier. „Endlich ergab sich ein Anhaltspunkt, dass die Arier keine Migranten (!) aus Indien oder Persien waren, wie Sprachforscher meinten, sondern authentische Deutsche“, schreibt Maritta Adam-Tkalec, Redakteurin der Berliner Zeitung und zitiert „Frühgeschichtler und Frühnazi“ Professor Julius Andree, der 1934 schrieb, eine „Pfahlwurzel“ der Menschheitsgeschichte im „mitteldeutschen Boden“ sei gefunden. „Das Skelett war in sehr gutem Zustand und reich mit Beigaben ausgestattet, weshalb wohl niemand auf die Idee kam, es könne sich um eine Frau handeln“, berichtet Adam-Tkalec und tippt auf männliche Vorurteile aus den patriarchalischen Jahrhunderten. „Steinbeil und Jagdutensilien? Ein Mann, ganz klar.“
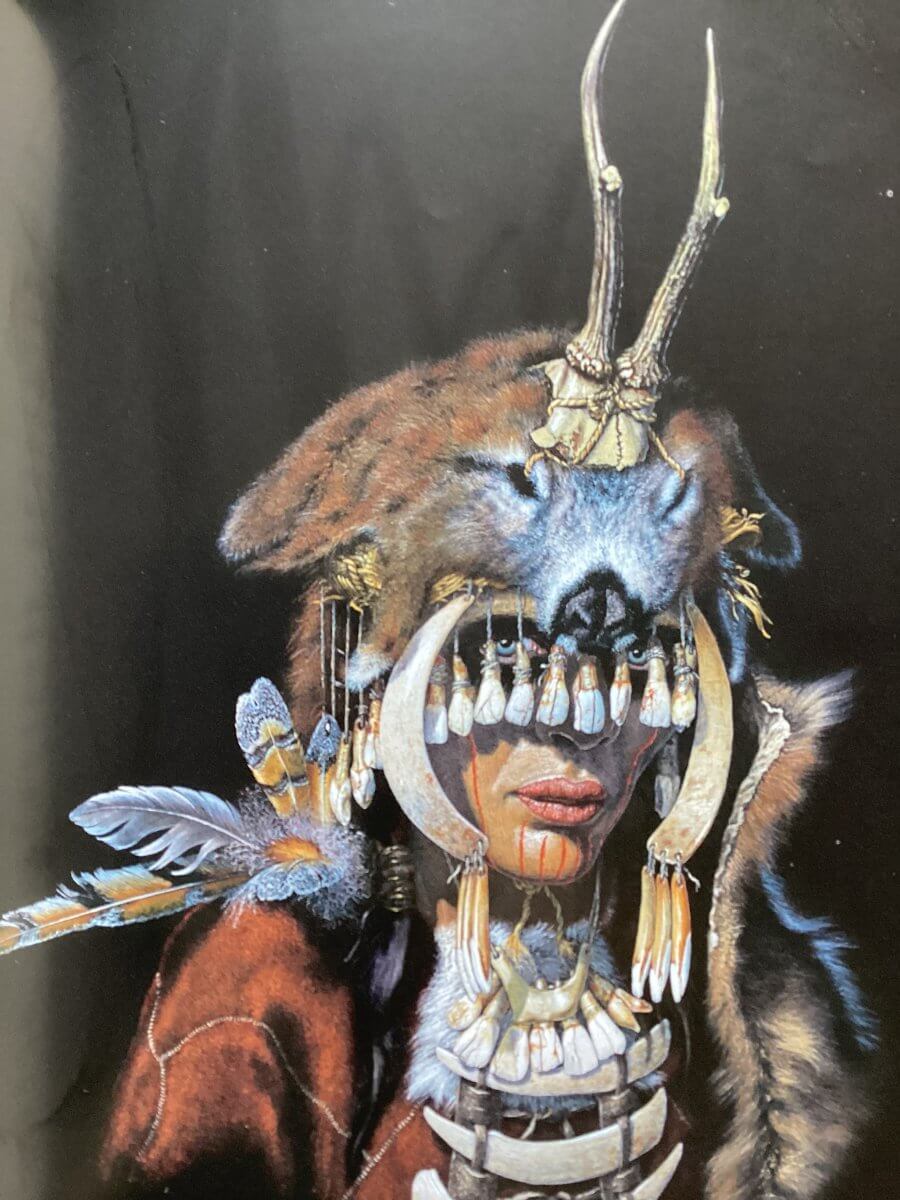
So sah sie wohlmöglich aus, unsere wissende Urahnin, beschrieben im kenntnisreichen Wälzer „Das Rätsel der Schamanin“.
Dieser Irrtum wurde bereits zu Zeiten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) korrigiert, auf deren Territorium dieses 9000 Jahre alte Grab damals lag. Und als sich 2019 nach einer erneuten Grabung, nun auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in deren Bundesland Sachsen-Anhalt, wo die Gebeine nun liegen, die Genetiker*innen ins Spiel brachten, brachten sie das Gesamtbild der Nordeuropäer*innen, vor allem die fixe Idee von den großen Blonden, ins Wanken. Die in Bad Dürrenheim Beerdigte hatte sehr dunkle Haut und glatte schwarze Haare. Und Franciska und den übrigen „artists and activists“, die ich im Januar im hohen Norden getroffen und mit dem persönlichen Prädikat „mostly women – mostly young – mostly fantastic“ versehen habe, die auf der Suche nach zukunftstauglichen Vorfahrinnen sind, rufe ich zu: Die 30- bis 40-Jährige hatte in ihrer (Stein-)Zeit eine gesellschaftliche Sonderrolle, eine machtvolle wahrscheinlich. Das zeigen die Grabbeigaben. Der Archäologe Harald Meller und der Autor Kai Michel schreiben in ihrer in vieler Hinsicht gewichtigen 340-Seiten-Story, das Grab hoch über der Saale, im heutigen Kurpark von Bad Dürrenberg, gehe uns alle an. Unter anderem verleihe der Umstand, dass es der schriftlosen Vorgeschichte an Quellen mangelt, um das Denken der Menschen zu verstehen und ihren Glauben zu rekonstruieren, verleihe ihm enorme Bedeutung. Das Ensemble der Beigaben, die von der tiefen Verehrung der Verstorbenen zeugen, gewähre uns Einsichten in die Anfänge von Religion, Spiritualität und die Wurzeln des Menschseins, „die sonst kaum oder gar nicht zu gewinnen sind“. Der Fall der Schamanin führe us vor Augen, warum heute so viele Menschen über Resonanz- und Transzendenzverlust klagen und unter der Absurdität des Alltags leiden. „Wir begeben uns in eine Zeit, in der die Welt den Menschen noch viel zu sagen hatte und niemand verzweifelt nach dem Sinne des Lebens suchte.“ Außerdem liefere das Grab Einblicke in das einstige Verhältnis der Geschlechter. „Das bedeutendste bisher bekannte Begräbnis dieses Zeitalters in Mitteleuropa gehört einer Frau…. Noch ist das Patriarchat nicht erfunden.“ Und schließlich konfrontiere es uns mit Fragen, „die sich heute angesichts der immer offensichtlicher werdenden Grenzen eines technokratischen auf Ausbeutung der Natur gerichteten Weltverständnisses mit großer Vehemenz stellen“. Die Schamanin ermögliche uns, in eine ganz andere Welt zu reisen. Wenn wir ihren verlockenden Pfaden folgen, könnten wir vielleicht einen Ausweg aus der Bredouille finden, in die wir uns selbst und die anderen Lebewesen auf diesem Planeten gebracht haben.“ So erweisen sich auch ein Archäologe und ein Autor als Mittler zwischen den Zeiten und Spezialisten für die menschliche Seele. Sie arbeiten nur mit anderen Methoden als die Schaman*innen. Die wiederum bis in die heutige Zeit vor allem unter den „Fahrenden“, den nomadisch Lebenden zu finden sind. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass, wie Meller und Michel im Verbund mit anderen Archäolog*innen, Anthropolog*innen, Primatolog*innen (die sich wie Jane Godell, die 90-jährige Forscherin, die gerade ein ermutigendes Werk zum Thema Hoffnung veröffentlicht hat, mit der zoologischen Ordnung der Säugetiere befassen, zu der die Affen, die Menschenaffen und die Menschen gehören), Archäogentiker*innen (die unseren Ahnen mir Hilfe der DANN-Entschlüsselung auf die Spur kommen) und Ethnograf*innen, die mit Feldforschung und teilnehmender Beobachtung Kultur und Politik ganzer Gesellschaften erkunden zu der „noch viel zu unbekannten Einsicht“ gelangen, dass wir nicht normal sind. „Wir leben in einem Ausnahmezustand“ heißt es in „Das Rätsel der Schamanin – Eine archäologische Reise zu unseren Anfängen“. Gemeint ist das „sesshafte, meist in Städten organisierte Leben“ unsere sogenannte Zivilisation. Die berücksichtige nämlich nur ein einziges Prozent der Menschheitsgeschichte. Die beiden Storieteller treiben es auf die Spitze und fragen, ob wir nicht eigentlich die Geschichte unserer Art, die wahre Geschichte des Homo sapiens ignorieren. Dabei ginge es nicht nur um Zahlen. Denn die evolutionäre Anpassung an das Jahrtausende währende Leben in den Gruppen hochmobiler Jäger*innen und Sammler*innen – ich füge hier einfach ein: das radikale Gegenteil von Home-Schooling und mehrstündigen ZOOM-Konferenzen – habe unserer Natur einen eindrucksvolleren Stempel aufgedrückt als, locker zitiert „das bisschen Landwirtschaft und Sesshaftigkeit“. Also ist unser Unbehagen in diesen wenig artgerechten Lebensumständen wohlmöglich auch biologisch bedingt. Mir fällt dabei die kackfreche Frage aus der Frauenbewegung der 1970er ein: „Meinen Sie das politisch oder sexuell?“ Die Wissenschaftler*innen dieser Generation meinen es interdisziplinär, international, kulturell und biologisch. Davon mal ab.
Und zurück zum Grab. Die enorme Vielfalt der im Grab repräsentierten Tierarten – 100 Skelettreste von Bibern, Hirschen, Kranichen, Rehen, Wildschweinen, von Wisent und Sumpfschildkröte sowie diverse Muschelschalen – die Ethnolog*innen als Requisiten schamanistischer Praktiken deuten. Und weil wir den Ewenken nachher nochmal über den Weg laufen, füge ich jetzt hier nochmal ein „Wer hat es erfunden?“ (das kommt von einer in Deutschland häufig ausgestrahlten Reklame einer Schweizer Firma, die 1940 den Kräuterzucker erfand) ein: saman, diesen Ausdruck verwendeten die Ewenken in China, der Mongolei und Sibirien und andere indigene Völker jener Region für „jemanden, deroder die weiß“, für Wissensträger*innen also und im weiteren Sinne auch Heiler*innen und spirituelle Spezialist*innen. Die „Schamanin von Bad Dürrenberg“ war also eine machtvolle Wissende.

Runenreihe, Av Runologe – Eget verk, CC BY-SA 4.0
Wo wir schon mal bei den damaligen Influenzerinnen sind, möchte ich uns wieder ins legendäre Hålogaland beamen. Wo frau und man sich auch nicht nur dem Kriegerischen verschrieben. An dieser Stelle gestehe ich mal, dass ich nahezu verschämt – weil faschistische Propagandisten ihren Ruf verdorben haben – seit Jahren mit den Runen spiele und spekuliere, dem antiken Alphabet, das auf Norwegisch runerekken heißt, Runenreihe. Und mich total freue, als ich im Museum der Tromsøer Uni „En liten bok om de gamle runene“ finde. Darin berichtet Björn Jónasson, wie archäologische Untersuchungen seit den 1980er-Jahren uns „et helt nytt syn“ verschaffen. Und ich fange wieder an, diese Sprache zu mögen! Syn ist vom Geschlecht her neutral und bedeutet allerhand: Gesicht, Anblick, Schein, Besichtigung, Auffassung, Erscheinung. Die neuen Ansichten versprachlicht Jónasson mit Gedichten aus der Zeit der Wikinger*innen, verfasst in Altnordisch, der Sprache, die etwa von 800 bis 1350 in Skandinavien gesprochen und in Stein gemeißelt wurde. Die Bedeutung der Runen wurde damals poetisch so umschrieben, dass nur diejenigen, die die Umschreibungen (kjenninger) verstanden, das Rätsel lösen konnten. Ich probiers mal mit meiner persönlichen Lieblingsrune Bjarkan (altnordisch für Birke, auch Berkanan genannt): „Bjarkan er en stamme med lauv, og et lite tre, og fint tømmer.“ Die Birke ist ein Zweig mit Laub, und ein kleiner Baum, und feines Holz. Mir steht die Pflanzengattung der Birken (Betula), deren Name sich aufs Glänzende, Schimmernde, Leuchtende zurückführen lässt seit den Begegnungen mit den von rauher Witterung verbogenen, aber bestehenden, mit feinen Zweigen wedelnden Birkenbäumchen am Rande der baumlosen Hardangervidda im tiefen Schnee als ein Zeichen für die erfolgreiche Verbindung von Knorrigkeit und Zärtlichkeit. Auch für die leuchtende Schönheit des friluftsliv, nicht für Datenübertragung á la Bluetooth, sondern Gedankenübertragung á la Betula.
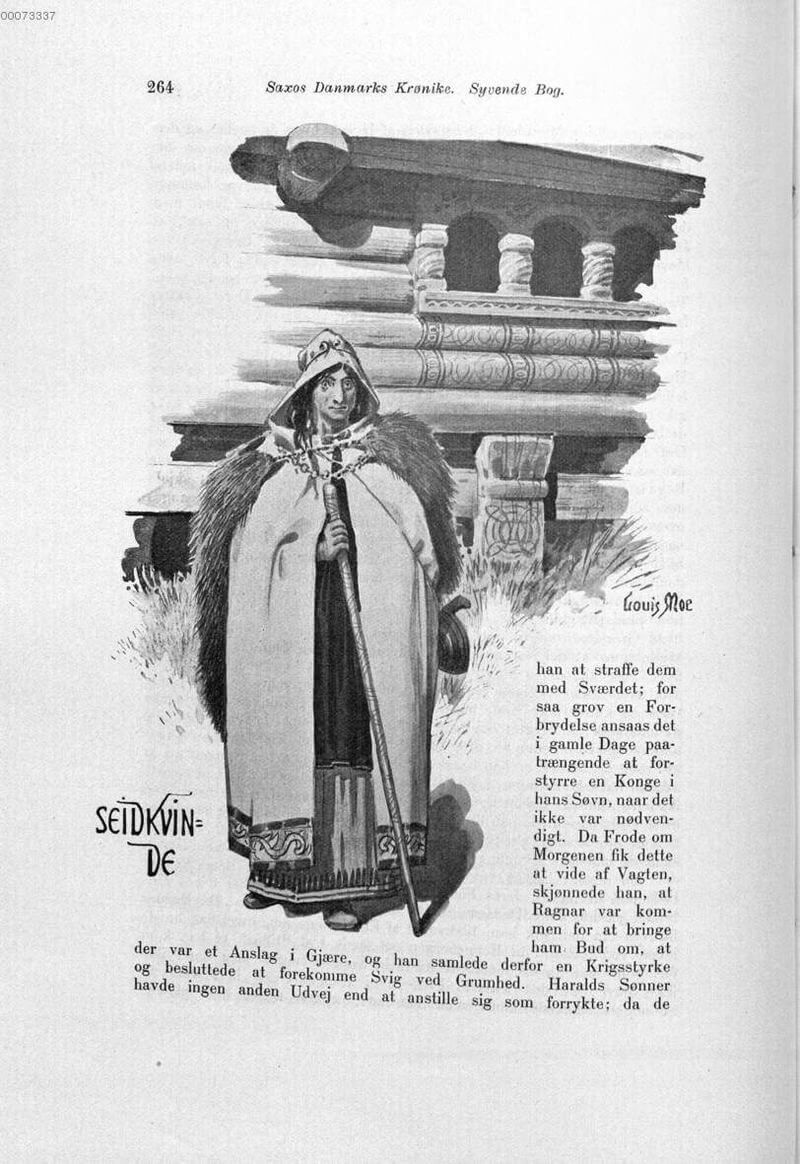
Völva, Frau mit Stab, Saxo Grammaticus: Danmarks Krønike (Gesta Danorum) – tr. Frederik Winkel Horn (Danish) – illust. Louis Moe (1898)
Expert*innen für derlei Geistesblitze – Seherinnen, Wahrsagerinnen, Hexen, Zauberinnen, Prophetinnen, Schamaninnen, um mal nur über die weiblichen Fachkräfte zu schreiben – gab es in Skandinavien noch eine ganze Weile nach dem dortigen Einsetzen der Christianisierung im 10. Jahrhundert. Und meine Begegnungen mit jungen Künstlerinnen aus dem Norden und ihren Werken sowie Ideenwelten riechen nach vielfältiger Widerauferstehung. In Skandinavien wurde – so zeigen archäologische Untersuchungen – mindestens ab dem 5. Jahrhundert seiðr praktiziert, sozuschreiben Magie á la Freyja alias Freia, der altnordische Name dieser Göttin bedeutet schlicht Herrin und die Praktizierenden wurden Völva genannt, was Frau mit Stab heißt. Sie waren Unabhängige und Angesehene, ihr Stab war ein Symbol der Macht, auch über das „Übernatürliche“. Der Völva beziehungsweise spákona (Seherin) Þorbjörg, so heißt es in der in der Geschichte von Erik dem Roten, bot man einen festlichen Empfang „wie er einer Frau ihrer Art gebührte. Man errichtete einen Hochsitz für sie und legte ihr Polster unter. In diesem mussten Hühnerfedern sein. Als sie am Abend eintraf … sah sie so aus: Sie trug einen blauen Mantel mit Spangen. Der war bis zum Saum besetzt mit kostbaren Steinen. Um den Hals hatte sie Glasperlen. Auf dem Haupt trug sie eine Haube von schwarzem Lammfell, innen mit weißem Katzenfell gefüttert. In der Hand hielt sie einen Stab mit einem Knauf oben. Der war mit Kupfer eingelegt, oben am Knauf aber in Steine gefasst. Um den Leib hatte sie einen Gürtel mit Zündschwamm, und daran hing ein großer Lederbeutel, in dem sie die Zaubermittel trug, die sie für ihre Weissagung benötigte. Sie hatte an ihren Füßen zottige Kalbfellschuhe mit langen und starken Riemen und großen Messingknöpfen an deren Enden. An den Händen aber Handschuhe aus Katzenfell, die innen weiß und zottig waren. … Am Ende des folgenden Tages erst richtete man alles für sie her, was sie für ihren Zauber brauchte. Sie hieß Frauen herbeiholen, die das Lied wüssten, das ihr nottue, um ihren Zauber zu Ende bringen zu können und das Varðlokkur heiße. [d.h. „Schutzweisen, schützende Zaubergesänge“]. … Da schlugen die Frauen einen Ring um den Zauberstuhl, auf dem Þorbjörg saß. Dann sang Guðriður das Lied so schön und trefflich, dass alle meinten, nie hätten sie eines mit schönerer Stimme singen hören denn hier. Die Seherin dankte ihr für dieses Lied und sagte: „Manche Geister kamen hierher und dachten, wie schön dieses Lied doch zu hören gewesen sei, – solche, die sich früher von mir abgewandt hatten und mir nicht mehr gehorchen wollten. Jetzt sehe ich viele Dinge deutlich vor mir, die bislang mir wie allen anderen verborgen waren.“

Diese Sieben Schwestern residieren schon zu Þorgerðrs Zeit im Hålogaland.
Im Hålogaland soll damals vor allen Þorgerðr (Thorgerd) verehrt worden sein. Unter anderem unter diesem Namen, unter anderem als Göttin. Schon allein die Vielfalt der Gerüchte weist auf ihren großen Einfluss hin. Versuche mir ein Bild zu machen und stoße aus dem spirituellen Internet ins digitale, stoße dort zu meiner großen Freude auf eine skandinavische Künstlerin – vielleicht haben wir denselben mittsommerlichen Geburtstag, Jenny Eugenia Nyström wird am 13. (das wäre meiner) oder am 15. Juni geboren, witzigerweise exakt 100 Jahre vor mir (bin Jahrgang 1954), dort, wo ich vor ein paar Wochen auf der Zugtour gen Norden im Süden Schwedens vorbeigekommen bin, in Kalmar. Sie stellt auch Frigg dar, auf Deutsch heißt diese Göttin Frigga und angesichts der Fülle von Stories und alten, uralten und neueren Namen spekulieren manche, ob nicht Freyja und Frigg und auch Gerðr, wie Thorgerd auch genannt wurde, auf ein und dieselbe Gottheit zurückgehen. Als Göttinnen-Begeisterte vermute ich dahinter dieses altbewährte Trio (weibliche Dreifaltigkeit): rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, weiß wie Schnee – zumal Þorgerðr Irpa zur Seite gestellt wird, deren Name „schwärzlich, dunkelhäutig“ bedeutet, die auch als Troll bezeichnet wurde. Das altnorwegische Wort verweist jenseits der Geschlechter auf besondere Fähigkeiten: Hexen, Zaubern, Beschwören. Ins magische Reich der Trolle (Verkörperungen von Naturkräften, Fabelfiguren) und Tomtar (Nisse, Kobolde, Wichtel, Hausgeister) entführt Nyström Santa Claus, den Weihnachtsmann. So kriegt er seine rote magische Zipfelmütze und Nygard wird berühmt; von Trollen berichten uns Hamburger Student*innen die norwegischen Student*innen – mit und ohne Alkoholeinfluss. In deren Familien spielten solche fabelhaften Wesen nicht nur unter Vorfahren eine Rolle. Auch unsere Altersgenossen in den 1970ern berichteten ganz selbstverständlich von Begegnungen mit quasi verkörperten Naturkräften. Und ich finde, als ich mich auf die neue Saison in unserem urbanen Garten (www.kulturenergiebunker.de) vorbereite, an erstaunlicher Stelle einen sachdienlichen Hinweis in dieser Angelegenheit: Heiko Hähnsen, bekennender Kenner von Orten der Kraft und ihren Kräften, schreibt in „Kraftort Garten“: „Die bekanntesten Naturwesen sind wahrscheinlich Zwerge, Trolle und Gnome. Ihre Arbeitsbereiche sind das Minaeralreich, aber auch die Versorgung der Pflanzensamen, bis die Sprosse den Boden verlassen.“ Soweit, so verwunderlich – und weiter: „Historisch gesehen, können wir davon ausgehen, dass die Menschen in vergangenen Zeiten eine vergrößerte Zirbeldrüse (Einschub der schreibenden Biologin: das ist die Epiphyse, eine Hormondrüse im Gehirn) hatten, die ihnen erlaubte, stärker mit dem sogenannten „Dritten Auge“ (Einschub der auch übersinnlich forschenden Schreiberin: diese Stelle, wo Seele und Lebensgeister nach alten weltweiten Überlieferungen besonders aktiv sein sollen, liegt auf der Stirn zwischen den Augenbrauen und wird von manchen mit der Zirbeldrüse gleichgesetzt) wahrzunehmen – also nicht körperliche Energieverdichtungen zu „sehen“. … Von skandinavischen Ländern wird berichtet, dass die Menschen dort noch öfter wahrnehmbare Begegnungen mit Naturwesen haben.“ Und so plumpsen wir wieder in die norwegisch-deutsche Student*innenverständigung. Einige der angereisten Hamburger*innen (in unserer Gruppe waren viele angehende Naturwissenschaftler*innen) kamen sich zunächst mal ziemlich geistlos vor. Bis wir dann, nichtmotorisiert auf Fjell (Berg) und Vidda (weiter Fläche) unterwegs, in Schneegestöber oder Nebel so manche Erscheinung hatten. Mit der Göttin Þorgerðr alias Thorgerd in Zusammenhang gebracht wird auch Lathgertha, Lagertha, Ladgerda, Ladgertha. Die scheint aber ziemlich real gewesen zu sein, laut Berichterstattung des Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus im 12. Jahrhundert, eine perita bellandi femina (kriegserfahrene Frau). Einige bezeichnen sie als ruler (Herrscherin), andere als Schildmaid (sköldmö, skjoldmø, skjaldmær). Hier haben wir es mit einer zu tun, die sich für ein Leben als Kriegerin entschieden hat. Lathgertha kämpft laut Saxos Schilderung im 9. Jahrhundert gegen sexuelle Versklavung, als ein Eroberer die Frauen der unterlegenen Partei zur Prostitution zwingen will. Unter ihrer Führung sammeln sich die Frauen bewaffnet und in Männerkleidung zur Gegenwehr. Und Lathgertha ficht in der ersten Reihe streitet, sticht unter den Kämpfenden als besonders tapfer hervor.
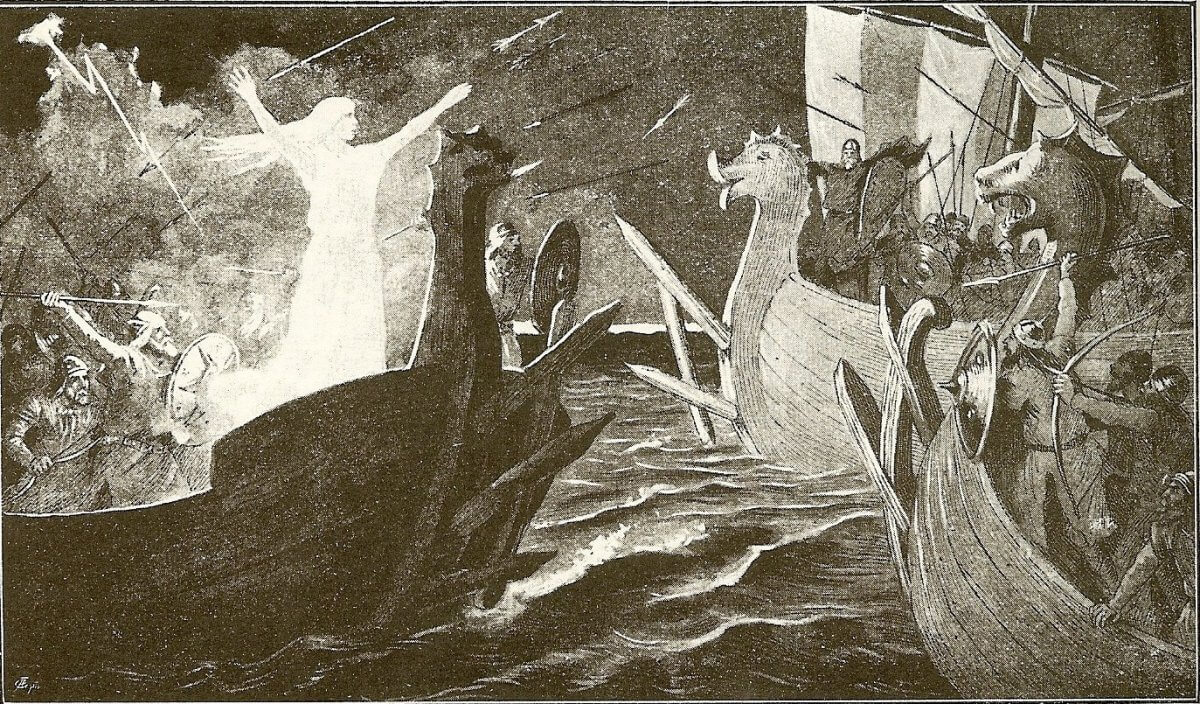
Thorgerd auf einem Bild von Jenny Nyström
Nun wissen wir von den Wissenden Wikingerinnen und können wir uns wieder den Nordmännern widmen, wie es auch Alfred im 9. Jahrhundert tat, mit Gefechten und Berichten. Der angelsächsische König erzählt von Herrn Ottar, der „von allen Nordmännern am nördlichsten“, in einem langgestreckten engbrüstigen Land wohnte, das Halogaland genannt wurde. Es sei ein wildes und felsiges Land, das nur an der Küste bewohnbar sei. Dieser Küstenstreifen werde nach Norden immer schmaler, habe Ottar ihm berichtet, verenge sich dort bis auf drei Meilen. Nach alldem, was wir soeben über Wikinger gelernt haben, war ottar wohlmöglich kein echter, er ging zwar auf Walfang, überfiel aber soviel geschrieben steht, nicht unbedingt benachbarte Küstenbewohner. Östlich seines Reiches erstreckten sich breite Moore, von denen einige so breit seien, dass man zwei Wochen brauche, sie zu überqueren. In den Mooren hätten damals Finnen gelebt, schreibt der angelsächsische König. Nun sind wir beim Thema Urfolk, wie indigene Völker auf Norwegisch heißen, gelandet und beim römischen Historiker Tacitus. Der schreibt Ende des 1. Jahrhunderts von Aesti und Fenni. Mit Aesti meint Tacitus nach Ansicht von Geschichtswissenschaftler*innen die Balten, die zu seiner Zeit das Areal zwischen Weichsel und heutigem Moskau bewohnten, und zu denen meine Vorfahr*innen, die Prūsai (das ist die Eigenbezeichnung auf Prußisch, auf Deutsch heißt dieser Volksstamm Prußen) gehören. Und die Fenni desantiken Schreibers, die Finnen, die König Alfred erwähnt, sind Sámi. Deren Selbstbezeichnung bedeutet Sumpfleute – und ist wiederum mit dem baltischen Wort žēme (auf Prußisch zemme mit Querstrich überm E) für Land verwandt und von der Recherche für meine Ortszeit-Stories anderen Ortes weiß ich, dass auch an der südlichen Ostseeküste ein Sámi lebten, in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad, dem Gebiet ums ehemalige Königsberg herum die dortigen Sámi waren wie die Prußen ein ein baltischer Stamm. Steige jetzt aber nicht in die Sprachforschung ein, versprochen. Und auch nicht in den Verwandtschaftsgrad von Finnen und Samen, wobei das norwegische Wort finn Same bedeutet, um die Verwirrung komplett zu machen. Aber in den Sumpf. In die Moore östlich von Hålogaland. Deren samische Bewohner wurden von Herrn Ottar von Hålogaland beherrscht, schreibt König Alfred. Die hätten ihm Steuern in Form von Tierhäuten, Vogelfedern, Walbein und Schiffstauen, die „aus der Haut des Wales und des Seehundes verfertigt“ wurden. „Ein jeder zahlte nach seinem Stande. Der vornehmste Finnehatte fünfzehn Marderfelle, fünf Rentierfelle, ein Bärenfell, zehn Eimer Federn, ein Bären- oder Otternfellwams und zwei Schiffstaue abzuliefern, jedes sechzig Ellen (also mindestens dreißig Meter) lang.“ Wie die Prusai pflegten die Sámi eine extensive Lebensweise, das heißt sie nutzten die natürlichen Ressourcen mit nur geringen Eingriffen in den Naturhaushalt und unter Belassung der vegetativen Standortfaktoren – sprich jenseits von Kahlschlag. Und beide Urvölker beliefern jahrhundertelang erzwungenermaßen Kreuzritter und Kolonialherren. Auf die Praktiken von „Herrenvolk“, wie Boine es besingt, Steuereintreibern und Kolonialherren kommen wir noch. Von ihrem sagenumwobenen Hålogaland ist nur Helgeland übrig, die Gegend um Bodø mit ihren 15.000 Inseln – und das Hålogaland Teater in Tromsø.

Das Nordlicht käme nur, wenn man es nicht erwarte, weiß Richard
In dessen kaféscene, ein Café mit Bühne und Riesenfenstern zum Tromsøsundet, streben Clara und ich, zur FFN opening reception – FFN steht für die Sektion Film fra Nord – und der DJ lockt uns mit african spirit unwiderstehlich auf die Tanzfläche mit Aussicht auf nachtschwarzes Meer und verschneites Gebirge. Clara, die Filmstudentin aus dem rund zweieinhalbtausend Kilometer entfernten Norddeutschland, die Laurens über die Nordland School of Arts and Film auf den Lofoten ausfragt; Lotta, die Psychologiestudentin aus Nordnorwegen, die schamanische Methoden in die Psychotherapie integrieren möchte; Evgenia, die Große, eine hochgewachsene Russin aus dem knapp tausend Kilometer entfernten Murmansk, die mich dringend bittet, auch auf der TIFF-Abschlussparty auf der Tanzfläche zu erscheinen; und ich, wir toben ein bisschen rum. Ab und zu steigt der DJ vom Podest und erhöht ganz zurückhaltend die Männerquote auf dem Parkett. Das Gebäude, in dem wir durch diese Dunkelzeit-Nacht rocken, erfüllt viele gute Zwecke. Das soll es auch, es ist kein Protzpalast, dieses 1971 gegründete Regionaltheater der Provinzen Troms og Finnmark, knapp westlich des Stadtzentrums direkt am Wasser gebaut, aus Beton. „vårt flotte teaterbygg … har to moderne teatersaler, en kaféscene og en prøvesal. Teknisk stab, administrasjonen og skuespillerne utgjør til sammen 72 årsverk, og sammen jobber vi for å skape godt og grensesprengende teater for vårt publikum”, verkündet das Team des Hålogaland Teater auf der Webseite: „Unser flottes Theatergebäude … hat zwei moderne Theatersäle, eine Café-Bühne (das ist unser Tanzplatz) und einen Probesaal“. Darin würden insgesamt 72 Techniker*innen, Verwaltungskräfte und Schauspieler*innen zusammen arbeiten, „um gutes und grenzensprengendes Theater für unser Publikum zu machen“.
Laurens geht voran. Etwas müde trotten wir in den sehr späten Nachtstunden in westlicher Richtung über die Tromsøya. Vom Tromsøysundet geht es erstmal bergauf, und wir müssen und so auf den unterschiedlich verschneiten oder vereisten Untergrund konzentrieren, dass wir fast die Leuchterscheinung in höheren Bereichen der Atmosphäre verpassen. Bin ja wegen der Lichtspiele angereist, im Gegensatz zu deutschsprachigen Tromsø-Tourist*innen, die mich fragten, ob ich wegen Nordlicht, Walen oder Rentieren gekommen sei (digitale Codewörter:ethical whale-watching & Polarlichter buchen/Aurora hunt tour & Tromsø arctic reindeer – the complete Sámi experience). Sogenannte Elektrometeoren – also in der Luft schwebende Erscheinungen, die mit elektrischen Ladungen zu tun haben – wozu die Polarlichter gehören, diese durch elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes entfachte „lightshow“. In der borealen Zone zwischen 50. und 70. Breitengrad – benannt nach Boreas, dem Gott des Nordwindes – heißt sie Aurora borealis. Und erschien uns ziemlich weit im borealen Süden, im Schärengürtel der norwegischen Ostseeküste, wo wir kein bisschen damit gerechnet haben. Das ist nach meinen Berechnungen die ideale Voraussetzung fürs Nordlicht. Auch auf der Hütte am Rande des Hardangervidda Nasjonalpark – zu Füßen von Europas größter Hochebene – rund zehn Breitengrade nördlicher, hatten wir nicht mit Aurora gerechnet. Nach einem ausführlichen Gløgg-Besäufnis, Glögg ist ein skandinavischer Glühwein mit Rosinen und Mandeln, für den wir sehr zur Freude norwegischer Gäste immer größere Mengen norddeutschen Rum importierten, waren einige überhaupt nicht aus den Stockbetten zu kriegen. Die anderen trugen die Lautsprecher raus und wir hatten Eistanz unter knallbuntem Himmel. Nordlicht hatte ich also schon – und zwar kostenlos, wie es sich für Naturerscheinungen samt Pflanzen- und Tierwelt gehört. Das ist in Norwegen gesetzlich geregelt: Das friluftsloven, ein Gesetz für nichtmotorisierte/n Verkehr, Aufenthalt und Aktivitäten in der Natur (auf Norwegisch friluftsliv und praktisch das Wichtigste überhaupt), liegt dem allemennsretten zu Grunde, welches jedem Menschen das Recht auf kostenloses friluftsliv einräumt.
Den Walen mag ihnen nicht auf die Pelle rücken, trotz der dicken Fettschicht. Wir Mebelästigen die Meeressäuger ohnehin genug. Tourismus, Schifffahrt, Fischerei, Waljagd, Wilderei und insbesondere über die Umweltverschmutzung führen zu einem rapiden Schwund und bedrohen die Vielfalt bei dieser Ordnung der wasserlebenden Säugetiere (Ceatacea). Beim Segeln auf der Ostsee haben wir manchmal für sie gesungen. Und es war uns ein leises Fest, wenn die kleinen Schweinswale sich unserem kleinen Boot näherten.
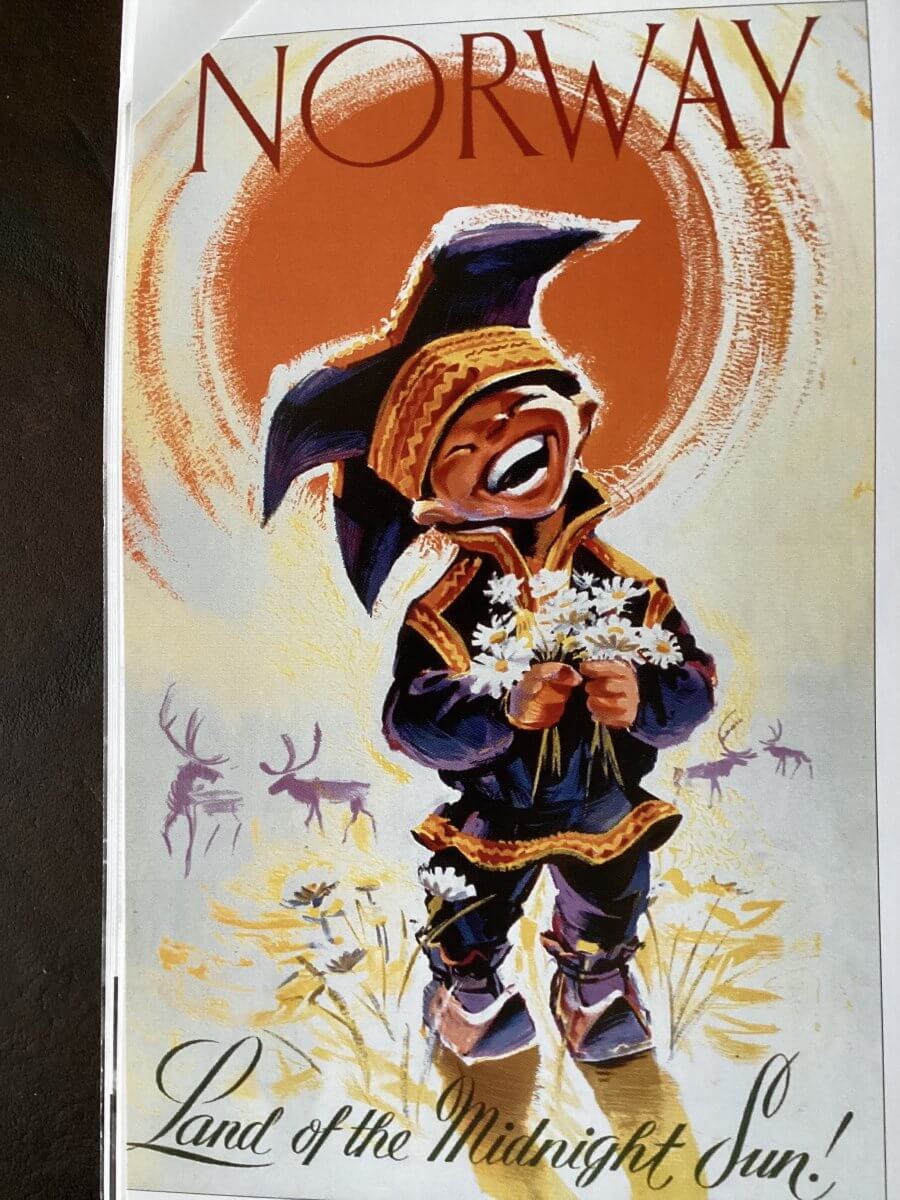
Dieses verräterische Plakat lädt ein ins Land der Mitternachtssonne. Fotografiere es in NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM (http://uit.no/tmu), Tromsøs Arktischem Universitätsmuseum.
Und in Sachen „Turistattraksjon“ (Touristenattraktion) informiere ich mich bei einer, die weiß, wie es ist, Sámin zu sein: Ella Marie Haetta Isaksen, Jahrgang 1998, „ambassadør – for min generasjons samer“, Botschafterin für die Sámi ihrer Generation. Das Ausstellen samischer Kultur sei keine neue Erfindung, schreibt Isaksen in ihrem 2021 erschienenen Buch „Derfor må du vite at jeg er same“. Eine samische Familie aus Røros – einer Bergstadt in der Mitte Norwegens an der Grenze zu Schweden – sei in den 1820er-Jahren im Londoner Naturgeschichte-Museum ausgestellt worden. Ende des 19. Jahrhunderts wären dann Sámi im Zirkus, in Vergnügungs- und Tierparks zu finden gewesen. Und als „die Kreuzschiff- und Autotouristen in Norwegens hohem Norden auftauchten, war die samische Kultur ein zentraler Teil der Vermarktung.“ Sie selbst sei, als sie auf einem Fest in Alta – die Stadt liegt in Nordnorwegen mittig zwischen Tromsø und dem Nordkapp – ihre Tracht (nordsamisch gákti, norwegisch kofte) trug, als Touristenattraktion beglotzt und angequatscht worden „Oh Gott, du bist Sámin! Wie cool!“ – als sei sie ein für diese Veranstaltung engagiertes Unterhaltungs-Highlight. Die UN-Deklaration der Rechte indigener Völker – zu diesen Rechten gehört das aufs eigene kulturelle Erbe – gebe auch Leitlinien für den Tourismus. Weiterhin würde vielerorts das Bild vermittelt, „dass wir Samen in der Finnmark im lávvu (in der Zeltkote) wohnen und Rentiere haben. … Unsere Kultur ist in zunehmendem Maß zur Ware geworden, und verschiedene Akteure versuchen, Geld verdienen, mit allem von der Hautcreme mit samischem Namen und samischen Ingredenzien bis zu falschen Trachten. So würde das Bild der samischen Kultur zum Dekor degradiert. Die Leute kommen angeflogen, lassen sich zu den Rentieren und zum Nordlicht kutschieren, und fliegen wieder davon. So schreibt es Isaksen nicht, so kommt es mir vor, weil am Flyplassen, dem Flughafen im Westen der Insel enorm viel AirTraffic passiert, die Luftfahrzeuge hinterlassen ihre Kerosinspuren und Geräusche am klaren Himmel und in der arktischen Stille.
Still ist es in der Nacht nach der Party. Und Laurens und ich sind noch nicht übern Berg. Wir gucken ein bisschen Aurora, was für ihn nach vielen Monaten in Tromsø, dem Ort mit der weltweit höchsten Nordlicht-Wahrscheinlichkeit, zum Alltag, genauer zum Nachtleben, gehört und glitschen über die Baustellen – der Stadtteil Fagereng ist Neubaugebiet – hinunter gen Nordufer, zum Grønlandsvegen.
schwärme Mittwoch, den 18. – 12:00 – Svermeri – Fiskegata –
dort lande ich nach meinen morgendlichen Füller-Notizen auf dem WG-Sofa – Mitbewohnerin Bergljot ist zum Skifahren aufgebrochen, Eirin zur Arbeit, Laurens tippt auf dem anderen Sofa Filmkritiken – er gehört zur TIFF-Jury – weil die städtische Buslinie 34 mich am Sandnes-Sundet entlang mit Blick über die Meerenge Sandnessund zur Kvaløya (samisch: Sállir, deutsch: Walinsel), hinter der ich mir immer das Nordmeer vorstelle, auf dem ich 1984 zur kalten Küste (Übersetzung von Svalbard, des norwegischen Namens für die Inselgruppe Spitzbergen) gefahren bin; über den Tromsøer Stadtteil Sorgenfrei (sorgenfri); um die Südspitze der Insel Tromsøa (sydspissen) herum; am Hålogaland teater vorbei, wo wir vor nicht allzu vielen Stunden getanzt haben; ins sentrum transportiert, zur Skippergata. Dort steige ich aus, weil ich eine Vorliebe für Boots- und Schiffsführer*innen hege, die uns sicher durch Stürme und brausende Wogen navigieren. Das svermeri kafe og redesign dort, lenkt meinen inneren Kompass ab, zieht mich magnetisch an. Svermeri bedeutet Schwärmerei – und die bleibt nicht aus in diesem Laden für Leckereien und Gebrauchtwaren (redesign). In meinem schönen schwarzen Notizbuch mit dem eingeprägten dem Elchkopf, dem regional geprägten Ikon des Tromsø International Film Festival, schwärme ich vor mich hin: „Am Tisch schräg gegenüber haben die Frauen sich über Kurzfilme unterhalten, TIFF ist hier das Event. Am Nebentisch spricht eine Frau in meinem Alter mit altem schönen Norwegerpullover (rundgestrickt …) über Kurzfilme“. Die Café-Betreiberin, Katrine Dahl Jensen, verliert bei diesem TIFF-bedingten Andrang fast den Verstand, wie sie sagt, aber nur fast. Sie schafft es, gleichzeitig uns alle gleichzeitig zu verköstigen und mir stolz zu erzählen, dieser Laden sei ihr drittes Baby, „15 years pregnancy, I love it“. Beim Verzehren meines PAKETTILBUT aus varm lunch, dagens kake + kaffe vergeht mir das Schreiben. Ihre Baiser-Torte ist betörend.

Danach trete ich wieder auf die Skippergata mit ihren Holzhäusern, von denen dieses, in dem Jensen zunächst mit dem Verkauf von restaurierten Möbeln begann, eines der ältesten ist – es steht seit dem 18. Jahrhundert – und komme nicht weit. Nur bis zum Perspektivet museum, das mir auf der Stelle ganz andere Durchblicke und Einsichten eröffnet. Hier stünden die Menschen und die Welt, in der wir leben, im Zentrum, lokal und global, so beschreibt sich diese Einrichtung an der Ecke, wo der kleine Platz an der Skippergata an die Storgata stößt. Im Erdgeschoss hängen Bilder der Fotografin Evgenia Arbugaeva. Ihre Heimatstadt heißt auf Jakutisch Тиксии/Tiksii und liegt in der größten unterstaatlichen Territorialeinheit der Welt, in der Саха Өрөспүүбүлүкэтэ (Sacha, Jakutien), diese russische Republik ist nur wenig kleiner als Indien. Knapp die Hälfte ihrer Einwohner sind Сахалар (Sachalar/Jakuten), die größte der sibirischen Volksgruppen, zu denen auch die Ewenken und die Tschuktschen gehören, die noch um 1900 in dieser Riesenregion nahezu unter sich waren, die nach DNA-Untersuchungen nahe mit den im südwestlichen Sibirien lebenden Altaiern verwandt sind, einem anderen indigenen Volk, bei dem viele schamanische Praktiken erhalten blieben. Unter den Schamanismus praktizierenden Jakut*innen gibt es unter anderem Spezialist*innen für Musiktherapie mit der Maultrommel und solche fürs schamanische Trommeln. Schamanentrommel, diese Bezeichnung für ein Hilfsmittel für magische Praktiken, das weltweit in verschiedenen Kulturen zum Einsatz kommt, ist rein funktionell und unabhängig von der Bauart. Und diese Trommeln (norwegisch runebomme, nordsamisch gobdas, in der Altairegion tüngür, bei den Innuit qilaat genannt) haben unterschiedliche Funktionen, sind quasi Fahrzeug für Seelenreisen aber auch „Apparat“ für Heilungen.

Im Perspektivet museum beleuchteten und erleuchteten Bilder der Fotografin Evgenia Arbugaeva die Verhältnisse von Mensch – Land – Meer in der russischen Arktis.
Abgesehen von diesen kulturellen Schätzen, diesem erprobten Know-how, verfügt Jakutien über etwas, von dem eine Sage der russisch-orthodoxen Neusiedler im hohen Norden, die dort zu Sowjetzeiten einwanderten, Folgendes sagt: Gott seien im Zuge der Erschaffung dieser Region am Nordpolarmeer die Finger steif geworden und so seien ihm Gold, Silber und Platin aus dem Sack gefallen. Solche Stories führten dazu, dass die sibirischen Volksgruppen der Region, neben den Jakuten die Ewenken, Ebenen, Dolganen, Tschuktschen und Jukagiren, die dort um 1900 noch fast unter sich waren, es mit Hunderttausenden von Neusiedlern zu tun bekamen, die unter anderem die Bodenschätze ausbeuteten.
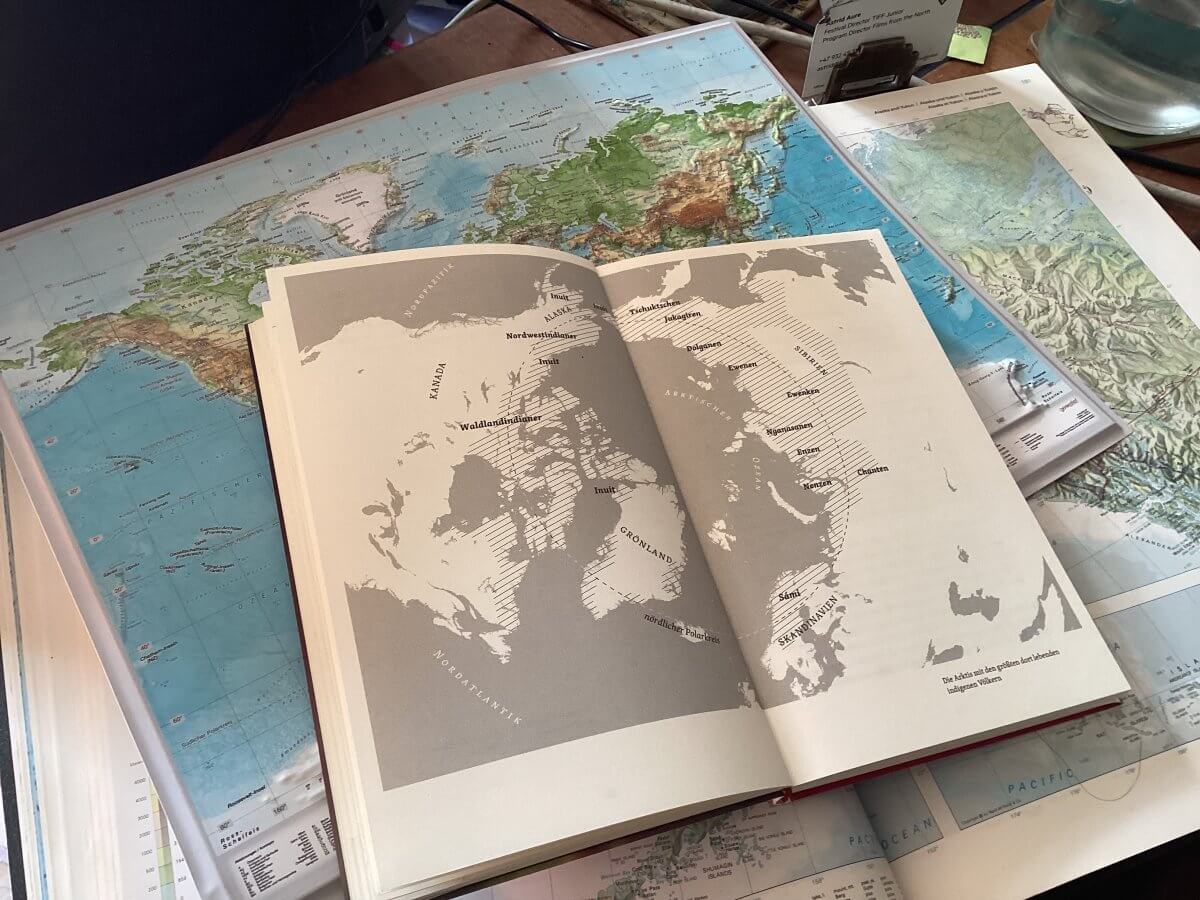
Die Arktis mit den größten dort lebenden indigenen Völkern: Inuit, Waldlandindianer, Nordwestindianer, Tschuktschen, Jukagiren, Dolganen, Ewenen, Ewenken, Nganasanen, Enzen, Chanten, Nenzen, Sámi; Abbildung aus GRÜSSE AUS LAPPLAND, Nils-Aslak Valkeapää, Samica, Department of Scandinavian Studies, Freiburg
Tatsächlich ist der Untergrund dort reich an Edelmetallen, Erdöl und -gas, Kohle und Diamanten. Arbugaevas Heimatstadt liegt an der Laptewsee, und schon kommen die nächsten Superlative. Dieses Randmeer des Arktischen Ozeans (Nördliches Eismeer, Arktik, Nordpolarmeer, kleinstes Weltmeer) ist fast 3000 Meter tief und die größte Stätte der Entstehung arktischen Eises. In den 1930er-Jahren wurde in Tiksi ein Seehafen angelegt, über den gut 20 Jahre Güter von See- auf Flussschiffe verladen und über die Lena weitertransportiert. Als die Nebenstrecke der Transsib am Oberlauf der Lena fertig wurde, ging der Seetransport drastisch zurück. Das soll sich nun ändern. Die sibirische Hafenstadt liegt nämlich an der Nordost-Passage, dem Seeweg, der von hier aus an der Nordküste Eurasiens entlang über die Ostsibirische See und die Tschuktschensee zur Beringstraße und damit in den Pazifik führt. Bis etwa 2025 soll der Hafen eine Ladekapazität von 67.000 Tonnen bekommen. Zumindest in der 90-tägigen eisfreien Saison könnten dann Schiffe über diese Meerespassage angelandete Waren über sibirische Flüsse ins Landesinnere transportieren. Noch aber liegen der Hafen und seine Region, wie Arbugaeva auf ihren Bildern eindrücklich zeigt, wirtschaftlich darnieder, es gibt kaum noch Arbeits- und Lebensmöglichkeiten. Was würde sich ändern, wenn die Nordost-Passage sich rentiert?

Diamantenmine Udachnaya, Von Stepanovas (Stapanov Alexander). Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=350061
Zuvor bedrohen Neuauflage und Aufhetzung des alten kalten Krieges die internationale Zusammenarbeit – auch mit US-Wissenschaftler*innen – an Tiksis Wetterstation, die in sensationell unberührter Umgebung liegt. Da brülle ich mit der russisch-amerikanischen Gypsy Punk-Rock Band MiruMir: Миру Мир! Frieden der Welt!
Spezielle Sprachkünstlerin oder Weibliche Literaturgeschichte
Die freundliche und entgegenkommende Mitarbeiterin am Empfang schickt mich, weil ich nur eine knappe Dreiviertelstunde habe, in den ersten Stock. Schnell stecke ich mein kleines Notizbuch und Bleistifte ein. Und fange sofort an: „Det er Malerbliket som holder fast og fanger situasjonene, men det er språkkunstneren som setter alle de maleriske øyeblikke sammen til en strøm av bilder.“ Dieses Zitat stammt von Janneken Øverland (Jahrgang 1946, Herausgeberin des norwegischen Literaturmagazins Vinduet („Das Fenster“), Mitredakteurin von „Norsk kvinnelitteraturhistorie“ (der weiblichen Literaturgeschichte ihres Landes), Verfasserin einer Cora-Sandel-Biografie) und ich freu mich so, dass mein verstaubtes Norwegisch wieder aufwacht. Und lache berührt und berückt über Cora Sandels „Geschichten für Jung und Alt“ mit dem Titel Dyr jeg har kjent, „Tiere, die ich kennengelernt habe“. Im Nachwort zur Neuauflage dieses Novellenband, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei Gyldendal, einem der bedeutendsten norwegischen Verlage, wo herauskam, wo Øverland die Abteilung für Übersetzung von skjønnlitteratur (Belletristik) leitet, schreibt die Kritikerin, dass Sandel bei der Erstausgabe empört gewesen sei: „… nach fünf Jahren Schweigen, fünf Okkupationsjahren von ganz besonders abgefeimter Art, finde ich es widerwärtig, mit einem kleinen Buch über Katzen und Kanarienvögel zu kommen, punktum.“
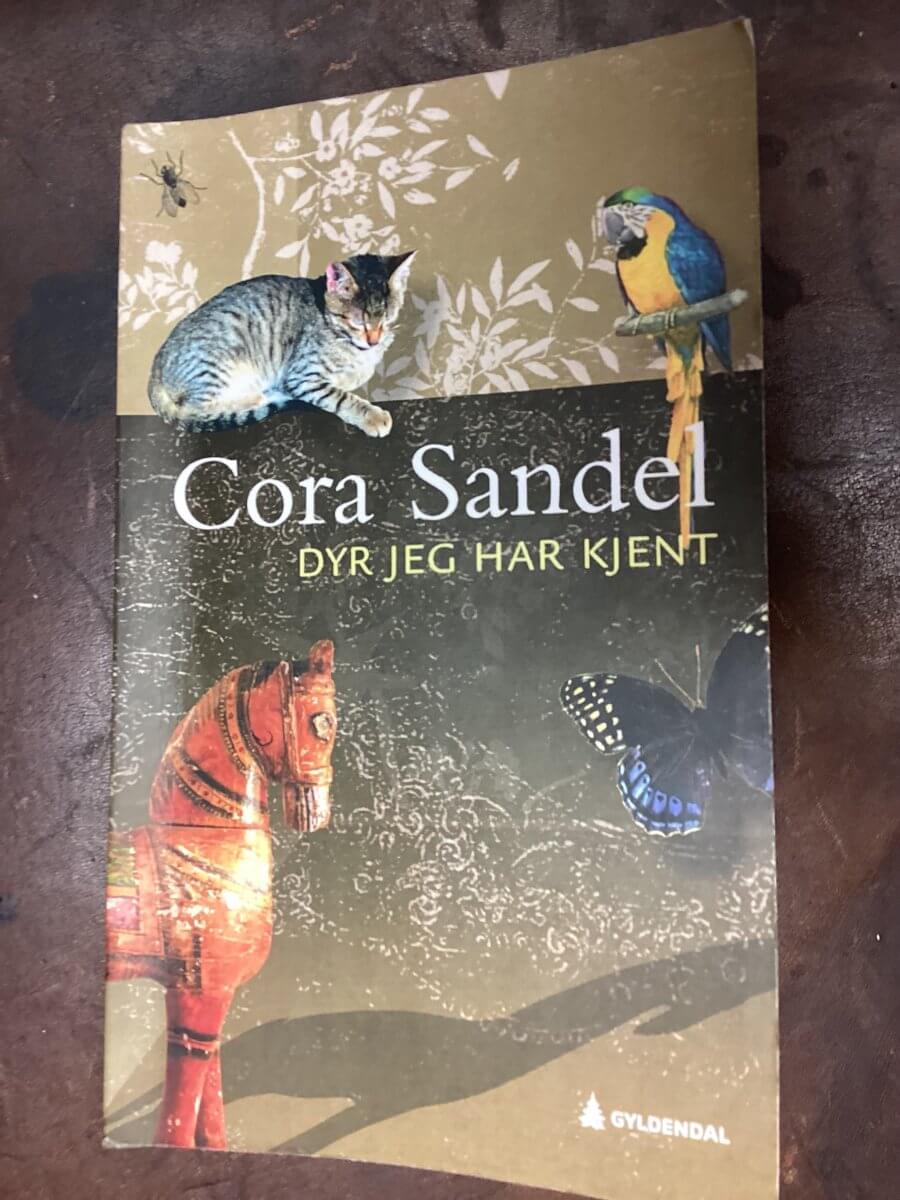
Leser*innen und Kritiker*innen lasen das anders, spekulieren darüber, was es zu bedeuten hatte, dass Sandel in der Einleitung schreibt, diese Geschichten wären vor allem wahr. Über die Wahrheit in der Literatur und die Autobiografie in den Tiergeschichten. Sie entdecken muntere, humoristische, gar possierliche Seiten an der mittlerweile in Schweden und Norwegen berühmten Autorin, die, immer in gekonnt knappen Formulierungen, bisher eher über Disharmonie und Sehnsucht geschrieben hatte, und deren tiefen Respekt für die Tiere. Ihr Engagement fürs Tierwohl kommt aus tiefster Seele. Schon als Zwanzigjährige schreibt sie Beiträge für „Dyrenes Ven“ (Tierfreund). Mir kommt es hochaktuell vor, wie Sandel über Haustiere schreibt: wenn wir sie für unser Vergnügen ins Haus holten, müssten wir artgerecht für sie sorgen, und wenn wir das nicht länger könnten, sie entweder in gute Hände geben oder ihnen einen leichten, kurzen Tod verschaffen.
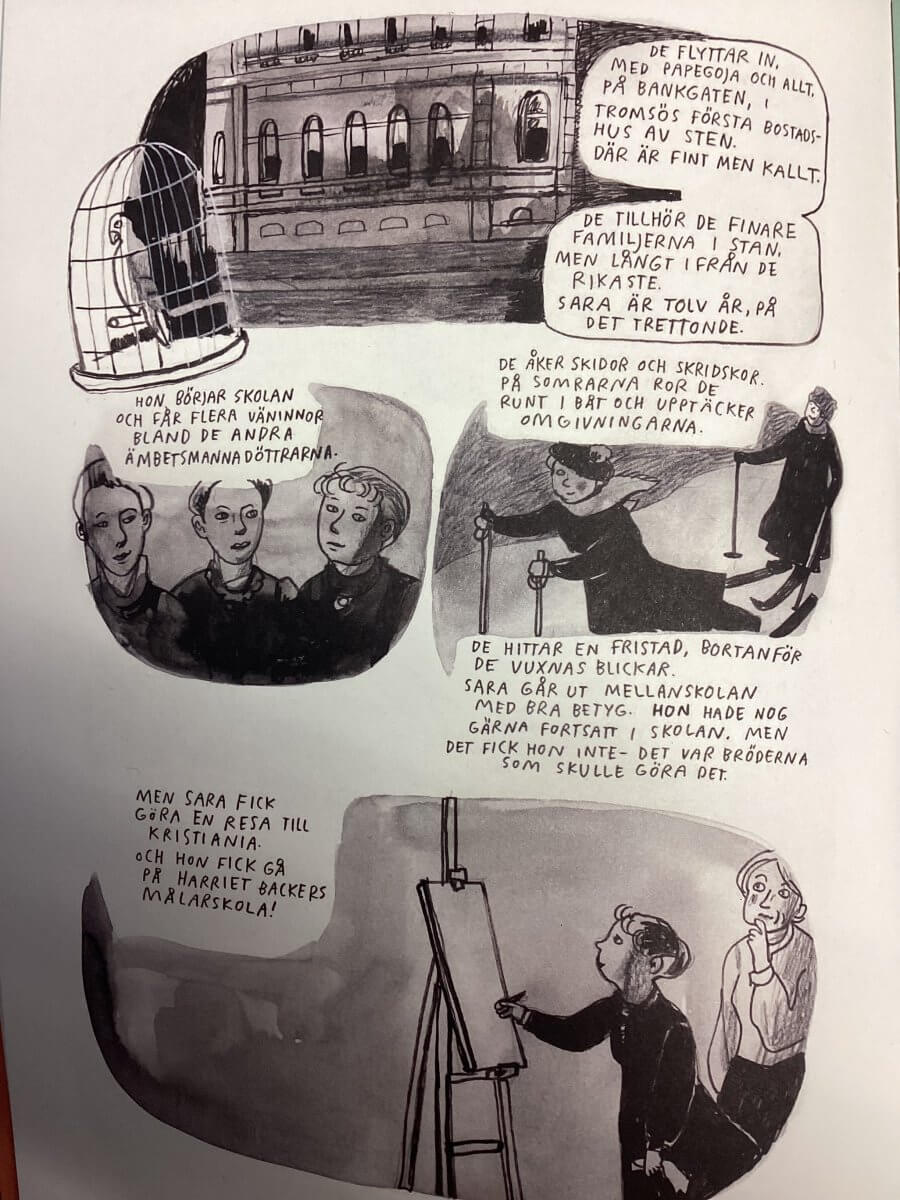
Zu Sara Fabricius´ (späterer Künstlerinnenname Cora Sander) ersten Haustieren gehörte ein Papagei. Autorin der bebilderten Biographie der norwegischen Schriftstellerin ist Anneli Furmark
Zurück ins PERSPEKTIVET MUSEUM. Dort verrutscht mir erstmal die Perspektive angesichts zweier Frauen. Begegne ich hier einer Malerin – über deren Blick Øverland im am Eingang aufgehängten Zitat schreibt, er fange Situationen und halte sie fest – oder einer Sprachkünstlerin, wie Øverland diejenigen nennt, die „all die malerischen Augenblicke in einen Strom von Bildern zusammenfließen lassen“? Gehe weiter durch die wunderschönen Räume dieses sehr alten Hauses, ohne zu wissen, wer Sara Fabricius ist, der ein Riesenzitat zuruft: „Und du musst schreiben, Sara – das gebe ich dir auf den Weg! Ich weiß, dass du vieles hast, was du sagen wolltest – du bist verpflichtet, es zu sagen, das bist du uns allen schuldig“, deren riesige Bibliothek ich in dieser Ausstellung ohne englische Untertitel bewundere. Bei Cora Sandel habe ich eine Idee: haben wir nicht im Norwegisch-Literaturkurs Novellen dieser Autorin gelesen, eine Sammlung namens Vart vanskelige liv? Vertraue mich von den „Perspektivenmacher*innen“ an, eine von ihnen sitzt unten am Empfang und wirkt sehr wissend, und den von ihnen arrangierten Dingen. Aus einem Bücherschrank heraus höre ich: „Var det bare blitt penger! Søker stipendier … understøttelser … nesten ingen betaling tross strev“. Diese Klage aus einem Brief dröseln wir von hinten auf: Trotz aller Anstrengungen und Bemühungen erhält die Schriftstellerin nahezu keine Bezahlung, Unterstützung, Stipendien. Dennoch schreibt sie nach eigenem Bekunden „happy ends“ und drückt sich auch mit Farben, Bildern aus. „Ich liebe es zu malen, ich werde aber niemals Malerin“. Aber die Ausstellung würdigt auch die „billedkunstneren“ Sprachkünstlerin ist Sara unbedingt, mit Mitte 20 schreibt sie in Isbjørnene/Dyrenes Ven (Eisbären/Tierfreunde): „Und wenn du endlich deinen Bestimmunsgsort hast, findest du vielleicht eine kleine Dame, … das wirst du sicher, weil wir in einem humanen Zeitalter leben“. Ihren Ort findet die aus dem Gutbürgerlichen Aufgebrochene wohl nicht auf der Stelle – aufs Tromsøer Oberschichtsambiente folgt unter anderem ein ganz kleines Appartment in Uppsala – und die Humanität in Europa geht spätestens zehn Jahre später in die Knie, als der erste der beiden Kriege ausbricht, die sie erlebt.

Diese Zeichnung zeigt den forschenden, skeptischen Blick der Mutter
Ich stolpere im ersten Stock ihres Elternhauses in Saras Bibiothek (Saras Bibliothek ist auf der CoolPix) über antifaschistische Werke, Bücher über Widerstand und Befreiung, und in mir blitzen Erinnerungen daran auf, dass wir jungen Deutschen gut zwanzig Jahre nach Kriegsende durchaus nicht bei allen Norweger*innen willkommen waren. Mein Verständnis dafür hat sich auf dieser Reise enorm vertieft, darauf komme ich noch zurück.
Nun lausche ich wieder der Autorin: „Ich hatte einmal eine Sprache. Ich habe damit gearbeitet und bin soweit gekommen, dass ich sie beherrschte wie ein Messer in meiner Hand. Ich konnte damit Gedanken aufspießen und sie festhalten.“ Mich lesend weiter tastend, nicht alles Norwegische verstehend, begreife ich Stück für Stück, dass die 1880 geborene Sara Fabricius in diesem wunderbaren Haus aufgewachsen ist, in einem bourgeoisen Haushalt der angehenden Jahrhundertwende – „Wir waren wohlerzogen in dieser Zeit. Allzu wohlerzogen“ – und Cora Sandel ihr Pseudonym ist.
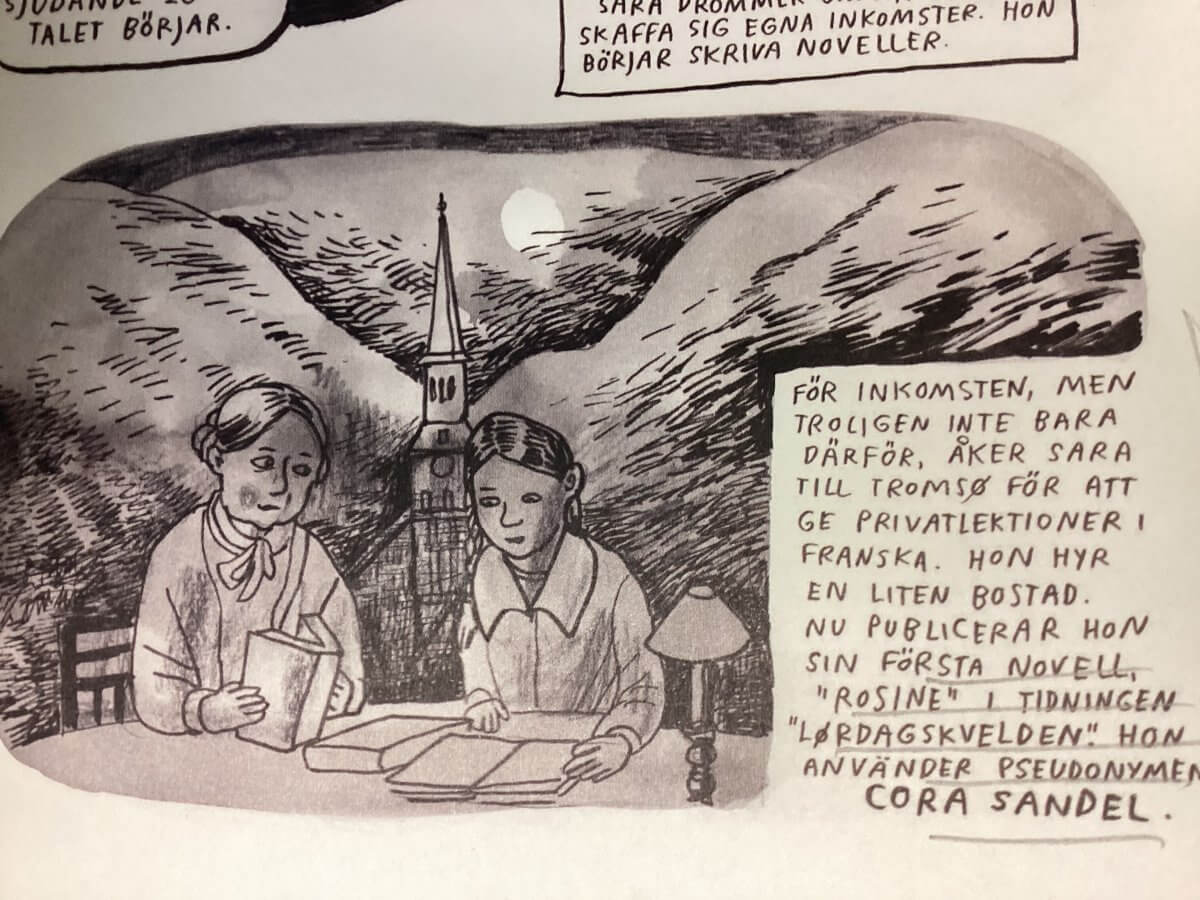
Die Zeit, als die Schriftstellerin begann, unter dem Pseudonym Cora Sandel zu publizieren
Es gibt im Museum ein Foto von C. S. Kranes Konditori. Ich beschließe, später mal digital und analog nachzublättern. Und siehe da, auch hier liegen Realität und Fiktion nah beieinander, ich kann die Grenzen so wenig ausmachen wie den Zeitpunkt, zu dem sich Sara Cecilie Margareta Gørvell in Cora Wandel umbenennt. Aber als Sandels Roman „Kranes konditori“, die Geschichte einer zeitweise einsamen Trinkerin (Cafés boten neben Kaschemmen den einzigen in Norwegen streng regulierten Alkoholausschank), erscheint gibt es Kranes konditori in Tromsøs Storgata nicht mehr.
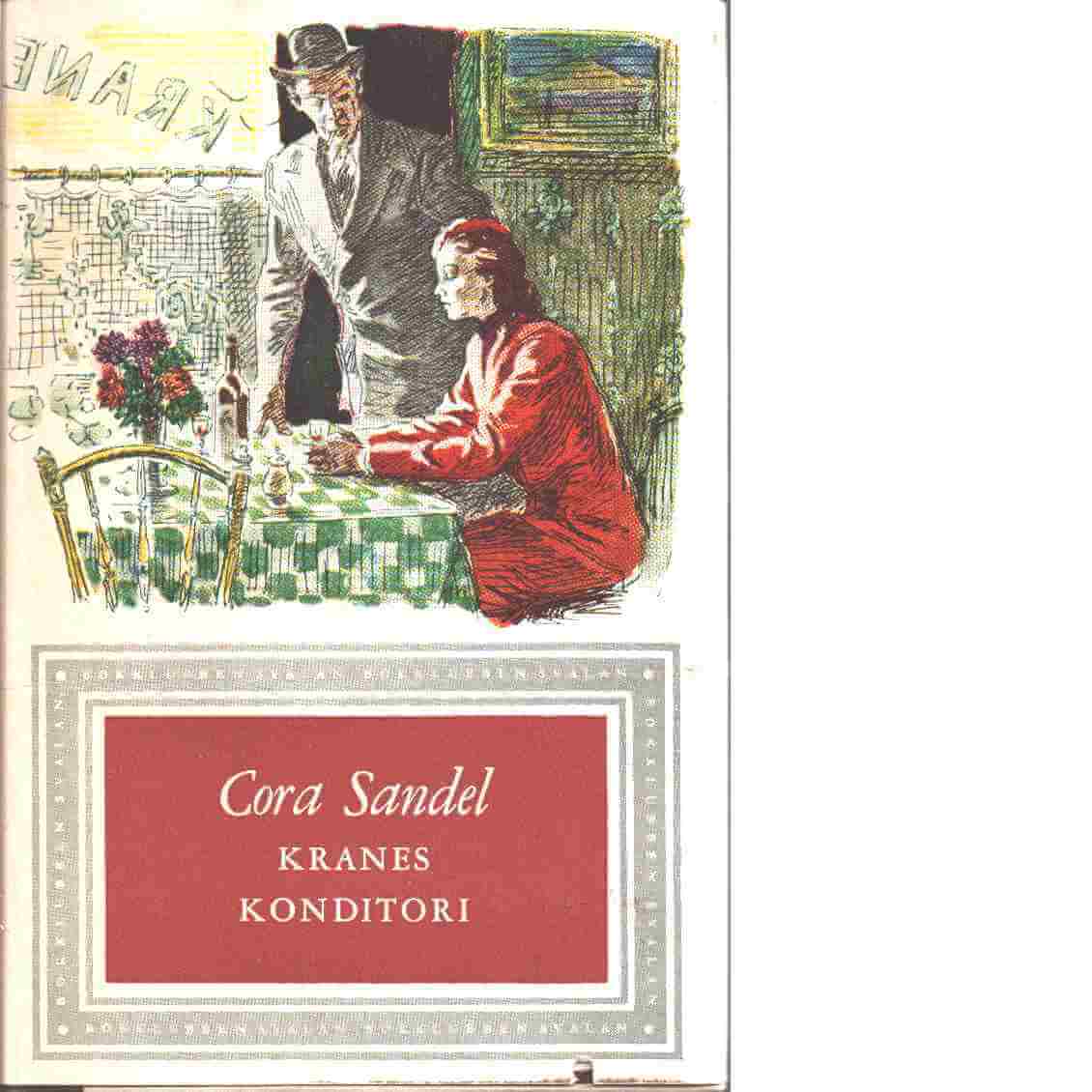
Im zweiten Stock des Museums im ehemaligen Wohnhaus ihrer Familie, dort wo Sara ihr Schlafzimmer hatte, sind die Dinge eines Lebens mit vielen Adressen ausgestellt. S. C. M. G. Fabricius wird in Christiania geboren, wie Oslo damals heißt, wächst in Tromsø auf, zieht 1905 nach Paris und wohnt in ihren letzten Lebensjahren in Uppsala. Aber wenn seine Mutter von „zu Hause“ sprach, sagte ihr Sohn Erik Jönsson 2003 auf Tromsøs internationalem Literaturfest Ordkalotten.

Üppig möbliertes Oberschicht-Zuhause, wie es im perspektivet museum zu sehen ist: „This reconstructed reception room is called the “Klunkestua” after an interior style called “klunkestil” (named after the German word for tassel) which is characterised by heavily upholstered furniture decorated with elaborate trimmings, richly draped curtains and large green plants. Paintings and photographs with heavy frames, exotic ornaments and souvenirs were also used to create the right atmosphere.„
In den gesammelten Dingen sind, wie sie schreibt, Wirklichkeiten versteckt sind. Die Wirklichkeiten ihrer Kindheit in einem üppig möblierten Oberschicht-Zuhause. In ihrem Buch über die Tiere, die sie „kannte“, schreibt Sandel, dass in ihrer Kindheit die Rückkehr des Vaters von einer Seereise immer neue und spannende Sachen in der Wohnung mit sich brachte, und dass so auch ein Papagei in den sonnenlosen, langen, arktischen Winter gelangte. Aus Tromsø stammt ein Stein von der telegrafbukta. Diese tatsächlich nach einer früheren Telegraphenstation benannte Bucht an der Südwestspitze der Insel Tromsøya ist zur zeit meiner Nordlandreise vereist und verschneit, wird aber zur Sommerzeit zum Badeparadies. Sie betrachte diese Sachen täglich, schreibt Sandel als alte Dame, und denke an Orte im Süden und Norden, „wo ich große Stücke meines Herzens“ … und dann versagt mein Norwegisch. Sandel schrieb „hvor jeg har lagt igjen store stykker av mitt hjerte“ und ich höre im Geiste den norwegischen Liedermacher Finn Kalvik: „To tunger har mitt hjerte, to viljer har mitt sinn, jeg elsker deg bestandig, men jeg blir aldri din.“ So ist das damals in unseren 20ern, als die Herzen zwei Zungen hatten, und die Gemüter zwei Willen und eine/r den oder die andere zwar beständig liebt, aber ihm oder ihr nie gehören wird.
Sie sammle Reliquien, eine Mischung von „Erinnerungsstoff“. Erinnerungen an ihre Zeit als umherziehende Bohemienne.

Selbstporträt Sara Fabricius/Cora Sandel
Hinterher ist eine immer schlauer – wenn sie denn hingeguckt und hingehört und Literatur gebunkert hat, soviel der karierte Koffer schleppt. Nö, der trägt die Bücher nicht selbst, aber entscheidet mittels Reisemagie, was schwer wiegt und was wirklich schwerwiegender Erinnerungsstoff und daher für den Heimtransport geeignet zu sein scheint. Dazu gehört „sara – ET LIV OG EN HISTORIE – ONE LIFE AND ONE HISTORY“ von Anneli Furmark. Die scheint mir in die Vorausgeherinnen-Kategorie „mostly women– mostly brave/fantastic/full of power and fantasie“ zu gehören. Sie ist 1962 in Schweden geboren und heute „a painter, illustrator and creator of graphic novels. She grew up in Luleå but now lives and works in Umeå, where she moved in 1991 to study at Umeå Academy of Fine Arts (MFA). After her studies she focused on her painting, but also had a strong passion for drawing and writing. This resulted in her first graphic novel, “Labyrinterna och andra serier” (2002), about growing up in a small town in the north of Sweden. A topic she keeps coming back to in many of her books, where the landscape, the people and also music, are strong actors.“
Fange mit der Übersetzung aus lauter Leidenschaft für die gleichen topics (Themen, Gegenstände) von hinten an. Furmark steht auch auf Landschaft, Menschen und Musik. Außerdem befasst sie sich damit, wie es war und ist, in einer Kleinstadt wie Luleå aufzuwachsen, nicht sehr weit unterhalb des Polarkreiseses, am Bottenviken (Bottnischer Meerbusen). Und sie versetzt sich als Malerin, Illustratorin und Schöpferin von Grafischen Romanen (graphic novels) in Cora Sandel/Sara Fabricius, „Putekass og Nattevanderen“. Dafür brauche ich jetzt das ganz dicke Lexikon, den fast 400-seitigen Gyldendal. Putekass ist – da hilft auch der Gyldendal nicht und auch nicht die werbeträchtigen Online-Übersetzer – vielleicht eine Schatzkiste und Nattevanderen meint eine, die auch nachts umherstreift. Und die beiden sind Furmarks Hauptdarstellerinnen in ihrer Darstellung von Saras Leben in Paris, wo sie Malerin wird, Armut und den Krieg erlebt. Furmark schafft es so, ein Leben, innerhalb dessen sich enorme gesellschaftlich – sowohl im individuellen als auch im europäischen Sinne – und „räumliche“ – gemeint sind Orte, Milieus und Kunstformen – Veränderungen zutragen in einer kurzen illustrierten Biografie zusammenzufassen.

Cora Sander in der Zeit, als sie noch Sara Fabricius hieß
Und so eine Siesta – so lehrt mich schon mit knapp 20 eine erfahrene Señora im Valenzianischen, sie serviert der alleinreisenden deutschen Señorita, die wie vom Himmel gefallen in ihrer Pension aufgeschlagen war, zur Nachhilfe Sangria und besteht aufs Austrinken und Ins-Bett-Gehen nach der Paella – bringt enorm voran. Heute habe ich im Sinne der Señora geschummelt und heimlich gelesen, nämlich über KATTER I PARIS (in Sandels Tiergeschichten für Jung und Alt), und weiß jetzt, warum Putekass in keinem Lexikon zu finden ist! Da hat sich in laut Sandel nur jemand versprochen, und statt Pusekatt (Muschi) Puttekass gesagt. Und so hieß das den Nutzer*innen des Pariser Hinterhofs zugelaufene Tier bei der zugewanderten Norwegerin. Furmark hat den Comic Strip für die Ausstellung im Perspektivet Museum geschaffen. Und dessen Direktorin, Marianne A. Olsen weiß, dass diese Kunstform zwischen Schreiben und Zeichnen Sandel gut gefallen hätte. „Zur Büchersammlung in ihrem Wohnzimmer gehörten total zerlesene Comics.“ Das sollte vielleicht nicht überraschend sein, wo sie selbst sich doch durch Wörter und Bilder ausgedrückt habe, schreibt Olsen. Und ergänzt, dass Sandel eine komplizierte Beziehung zu Biografien hatte und die Geschichten über Katzen, Vögel, Eichhörnchen, Hunde und Pferde in „Dyr jeg har kjent“ die nächste mögliche Nähe „in erster Person“ (Ich-Form) erlauben zu einer Tierliebhaberin, die schriftliche Lebensläufe ablehnte. Dann nehme ich jetzt also sara und Cora mit ins Hamam. Dort ist heute Frauentag. Bis später!
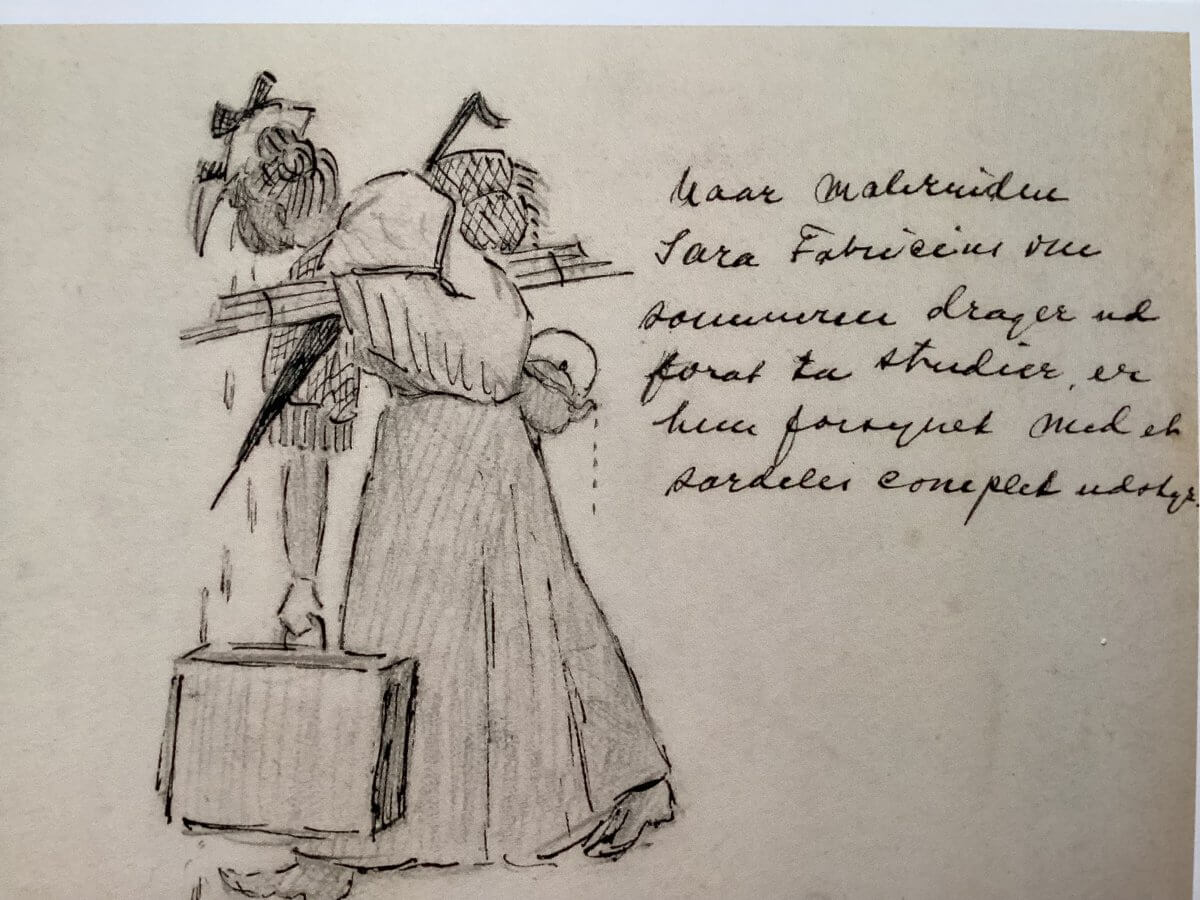
„Wenn die Malerin Sara Fabricius im Sommer für ihre Studien auszieht, ist sie bepackt mit kompletter Aussteuer“ Sara Fabricius
Nun ist der Bio-Comic ein wenig aufgeweicht – komisch war auch, dass mir dort im türkischen Bad ausgerechnet eine Spanierin eine Abreibung verpasste, so passen Begegnungen manchmal wie ferngesteuert zusammen – und ich bin nun aufgeklärter. Saras Vater war Seeoffizier, daher der Papagei Papen (der mich wiederum an ein Tier erinnert, dass ich kannte, unseren WG-Papagei, der immer so lange krakelte, bis wir ihn ins Esszimmer holten; Sandel hat recht: auch Vögel brauchen Familienleben). „Das Tragische mit Papen war seine Einsamkeit“, schreibt Sandel. Der Vogel erlebt 1892 mit Familie Fabricius die zehntägige Schiffspassage nach Tromsø. Dort zieht die zwölfjährige Sara in die Bankgata, gleich um die Ecke von der Rødbanken, wo vor ein paar Wochen mein Festival begann, aber den Sparkassenpalast gibt es damals noch nicht. Die feine und kalte Wohnung der Familie Fabricius befindet sich im ersten Ziegelgebäude der Stadt, deren übrige rund 7000 Einwohner*innen damals in Holzhäusern leben. Das Haus an der Bankgata 13 war zwölf Jahre vorm Einzug von Papen und Sara für den Walfangschiffbesitzer Johs. Giæver gebaut worden. Der ist selbst in der norwegischen Wikipedia schwer zu finden und lässt uns jetzt gewaltig abdriften: bis nach Spitzbergen. Dort, genauer, in der Nähe des Bellsundes im Westen des Archipels, der wiederum den Eingang zu einem weitverzweigten Fjordsystem darstellt, hatte er nämlich ein Sommerhaus (und das ist die einzige digitale Fährte zum Walfänger, der auch Konsul war). Seine fürs Privatleben eingerichtete Hütte stand am Recherchefjord (benannt nach der frazösischen Korvette La Recherche) und wurde auch «Giæverhuset» eine Walfangstation lag um die Ecke. Giævers „Winterhaus“ in Tromsø soll von einem deutschen Architekten für ihn entworfen worden sein. Später wird es berühmt – weil Cora Sandel dort gelebt hat – und berüchtigt – weil es Nazi-Hauptquartier wurde. Mittlerweile habe ich auf Grabbeltischen und in Tauschschränken tolle norwegische Romane ausgegraben, die alle etwas mit der deutschen Okkupation zu tun haben. Da steigern wir uns jetzt nicht hinein. Kommt noch früh genug.
Vor den beiden Kriegen, die sie erlebt, geht Sara mit ihren Freundinnen auf Tour, mit Skiern, Schlittschuhen oder Ruderboot und erobert sich Freiräume jenseits der Aufsicht Erwachsener. Die Freiheit scheint zeitlebens ihre drivkraft, treibende Kraft, zu sein. Handelt doch ihre Alberte-Trilogie (Alberte og Jakob; Alberte og friheten; Bare Alberte) von Aufbrüchen und Ausbrüchen und war den deutschen Besatzern zu freiheitsliebend. In den 1990ern kam heraus, dass die deutschen Nazis in Norwegen die Alberte-Trilogie zensierten. Nun gibt es eine Neuauflage. Um die Freiheit der jungen Sara war es zunächst schlecht bestellt. Gerne wäre sie auf eine weiterführende Schule gegangen, das wird aber nur ihren Brüdern erlaubt.
1901 zieht die Familie in ein Patrizierhaus von 1837. Im Norden und im Süden bilden die Betuchten in den Städten seit dem 13. Jahrhundert eine sozial relativ abgeschlossene Oberschicht, das Patriziat – eine Art städtischen Adel ohne Titel. Saras Patrizierfamilie lebt im Holzhaus an der Storgata 95 in viktorianisch eingerichteten Räumen. Wohnzimmer im Stil der Zeitgenossin Königin Victoria von England, die immerhin von 1897 bis 1901 regierte, heißen in Norwegen Klunkestua, das kommt vom deutschen Wort Klunker und verweist neben Kronleuchtern auf Troddel und Quasten. Das Perspektivet Museum hat einen Open-Air-Ableger in Tromsøs waldigem Volkspark am Nordufer der Tromsøa, südwestlich der City. Dort, nah am Sandnes-Sund steht Kvitnesgården, ein im 19. Jahrhundert auf einer anderen Insel errichteter Handelsposten, und darin ist so eine gute Stube zu besichtigen. Auch Fabricius malt so ein Interieur, mit Polstersessel und Spiegel. In der Klunkestua der Familie Fabricius regierte damals Saras Mutter mit stets kritisch forschendem Blick, den Furmark präzise im Comic festgehalten hat.

Noch eine Klunkestua aus dem perspektivet museum
Familie Fabricius zieht 1905 aus, Arbeiderforeningen, die örtliche Arbeiterorganisation macht 1911 aus dem Patrizierquartier an der Hauptstraße (Storgata) ein Folkets Hus (wörtlich übersetzt Volkshaus) mit Samfunnskafeen (Gemeinschafts-Café). Als dieses 90 Jahre später schloss, stand das Gebäude eine Weile leer, bis das Perspektivet Museum einzog.
Fünf Jahre später, mit 26 Jahren, macht sich Sara Fabricius, ihr Pseudonym legt sie sich erst in den 1920ern zu, auf nach Paris, wo sie sich ums Geld, um die Malerei, weiterhin ums Heizen, nun aber auch ums Abendbrot, um streunende Katzen und vor allem um ihre persönliche Freiheit kümmert, und beginnt „resebrev“, Reisebriefe, fürs Morgenbladet zu schreiben. Das erfordert jetzt eine ganz kurze schriftliche Exkursion: „Aftenpotten kommer altid efter morgenbadet“ lautet die erste Lektion in den 1970ern für uns Student*innen in Sachen norwegisches Zeitungswesen, in dem die beiden Blätter Aftenposten und Morgenbladet, nicht Morgenpost und Abendblatt wie in Hamburg, so eingesessen sind wies Töpfchen (Aftenpotten) und morgendliche Bad (morgenbad). Um mit Morgenbladet anzufangen: diese unabhängige Kultur- und Kommentarzeitung erschien seit 1819, wurde 1943 von den Besatzern aus Deutschland verboten, die auch die Redakteure inhaftierten, machte nach dem Zweiten Weltkrieg weiter bis zum Konkurs 1983.
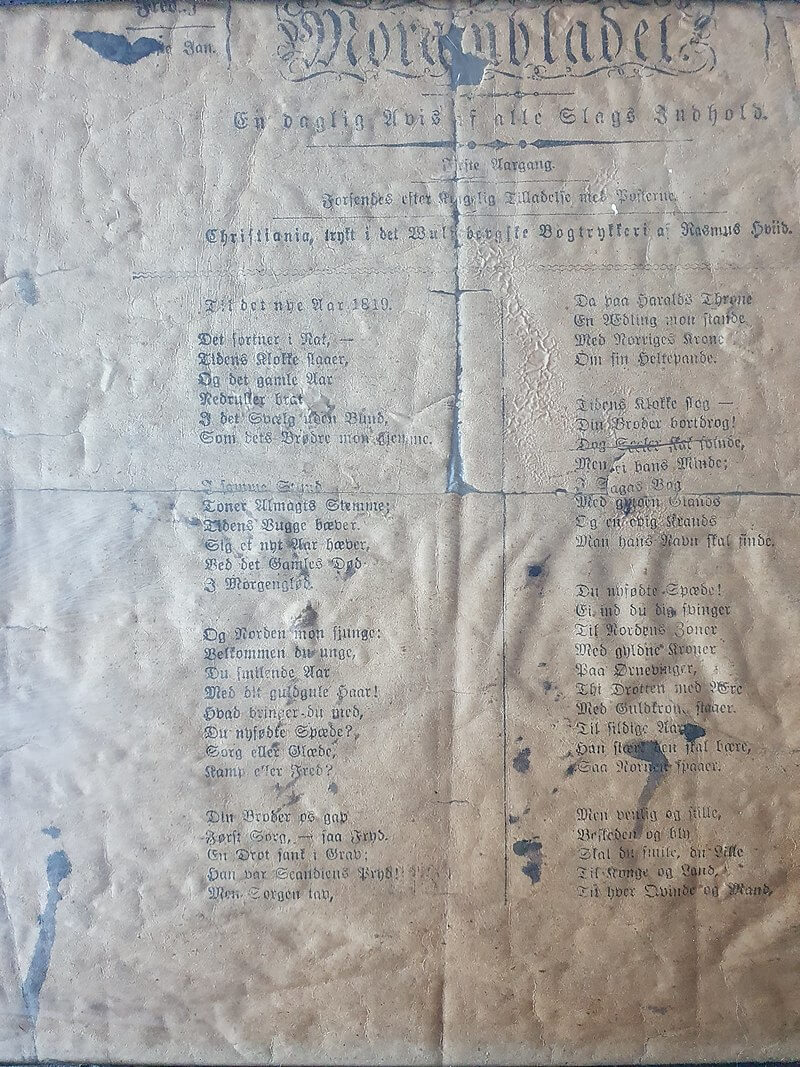
Morgenbladet Januar 1819, Av Kolbkorr – Eget verk, CC BY-SA 4.0
In den 1920er-Jahren bricht Fabricius Stück für Stück aus ihrer Ehe aus, gibt in Tromsø Privatlektionen in Französisch, publiziert ihre erste Novelle, trifft die Ärztin und Psychiaterin Eva Lagerwall, die ich für ihre Lebensgefährtin halte, vor allem weil Sandel und Lagerwall von 1947 bis 1960 in Uppsala zusammengelebt haben, und legt sich ihr Pseudonym Cora Sandel zu. Auch die Begegnung mit Karoline Mathisen hat Sandel wohl inspiriert, taucht Tromsøs erste Ärztin, die sich neben der hausärztlichen Praxis auch als Widerstandskämpferin gegen die Nazis, als Lobbyistin, Politikerin, Schreiberin, Redakteurin und Rednerin betätigt, sowie im Soroptimistklubb – die Soroptimistinnen, der Name kommt von sorores optimae, beste Schwestern, setzen sich für Frauenrechte, Gleichberechtigung, Bildung und Frieden ein -, doch in der Ausstellung auf.
Fazit: Sara alias Cora schreibt und schreibt. Der Stoff komme zu ihr, schreibt sie, „i livets Strom“, mit dem Strom des Lebens.
Hinreißendes Herausschlüpfen oder Verregnete Tomate
Fokus 2, Liegestuhl, 1. Reihe. FFN – Shorts 2, Astrid Aure, Programmdirektorin für FFN (Filme aus dem Norden beim TIFF) kündigt vier Weltpremieren und eine internationale an. Von der Regisseurin Camilla Figenschou, die in einem hochsensitiven Kurzfilm eine Frau zeigt, die sich inmitten von „normalem“ Familienleben draußen vor der Tür und in anderen Räumen der Rolle der Masochistin hingibt, weiß ich nun, im nahhinein, zig Begegnungen später, dass sie eine bei jungen Filmstudent*innen beliebte Lehrerin an der Arktischen Filmschule auf den Lofoten ist. Und im Kino wird plötzlich unser aller Hineinschlüpfen in und Herausschlüpfen aus Rollen greifbar. Ja greifbar. Wenn das als Wolf verkleidete Kind heult, wenn der Vater mit einer großen Hand in der Erde wühlt.
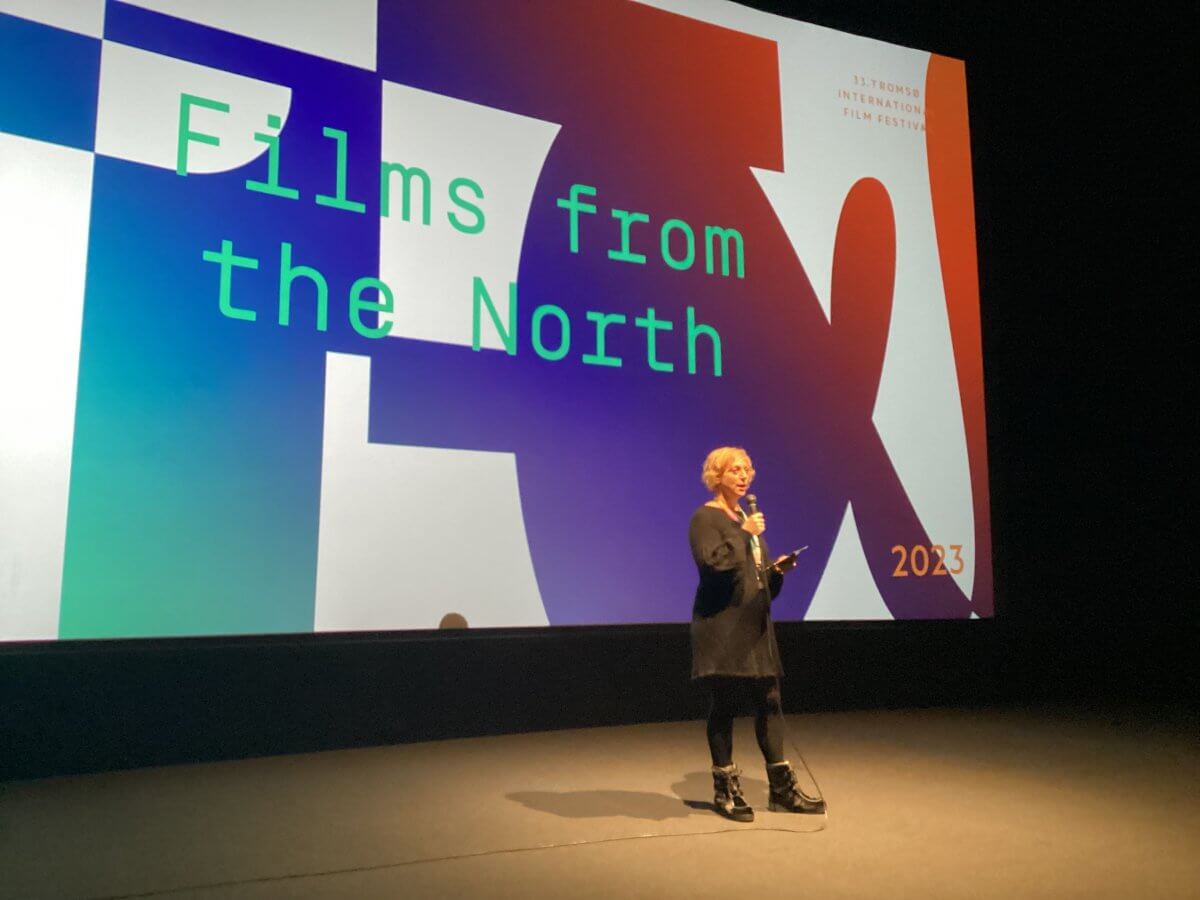
Astrid Aure, Programmdirektorin für FFN (Filme aus dem Norden beim 33. TIFF)
Der Film von Olha Tsybulska porträtiert Menschen im Krieg, nicht auf der Flucht, nicht an der Front, in ihrer Stadt. Und zeigt das Zerstörerische von andauernder Ungewissheit, die Versuche, der Angst ein Schnippchen zu schlagen und wirft die Frage auf, wem dieses ausgedehnte Desaster nützt. Tsybulska hat sich aufgemacht den Alltag ihrer Freund*innen zu zeigen – und zeigt den Krieg.
Geht es nur um eine Tomate in „Just a Tomato“? Hab ich den Laurens Pérol nicht gefragt. Der hätte vielleicht geantwortet: „Sometimes it´s better to say less“, wie beim Q & R (Fragen und Antworten) bei der Premiere. Seine kleine Geschichte ist der kürzeste Short des Festivals und hört sich in Worten ganz anders an. Er brauchte ein kleines Mädchen, ging in Bologna auf die Straße und fragte einen Herren: „Ist das deine Tochter?“ Die kleine Hauptdarstellerin sollte eine heruntergefallene Tomate von der Straße aufheben, es aber nicht dürfen. Sie machte ungeplant ihrem Vater eine Szene, rannte davon. So wird die Frucht zum Star. Mittlerweile weiß ich, dass Laurens nicht nur Regisseur, sondern auch Regenmacher ist. Er hatte einfach geplant, es solle geregnet haben. Und dann platzte der Gewitterschauer genau im richtigen Moment in den kurzen Dreh auf dem Markt in Bologna. „Das ist Filmemachen (editing)!“, sagt Laurens verschmitzt.
Regisseurin Polly Blag weiß, wie es um schwedische bestellt ist, sie ist Lehrerin. Es ist ihr erster Film. Als Alte romantisiere ich bestimmt meine frühe Jugend Ende der 1960er-Jahre, die hatte auf jeden Fall ihren spießigen und gewalttätigen Horror. Aber die Anforderungen von außen sind wohl nicht pausenlos auf uns eingeprasselt, wie bei einem Mädchen, das vom Aufwachen bis zum Einschlafen an seinem Online-Erscheinungsbild arbeitet. Und als alte Emanze frage ich mich – ja ich geb zu pädagogisch und besserwisserisch – wie es der Schönheitsindustrie gelingen konnte, so einen Rückschlag in Sachen „mein Gesicht gehört mir“ zu erzeugen.

Am Abend schwirrt mir der Kopf, muss mich erden, vielleicht auch lüften und wässern. Es zieht mich mit Macht auf die Brygga. An den Hafen. Den Hafen mit Bergblicken. „Hi, are you one of the filmmakers?“ So werde ich im Kaia begrüßt, der Kneipe am Kai (im Nachhinein erfahre ich, dass meine derzeitige Lieblingsstadt über mehr als zwei Kilometer Kai verfügt!), für ein paar Tage mein Stammlokal. Die Kellnerin kommt aus Lettland, studiert an der UiT und volontiert beim TIFF. Ich mache ja nur innerlich Filme und lächle einfach geheimnisvoll, während sie mich zu meinem Tisch mit dieser fabulösen Aussicht bringt. Das Kaia liegt gut, gleich um Ecke vom Stortorget, dem größten Platz, auf der Brygge, das ist das norwegische Wort für Kai. Über dem Restaurant, das zugleich Pianobar und Diner ist, befindet sich das Hauptkontor von Norges Råfisklag (wörtlich übersetzt: Rohfischgesellschaft), der 1938 gegründeten Verkaufsorganisation der norwegischen Fischer*innen.
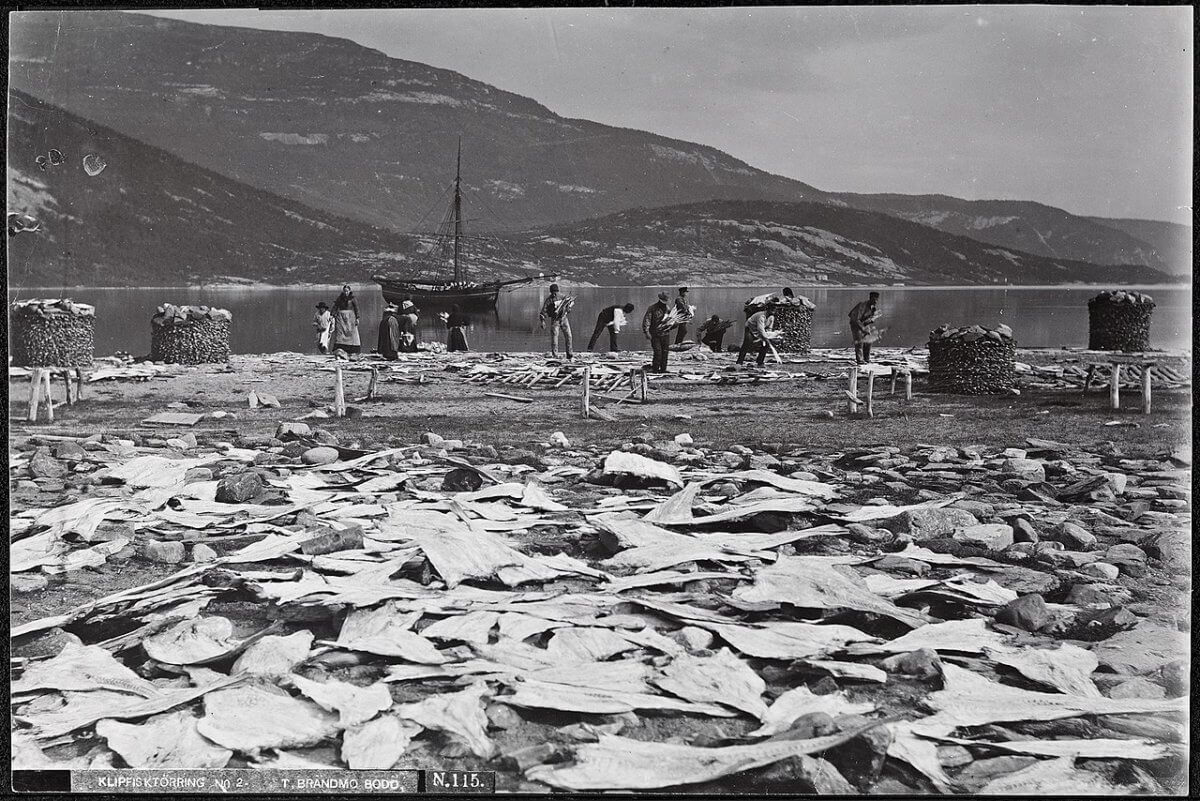
Trocknen von Klippfisch in Nordland, Foto: T. Brændmo, Bodø/ Nasjonalbiblioteket, Av Nasjonalbiblioteket from Norway – N. 115 Klipfisktörring No 2Uploaded by palnatoke, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26765042
Und im Kaia wird klippfisk serviert. Der heißt auch tørrfisk und ist eine norwegische Spezialität, seit langem, denn durch Salzen und Trocknen konservierter Fisch gehörte für Jahrhunderte zum Proviant, ohne den lange Seereisen unmöglich gewesen wären. Die altnordische Literatur, bekannt als Sagas, berichtet von einem Mann, der im 9. Jahrhundert von den Lofoten nach London segelte, mit Trockenfisch (tørrfisk) als Proviant und Handelsware. Und auf den Lofoten – früher auch anderswo, auf dieser Inselgruppe bis heute – werden die Fische auf Gestelle gehängt. Die wiederum stehen oft auf Schären (felsigen Inseln) und anderen Klippen, daher der norwegische Name klippfisk. Der wird drei Monate im Freien getrocknet, wobei Temperaturen um die Null Grad und etwas Schnee – diese Bedingungen bietet das Klima der Lofoten – für die Konservierung am geeigneten sind. So hängt das alles zusammen: das norwegische Wort für Dorsch, torsk, hingegen leitet sich vom altnordischen turskr ab, was wiederum tørrfisk, also Trockenfisch, bedeutet. Und der Bacalau, der in meinem Hamburger Stadtteil Altona eine Spezialität der vielen Portugies*innen ist, die hier wohnen, ist auch nichts anderes, denn Norwegen beim Trockenfischexport eine Monopolstellung. Jetzt kommen wir zu den feinen kulinarischen Unterschieden:
Klippfisch (klippfisk) – konservierter Seefisch, meist Kabeljau – wird vor der Trocknung stark gesalzen. Stockfisch hingegen wird ausschließlich luftgetrocknet. Zur Zubereitung muss der Trockenfisch einige Tage in Wasser eingeweicht werden, dabei erreicht er fast wieder seine ursprüngliche Größe. In der Küche des Kaia wird er dann mit der „hauseigenen Mischung“ paniert und mit Salat und Pommes serviert.
Es gibt dort auch hvalbif (Walfleisch) serviert,. Es stammt vom Minkwal oder Zwergwal,(Balaenoptera acutorostrata). Als die Großwale – Grönland-, Grau-, Blau-, Finn-, Pottwal und andere – in den 1960er Jahren weitgehend ausgerottet waren, stiegen manche auf die Jagd von Zwergwalen um. In den vergangenen Jahren wurden von Norwegen, Japan und Island jährlich rund 1200 Zwergwale gefangen. Die Norweger essen hvalbif gerne gegrillt. Mir ist nicht danach, nie. Ich studiere weiter die Speisekarte. reinskav (finnbiff) kommt für mich als „nachhaltige Manchmal-Fleisch- und Fischesserin“ in Frage. Es ist eine uralte samische Zubereitung von Rentierfleisch. Als die ersten Samen in Kontakt mit Zuwanderern und Reisenden kamen, nannten Letztere sie oft Finnen, daher der Name finnbiff. Dafür wird heutzutage das Fleisch in Streifen geschnitten, als Ragout zubereitet, und mit Erbspüree, Preißelbeeren und Kartoffeln serviert.

Chef dieses freundlichen Ladens ist Richard. Er steht vorm Panoramafoto mit langer und breiter Aurea borealis und sagt: „Das Nordlicht kommt nur, wenn einer es nicht erwartet“, zeigt mir auch die Brauerei, das Bier kommt Arktis-gekühlt vom Dach, erzählt, dass es donnerstags und freitags immer Live-Musik gebe, zeigt aufs große Piano. Diesmal schaffe ich es nicht, muss ja ins Kino. Noch ein Grund, nochmal nach Romsa zu reisen. Ich gucke über Arktis-taugliche Yachten auf die verschneiten Berge von Tromsøs Stadtteil Tromsdalen auf der Walinsel gegenüber. Dort befinden sich auch der Storsteinen (421 Meter) und der Tromsdalstinden (1238 Meter). Das wusste ich aber an jenem zauberhaften tiefdunklen Abend noch nicht. Ich reise erst und lese später, das gibt mehr Raum zum Wundern:).
lausche Donnerstag, den 19. – 10:00 – Árran 360 Grad –
vorher steige ich schon recht routiniert im Umgang mit den Öffies der Tromsoya, die scheinbar bei absolut jedem Wetter fahren, an der Haltestelle Polaria aus dem Bus. Dort steht polaria.no, eine der Attraktionen der Stadt, die ich unbedingt noch besichtigen möchte, beim nächsten Mal, ein naturkundliches Museum und Aquarium. Dort schwimmen unter anderen Bartrobben (Erignathus barbatus),mit bis zu 360 Kilo die größten arktischen Robben, und Seehunde (Phoca vitulina).

Geir Eidissen und Herbjorg Valvåg im ÁRRAN
An der Haltestelle am südlichen Ostufer der Insel, auf dem Strandvegen, laufe ich in Geir Eidissen und Herbjorg Valvåg hinein. Meine das im emotionalen Sinne, ich rutsche dank Isbrodder nicht mehr aus, auf den kleinen Eisbergen der Bürgersteige. Das Paar ist auch auf dem Weg zur 360 Grad-Vorführung ÁRRAN – The Story auf dem Theaterplatz vorm Hålogaland Theater. Wir haben noch ein wenig Zeit, verbringen sie ins Gespräch vertieft in der kaféscene des Theaters. So erfahre ich, dass Herbjorg nach Jahrzehnten in der Parteipolitik ( Sosialistisk Venstre parti sv.no)mit Massen von Pflichtlektüre weniger lesen möchte und mit über 70 Aktivistin wird. Wir sind nicht nur bezüglich des Alters Genossinnen, stellt sich heraus, und das empfinde ich bei Ähnlichaltrigen recht selten. Wir haben uns unendlich viel zu erzählen. So stehen wir in der und wissen gar nicht, wo anfangen mit unserem privaten Storytelling. Herbjorg erzählt, dass die riesige Stickerei von Britta Marakatt-Labba in Tromsø hänge, in der arktischen Universität UiT. Marakatt-Labba ist wie wir 60++-Aktivistin. Ihr Protest gegen den Alta-Staudamm endete 1981 im Gefängnis. Auf ihrer Stickerei fliegen Krähen über die Protestierenden in Alta, und als sie landen, verwandeln sie sich in Polizisten. Das Kunstwerk vermittelt, wie die staatliche Autorität nach den Stromschnellen, dem Land und der Freiheit griffen – und die Elektrizität fürs eigene „Empowerment“ nutzten. Herbjorg Valvåg ist beeindruckt vom künstlerischen und politischen Werk dieser samischen Künstlerin,
Geir, wir drei sind sofort beim norwegischen Du, hat Ella Marie Haetta Isaksen damals im Fernsehen gesehen, vor allem gehört, als sie beim Stjernekamp ihren Joik Máze sang – bei dem ihre Vorfahren hinter ihr standen: „ich hatte nichts damit zu tun, kann nicht für irgendetwas verehrt werden … ich stellte mich nur dem Joik zur Verfügung, hatte ich gerade am Vorabend in Isaksens Buch gelesen über diese Initiation zur Botschafterin der Sámi ihrer Generation – und ist beeindruckt von der riesigen Kraft der Multikünstlerin.
Herbjorg empfiehlt den TIFF-Film „Memory of water“. Dessen finnische Filmemacherin, Saara Saarela gehört unbedingt in die Kategorie „mostly women – mostly brave – mostly fantastic“ und wir landen bei den Ressourcen, einem ganz zentralen Thema auch für Herbjorg, als Politikerin der Sosialistisk Venstreparti (www.sv.no), der sozialistischen Linkspartei. Das ist Norwegens einzige rotgrüne Partei und für mich die derzeit einzige dieser Couleur europaweit, die wirklich den sozialen und ökologischen Fortschritt gleichzeitig vorantreibt. Rotgrün hat in Norwegen einen ganz anderen Geschmack als in Deutschland, einen frischeren und zukunftstauglicheren. Bin ganz neidisch – und bleibe erstmal in der APO (außerparlamentarischen Opposition).
Die SV schreibt, Norwegen stünde vor großen Herausforderungen, u.a. einer ökonomischen Krise als ölabhängiges Land, das eine neue Wirtschaft errichten müsse, um zu überleben und einer „Ungleichheitskrise“ mit steigender Ungerechtigkeit in Sachen Macht und Reichtum. Die SV betont ganz in meinem Sinne: „Wir brauchen einen neuen politischen Kurs, bei dem Interessen und Bedarfe der gewöhnlichen Menschen und die Grenzen dessen, was die Natur verträgt, Vorrang haben. Für die Vielen – nicht für die Wenigen. Hjerborg und ihre Genoss*innen kämpfen für eine Gesellschaft mit echter Gemeinschaftlichkeit (felleskap) und einen gerechten grünen Wandel. Sie konzentriert sich auf die Fischereipolitik, aber diese Debatte müssen wir noch ein Weilchen aufschieben.

Samische Familie vor ihren Zeltkoten, um 1900
Da fällt mir der Spruch ein, den Katja Gauriloff, Macherin von Je´vida uns bei den Nordischen Filmtagen verriet: Wie lautet die korrekte Antwort auf die Frage, wer zur Familie deiner Urgroßeltern gehörte? „Viele Eltern, viele Kinder und ein fotografierender Ethnograf“. Und da Letzterer von den Sámi meist Schwarzweiß-Aufnahmen machte, eignet sich Gauriloff in ihrem Spielfilm – einem der absoluten Highlights der 65. Nordischen Filmtage – das Farblose sehr eigensinnig wieder an.
Denn nun stapfen wir erstmal in diese ganz spezielle TIFF-Spielstätte, das ÁRRAN 360 Grad. Es sei ein Hybrid zwischen „urfolksfortellinger og innovativ teknologi“ – wobei sich Ersteres als Storytelling der Indigenen übersetzen lässt. Es sei auch das erste Mal, dass sechs 360-Filme von sechs samischen Künstler*innen präsentiert würden. Es sei auch das weltweit größte Lávvu und mit einer 28 Meter langen Leinwand (die hier im Zelt wieder richtig etwas von Leinwand kriegt). Und ein Lávvu gehört auf Deutsch zu den Koten, was wiederum laut dewiki.de im deutschen Sprachraum eine Sammelbezeichnung für alle traditionellen Behausungen der Samen Nordeuropas ist – sowohl für die stationäre Hütte (Torfkote, Goahtie, Gåetie, Gamme u. a.) als auch für das mobile Zelt (Zeltkote, Lávvu u. a.). Das hätten wir schon mal.
Und das nordsamische Wort Árran beschreibt das Herz des Lávvu, quasi die Mitte der Mitte, wo seit ewigen Zeiten das Geschichtenerzählen stattfindet, auf dem die gesamte samische Kultur basiert. Denn das geschriebene Wort kam spät hinzu, in Romsa und umzu. Und uns flogen dort Initiationsfetzen um Augen und Ohren im ÁRRAN 360 Grad. Es ist also eine Art Feuerstellen-Simulation, dieses „Digital Sámi storytelling“ im Lávvu, das nun, so steht’s im Programm, nun nach der Premiere bei der Biennale in Venedig im August 2022 nach Hause, nach Sápmi gereist sei und seine Norwegen- und Sápmi-Premiere beim TIFF bekomme.
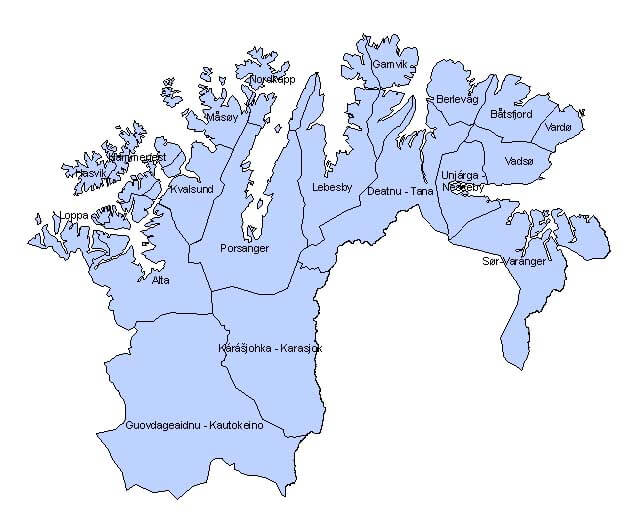
Kommunen in der ehemaligen und morgigen Provinz Finnmark CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=294159
Die jungen samischen Filmemacherinnen – okay, es war auch ein Mann darunter -, deren Werke uns eisige Polarwinde ins Hirn bliesen und uns hinrissen in weite Welten, arbeiten im INTERNATIONAL Sámi FILM INSTITUTE (isfi.no), das das Volk der Sámi mit den Fähigkeiten und ökonomischen Möglichkeiten ausstatten will, die es braucht, um samische Filme in samischer Sprache zu entwickeln, zu produzieren und auf die Leinwand zu bringen. Das ISFI befindet sich Guovdageaidnu (norwegisch Kautokeino) südwestlich von Tromsø in der ehemaligen Provinz Finnmark (deutsch „Feld der nordsamisch Finnmárku, kvenisch Ruija), die am 1. Januar 2020 in die Provinz Troms og Finnmark übergegangen ist, jedoch am 1. Januar 2024 durch die erneute Aufteilung in zwei Provinzen wieder auferstehen soll. Sie ist Norwegens größte, am dünnsten besiedeltetste (in der Mehrzahl sind die Einwohner*innen Sámi) – und kälteste. Dort liegen die Messstation mit den tiefsten Temperaturen des Landes und Finnmárkkoduottar, die Vidda (vidd, vidde bedeutet auf Norwegisch Weite oder weite öde Strecke), mit 22.000 Quadratkilometern Norwegens größtes Hochplateau, vollständig nördlich des Polarkreises, teilweise tatsächlich kahl und öde, teilweise mit Birken- und Kiefernwäldern bewachsen. Der Rest ist Tundra (samisch Tūndar, dieses Lehnwort aus dem Russischen – тундра – bedeutet Kältesteppe), offene, baumfreie Landschaft, wo Flechten, Moose und Gräser wachsen, Polarfuchs (Vulpes lagopus), Schneeeule (Bubo scandiacus) und -huhn (Lagopus muta), Vielfraß (Gulo gulo) und Rentier (Rangifer tarandus) leben.

Berglandschaft in der Westfinnmark, Von Koco C., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59912706
Die ISFI-Filmemacher*innen betrachten sich zu Recht als Expertinnen für „Sámi storytelling“, als Feuerstelle, an der die samischen Erzähler*innen sich versammeln, um sich mit der Vergangenheit zu verknüpfen und die Zukunft zu erschaffen. Diese sechs samischen Geschichten packen uns an fast allen Sinnen, wir kriegen viel zu fühlen an diesem Morgen.
Grenzenlose Gleichheit und Kraftvolle Kulte
Elle Márjá Eira (ellemarja.com) ist Rentierhirtin, Joikerin und Filmemacherin und folgt mit dem Film Eallu/Girdnu der Herde ihrer Familie. Wir befinden wir uns mitten im Girdnu, wo kreisförmig angeordnete Zäune in einen Pferch führen, wo die Rentiere gesammelt, getrennt und markiert werden. Im Arran 360 Grad bewegen sie sich um uns Zuschauer:innen herum, mit sicherster Hand dirigiert von Hirtin und Regisseurin.

Eallu/Girdnu von Elle Márjá Eira, zu sehen bei den diesjährigen (2024) Nordischen Filmtagen in Lübeck, im Infinity Dome, am Mittwoch, den 6. November um 15:30 Uhr und am Donnerstag, den 7. November um 18:00 Uhr
Auch Ann Holmgren Aurebekk kann zaubern. Und zwar mit dem kleinen Finger. Bei der Reise in ihre Anderswelten erfahren wir, dass jede noch so winzige Bewegung in dieser Welt dort widerhallt, eine direkte Resonanz hat in unzähligen Reichen. „Wenn wir wirklich tief in den Menschen hineinsehen könnten, würden wir sehen, dass von jeder seiner Adern und Fasern zahllose Welten abhängen“, heißt es in einer samischen Weisheit. Ihren Film Ovias beleben wundersame Wesen. Und Menschen aus dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist.

Ovias von Ann Holmgren Aurebekk
Zu diesem Film passt die Frage auf der Rückseite des „ÁRRAN 360 Grad – The Story“-Programms: Bist du dir bewusst, dass die äußerste Schönheit mit den Augen nicht zu sehen ist? Sie stammt von einem samischen Dichter, dem Finnen Nils-Aslak Valkeapää, in der nordsamischen Sprache Áillohaš genannt. Dieser Künstler gilt in Sápmi als kulturelle Ikone und „Nationbuilder“, Innovator des samischen Joik und der bildenden Kunst der Sámi, sowie Pionier in deren Poesie und Klangkunst. Wie er es selbst ausdrückte: „In unserer kulturellen Tradition ist jeder ein Künstler … Die Lebensweise ist Kunst.“

Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš Beattegis, 1991 / Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš in Beattet/Pättikkä, Foto: Rolf Chr. Ulrichsen/Aftenposten /NTB scanpix
Hans Pieski gibt uns einen Flow-Kurs zur Kraft des Wassers, treibt uns durch die Zirkel von den winzigen Flocken, die angesichts der Macht der Sonne dahinschmelzen bis zum Wasserkraftwerk. In seinem anderen Leben unterrichtet er Fliegenfischen in Ohcejohka (finnisch Utsjoki) im äußersten Norden Finnlands, an dessen Grenze zu Norwegen. Die Grenze bildet der Deatnu (aus dem Nordsamischen übersetzt: Großer Fluss; norwegisch weiblich: Tana oder Tanaelva (-a = weiblicher bestimmter Artikel); finnisch Tenojoki; norwegisch-finnischer Grenzfluss), ein Gewässer der Superlative. In Sachen Fliegenfischen hat Pieski dort einen der weltweit besten Fischgründe für Lachse vor der Haustür. Und ich hoffe ich bin keinem Anglerlatein aufgesessen bezüglich des 36 Kilo schweren Salmo salar (atlantischer Lachs), der dort 1929 gefangen worden sein soll. Außerdem haben wir es hier mit der nördlichsten Flussmündung Europas und einem seiner größten Flussdeltas zu tun.

Dort wurde schon von jeher viel fotografiert und Fischergarn gesponnen. Und eine kann sich gut vorstellen, wie der Künstler zu seinem surrealen und aufwühlenden Film – der Titel Muohtacalmmit bedeutet Schneeflocke – über die Macht des Wassers und unsere Abhängigkeit von diesem Element gekommen ist. Habe als Hydrobiologin schon viele Darstellungen des universalen Wasserkreislaufes zu sehen bekommen, aber noch nie eine so ergreifende.

Ohcejohka (finnisch Utsjoki) im äußersten Norden Finnlands, Saamelaisia kirkkotuvan edustalla / Sámi people in front of a church n. 1930-luku / c. 30’s, Utsjoki silver gelatin print / hopeagelatiinivedos The Finnish Museum of Photography / Suomen valokuvataiteen museo Contact / Ota yhteyttä: fmp@fmp.fi
Dann ist wieder eine junge Multimedia-Künstlerin dran. Von Textilien über Installationen, Kollagen bis zum Video greift Liselotte Wajstedt zu allem, was uns auf neue/alte Wege bringt). Ihr Film Eadni/Mother zerrt mich zu meinen Wurzeln. Die Háldi, eine mythologische Waldgestalt der Sámi bringt mir in Erinnerung, woher ich komme und wohin ich gehe, dieses Ein- und Aufgehen in Flora und Fauna, Versinken im Humus beim Pilzesammeln als Kind, nackt auf der warmen pieksenden Heide in Dänemark, zwischen Multebeersträuchern auf der kleinen Insel im norwegischen Brønnøysund, wo wohl meine Entscheidung, Biologin zu werden, reifte, dieses ganz tiefe Einschlafen unter hohen Buchen im norddeutschen Wald. Als das Mädchen tiefer in den Wald hinein geht, erscheint es fast, als ginge nicht sie in den Wald, sondern der Wald mit ihr. So arbeitet Háldi, sie holt uns. Im guten Sinne. Wajstedt (liselottewajstedt.com) schreibt: „Wer ist sie? Ist Háldi nur ein Teil der Sámi-Mythologie oder ist sie so real wie du und ich?“ Sie sei Teil des Waldes, Teil des Ökosystems. Die Kinder würden von ihr gelockt, Teil der Natur zu werden. Diese Geschichte erzähle sie „in der Hoffnung, dass wir die Natur schützen und sicherstellen werden, dass sich der ewige Kreislauf fortsetzt. … Wir kennen unser Land. Das ist unsere Antwort. Der Grund mag schwanken, aber die Verbindung ist stärker.“ Da wirkt wohlmöglich Háldi mit.

In Eadni/Mother von Liselotte Wajstedt begegnet das Mädchen der Waldfrau Háldi
Von der Waldfrau zur Meerfrau. Marja Helander steht zwischen der Sámi- und der finnischen Kultur, ihre Mutter ist Finnin, ihr Vater Same aus Ohcejohka (finnisch Utsjoki, siehe oben). Ihre Áfruvvá, ein Seewesen aus der samischen Mythologie, steigt aus dem Wasser und wühlt sich durch eine müllbedeckte Welt, die Hinterlassenschaft der soeben ausgestorbenen Species Homo sapiens (sapiens steht für verstehend, verständig, weise, gescheit, klug, vernünftig und passt nicht mehr richtig) , darunter ausgestopfte Tiere.

Áfruvvá/Mermaid von Marja Helander
Siljá Somby lüftet mir an diesem Vormittag mal kurz die Schädeldecke. Mit ihrem Film Daate Dijjien über die weltenumspannende Kraft der goavddis, meavrresgárri (englisch rune drum). Giitu! Das ist das samische Wort für danke. Habe es von Asta aussprechen gelernt. Rund um uns herum ertönen die Schläge. Und die heilige 360-Grad-Percussion rüttelt an den Synapsen.
Und wieder stoße ich, von den arktischen Begegnungen belebt, auf eine Meisterin: Caroline Maxelon ist Magistra artium (M.A.) der Ethnologie (Völkerkunde), Autorin, Künstlerin und „räucherkundige und naturspirituelle Jägerin“ (bussardflug.de). Sie beschreibt die „klassische Sámi-Trommel“ als Kraftobjekt und Kultgegenstand. Dieser Kult hat nichts mit dem Hauptwort Kultstatus oder dem Eigenschaftswort kultig zu tun, es handelt sich um religiöse Handlungen. Im Religiösen stecken so viele Weltanschauungen, dass wir uns da hier und jetzt nicht reinlesen wollen, nur kurz: es gibt eine Vielfalt von interessanten Religionssystemen, die nicht wie Meller und Michel in ihrem Buch über die Schamanin von Bad Dürrenberg erläutern, mit dem Glauben an Götter, „also überirdisches Personal von großer Macht“ zu tun haben. „Moralisierende Götter“ tauchten nämlich erst so spät in der menschheitsgeschichte auf, dass sie nicht in unserer „an sich egalitären Natur“ verwurzelt seien. Egalitär kommt vom lateinischen Wort aequalitas für Gleichheit. Die Wissensträgerin von der Saale und die samischen Nomadinnen am nördlichenPolarkreis – Meller und Michel berichten auch darüber, dass nomadisierende Gruppen in Eurasien grenzenlos und gleichberechtigt vernetzt waren – lebten in Gruppen, deren Mitglieder (egal welchen Geschlechts:)) grundsätzlich alle den gleichen Zugang zu den zentralen Ressourcen (Mitteln, Quellen) wie Nahrung, Wasser, Land usw. hatten und in denen kein Mitglied (egal welchen Geschlechts:)) dauerhaft Macht über andere ausüben konnte. Solche Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften nennen wir heute egalitär. Zurück zum Kult. Maxelon präsentiert uns in ihrem Buch „Schamanische Kraftobjekte aus der Natur – Ihre Wirkung kennen, mit Ritualen die Seele stärken“ in verschiedener Weise kundig Kultgegenstände, die in spirituellen und magischen Ritualen verwendet werden. Im Titel stecken Spiritualität und Magie, beides ist gerade voll kultig und hat Eingang in die zauberfreie Marktwirtschaft gefunden. Wir fangen mit der Spiritualität an und betrachten dieses subjektive Erleben jetzt mal wissenschaftlich, als geistige Suche. Die allerdings hat etwas mit dem Überschreiten (Transzendieren) der Grenzen der materiellen Welt zu tun, mit dem Einlassen auf mit den Sinnen nicht fassbare und wissenschaftlich nicht erklärbaren Erlebnissen. Das Magische gilt heute als – wissenschaftlich von der Religion nicht klar unterscheidbare – Kunst, übernatürliche Wirkungen zu erzielen. Wie auch immer. Auch mit Trommeln. Ich durfte im südwestlichen Sibirien, in der Republik Altai, (russisch: Горный Алтай, Gornyi Altai, das bergige Altai), wo die meisten Bewohner naturreligiöse Kulte praktizieren, erleben, wie es sich anfühlt, von hinten und von vorne betrommelt zu werden. Das vergisst mein Körper nie, dieses mit dem Verstand nicht erklärbare Erlebnis am Fuße des Altaigebirges. Und meinem Geist hat sich eingeprägt, wie unterschiedlich diese beiden altaischen Wissensträger*innen – шаман (šamán) bedeutet in der Sprache der sibirischen Urvölker „jemand, die oder der weiß“ – die Teilnehmer*innen dieses schamanischen Rituals mit ihren Trommeln behandelten.

Daate Dijjien von Silja Sombi
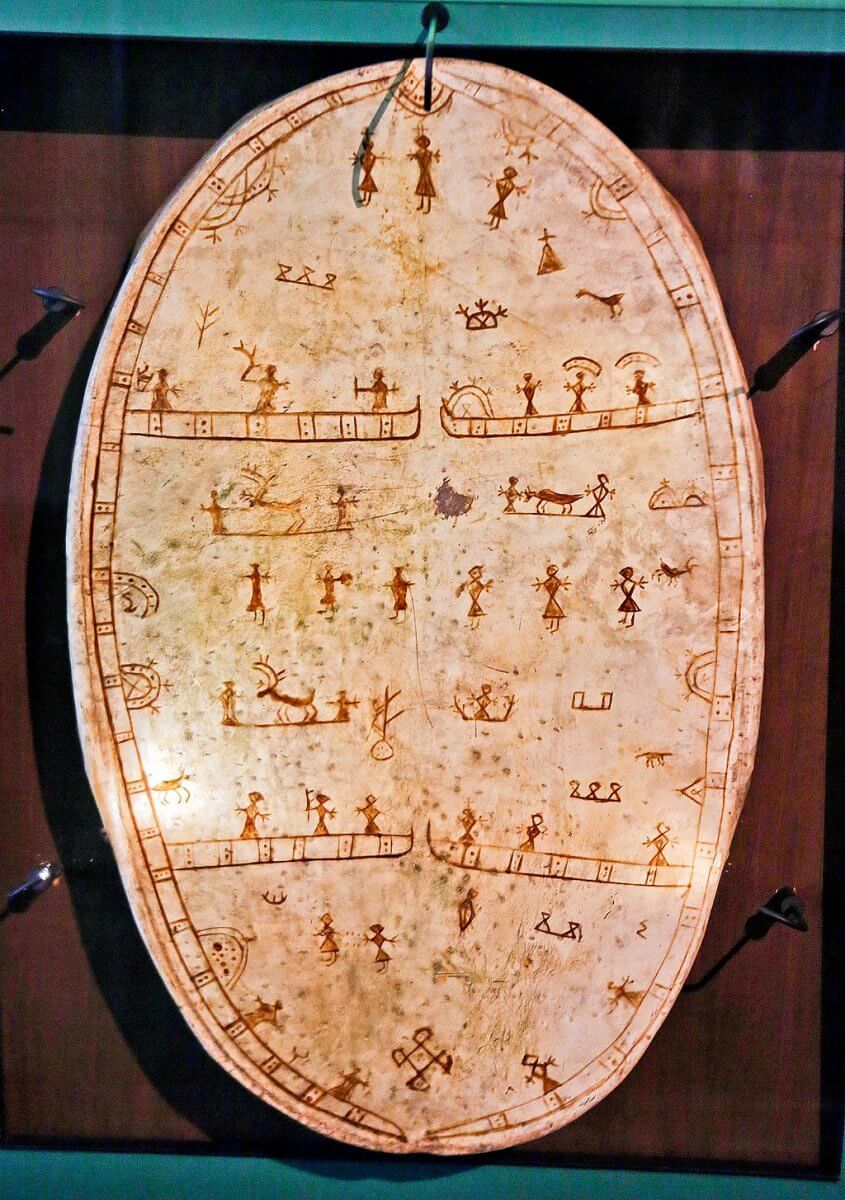
Siida ist das samische Wort für Gemeinschaft und die samische Gemeinschaft hat im Zuge der längst fälligen Rückgabe von Alltags- und Kultgegenständen einige wenige Trommeln erhalten. Die meisten wurden nach der Ermordung des/der Eigentümer*in verbrannt oder anders zerstört oder gelangten zu Zeiten der Christianisierung und Kolonialisierung in die Raritätenkabinetts des europäischen Adels – und später in die Museen.
In Sombys Film befreien Sámi die von einem sogenannten Schwertbruder (die Christianisierung Skandinaviens erfolgte von oben und meist durch Zwang = Schwertmission) entwendete heilige Trommel aus einer Kirche. Die Ahn*innen stoßen direkt aus dem Nordlicht zu ihnen. Diese starke Szene verschlägt uns in die Zeit der Christianisierung, die im norwegischen Teil Sápmis im 13. Jahrhundert begann. „Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Sámi in ihrem Lebensraum von einer intensiven lutherischen Missionierung überrollt.“ Ihre enge Naturbezogenheit, ihre Rituale und ihre Vorstellung von einer belebten Seelenlandschaft wurden als Heidentum verdammt.

Bild eines Noaiden im Arktischen Universitätsmuseum in Tromsø
Im Zuge der Zwangsevangelisierung mussten die Noaidi ihre Arbeit einstellen. Viele heilige Trommeln wurden zerstört, wenige ins Museum gebracht, wie die 1691 von Poala Ánde konfiszierte. Er lebte in Čáhcesuolu (Vadsø) am Varangerfjord, in einer Gegend an der Barentssee im äußersten Nordosten Norwegens, das damals zu Dänemark gehörte, weshalb es auch anderssprachige „Autoritäten“ waren, die dem Noaiden, den sie in ihren Sprache Anders Poulsson oder Paulsen nannten, seine heilige Trommel entwendeten. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts starben in der Finnmark und auch in Vadsø viele Frauen bei sogenannten Hexenprozessen. Auch Poala Ánde wurde wegen Hexerei verurteilt. Nach offiziellen Aufzeichnungen sagte er, seine Mutter habe ihm beigebracht, wie die Trommel zu benutzen sei, weil er „den Menschen in Not und Bedrängnis helfen wollte und ihnen mit seiner Kunst Gutes tun“. Seine Trommel wurde ins Königliche Kunstkabinett in Kopenhagen verschleppt und ist „nach 40 Jahren Kampf“, wie Jelena Porsanger, Leiterin des Sámi Museums in Kárášjohka (Karasjok), sagt, zurückgekehrt nach Sápmi. Sie sei, sagt Porsanger, und im Grunde kein materielles Objekt. Die Sámi würden so eine heilige Trommeln als Persönlichkeiten ansehen und sehr hoch schätzen, „weil sie unsere Geschichte repräsentiert, unsere Werte und Kultur – aber sie ist auch ein Zeichen der Kolonialisation und der ungleichen Machtverteilung.“ Zum Instrument, mit dem sich Poala Ánde in Trance versetzte, mit dem er zu den Geistern reiste und heilte, ist mit einem Trommelhammer und einem Ring, einer Art Zeiger für bestimmte Symbole versehen. Die Zeichnungen auf dem Fell entsprechen dem nordsamischen Muster, sind jedoch individuell. Die verschiedenen darauf dargestellten Schichten entsprechen verschiedenen Ebenen in der spirituellen Welt, die der Noaidi aus eigenem Erleben kannte. Diese Trommeln seien wie Bibeln, sagt Somby, jede habe ihre eigene und einzigartige Ausstattung mit Bedeutungen und Symbolen.
Heute existieren in europäischen Sammlungen noch etwa siebzig Sámi-Trommeln, versehen mit vielstelligen Nummern. Diese Ziffernreihen erscheinen und verschwinden in Sombys Film. Die Trommeln erzählen uns den Rest. Und ich bin jetzt neugierig auf die Drehbuchautorin und Regisseurin. Finde sie in nordicwomeninfilm.com . Diese Datenbank umfasst weibliche Filmschaffende aus Dänemark, Norwegen und Schweden und will„ein großes Stück unbekannte Geschichte“ vermitteln, die der Rolle und Bedeutung der Frau in der Filmindustrie. „Wir wollen über die Filmgeschichte aus feministischer Perspektive schreiben und sie umschreiben“, heißt es auf der Site. Über Somby erfahre ich, dass sie 1971 in Deatnu (norwegisch Tana), einer Gemeinde, deren Einwohner größtenteils Sámi sind, geboren wurde und sich neben Drehbüchern und Regie der Weiterentwicklung der samischen Filmproduktion widmet. Giitu, Silja Somby!
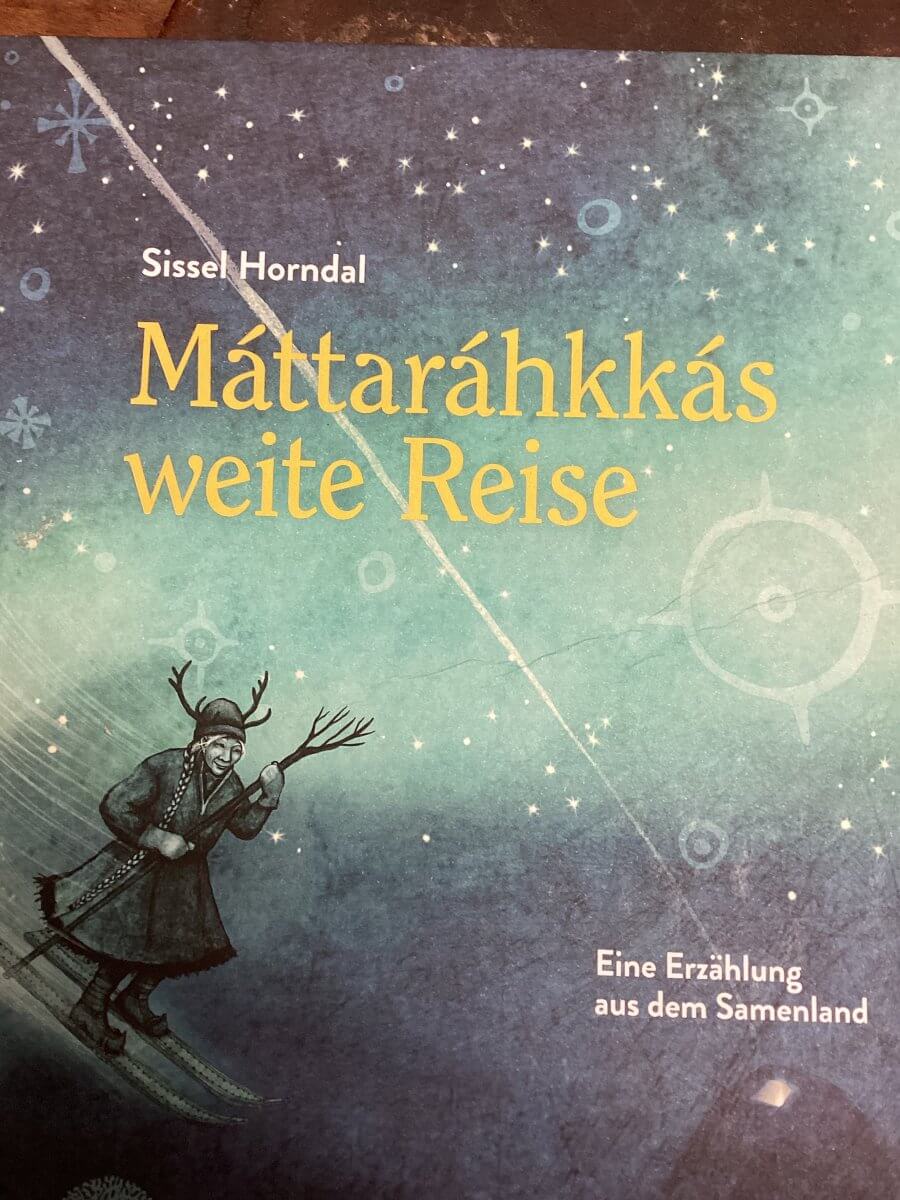
Máttarákká ist die Urmutter. Sie reist auf Skiern.
Möchte den árran, den inner circle, um den Worte und Bilder kreisen, nicht verlassen, ohne auf die magisch-mysteriösen Illustrationen von Sissel Horndal (horndal.no) abzufahren. Sie hat das Cover für Mari Boines CD „Idjagiedas – In the hand of the night“ kreiert und für den Katalog Arran 360 Grad – The Story eine Frau mit Geweih. Die zieht mich mit Zauberhand ins Buch „Das Rätsel der Schamanin“. Archäologe Harald Meller und Historiker Kai Michel rollen darin einen cold case, ungelösten Fall, auf und nehmen uns mit auf eine Reise zu den Anfängen“. Ihr archäologischer cold case ist eine Ausgrabung an der Saale, wo sich in der Nähe einer Solequelle ein 9000 Jahre altes Grab befindet, eine der reichsten bisher ausgegrabenen Grabstätten der mittleren Steinzeit (Mesolithikum) und einer der bedeutendsten archäologischen Funde in Europa. Im heutigen im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, in Bad Dürrenberg, war eine Person bestattet, die Wissenschaftler*innen als Schamanin identifiziert haben. „face to face“ mit dieser ganz besonderen Frau, berichten die beiden Wissenschaftsautoren, lag ein von Menschenhand bearbeitetes Hirschgeweih, „ganz so, als sei es ihre Maske, ihr Schutzgeist oder das Seelentier.“ Rund um den Globus nutzten im Mesolithikum Menschen Geweihe als Tarnung auf der Pirsch oder als Kopfschmuck, zum Beispiel für rituelle Tänze. Die oben genannte Ethnologin Maxelon und andere Forscher*innen gehen davon aus, dass auch das Rehgeweih im Grab von Bad Dürrenberg als Kopfschmuck getragen wurde, „ähnlich dem Kopfschmuck, der von sibirischen Schamanen bekannt ist“. Solche Kraftobjekte würden „der jagdlichen Tätigkeit des Menschen entstammen“. Horndal gehört zu den Lulesamen und wurde im Nordland geboren. Im 16. Jahrhundert nannte man noch das gesamte nördliche Norwegen bis hinauf zur Finnmark so, heute reicht die norwegische Provinz von Brønnøysund, wo ich mit 18 meine nordische Initiation erlebte (siehe oben) bis Narvik und umfasst auch die Lofoten, wo Horndal an der Filmhochschule in Kabelvag studierte. Heute arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und Illustratorin an einem stillen Ort an einem Fjord nördlich des Polarkreises, wie sie auf der Webseite des Baobab Books (baobabbooks.ch) erzählt. Dieser Baseler Verlag ist nach eigenen Angaben eine „Fachstelle zur Förderung der kulturellen Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur“ und hat mit Horndals Buch „Máttarákás weite Reise“ die samische Erzählung von der Entstehung des Lebens herausgebracht, eine Geschichte, die über unzählige Generationen nur mündlich weitergegeben wurde. „Wer sind wir? Woher kommen wir?“ Das hätten sich Menschen überall auf der Welt zu allen Zeiten gefragt, sagt Horndal und antwortet mit „the sámi version“, aus zeitgenössischer Perspektive erzählt und gezeichnet. Der Bär geht voran. Sie sei mit Berichten über Menschen, die sich in Bären verwandelt hätten, aufgewachsen, erzählt Horndal, in dem Video-Clip, der sie irgendwo an einem Fjord nördlich des Polarkreises zeigt, an einem stillen Ort, wo nur Wind und Wellen zu hören sind. Der Bär sei den Sámi heilig, gelte als Träger großer Weisheit. Für die Samen war es ein Zeichen des Glücks, einen Bären in ihrem Gebiet zu haben, schreibt die Übersetzerin Elisabeth Berg in ihrem Nachwort, „es hieß, der Bär würde die Sámishe Sprache verstehen und könne die Gedanken der Menschen hören. In ihrer Horndals Geschichte für Menschen ab 5, die sanft dem arktischen Jahresgang folgt, wandert der Bär zum Ende des Sommers allen voran in den Wald hinein. Dann bläst der Nordwind das Tageslicht aus und Urmutter Máttarákká macht sich auf die Reise. Das Wort áhkká bedeute alte Frau und drücke Achtung aus, erklärt die Übersetzerin Elisabeth Berg in ihrem Nachwort. Máttarákká tut im dunklen Winter das, was nur sie tun kann. Sie bringt Leben. Zuerst zu ihren Töchtern Juoksáhkká, Uksáhkká und Sáráhkká, die es dann zu den Menschen tragen. Giitu, Sissel Horndal!
Subsistenz-Krimi oder Wirtschaftslachstum
Der Vorspann zum nächsten Stück Romsablog-Block – so lautet mein Arbeitstitel – entspringt – wie ein Lachs dem Deatnu – dem Nachwort zu Máttarákkás magischem Reisebericht: „Die Samen lebten an der Küste, im Wald und in der Tundra (siehe oben)“, beschreibt Berg. Während Jahrtausenden wären sie Jäger*innen, Sammler*innen, nomadische Hirt*innen gewesen und: Fischer*innen.
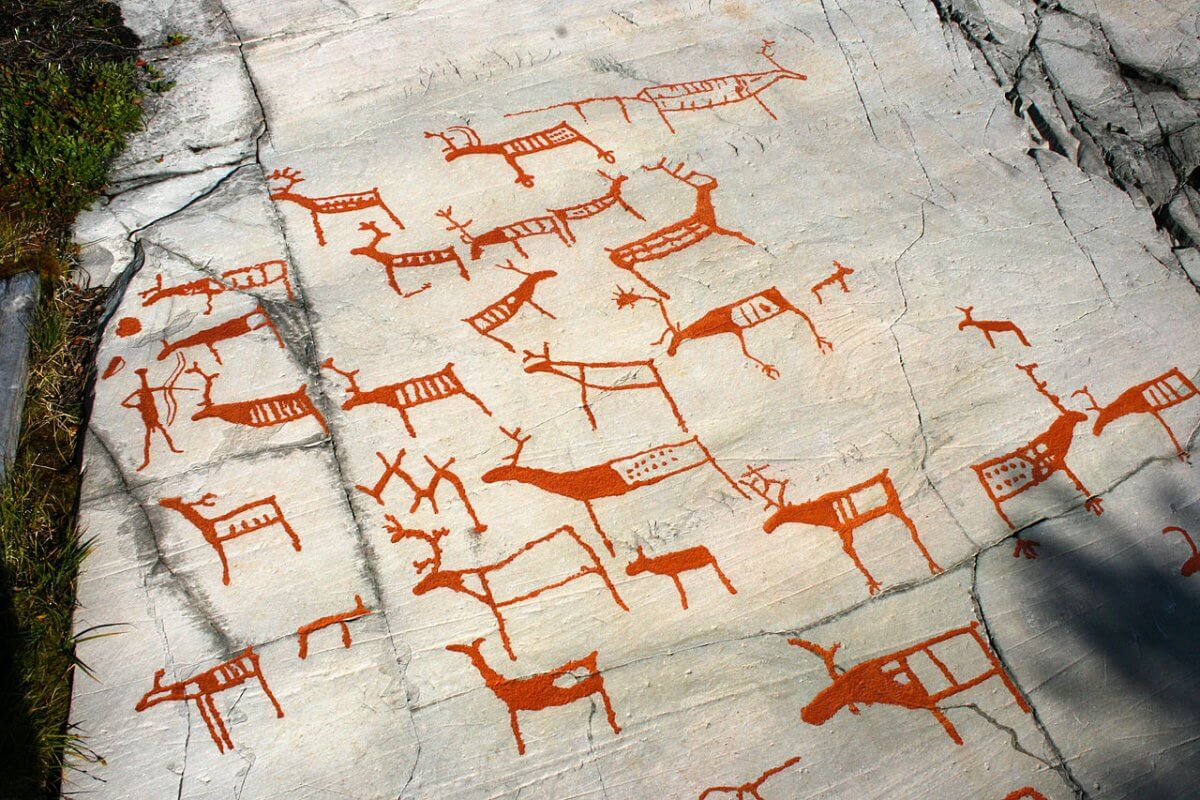
Rentiere und ihre Jäger*innen auf Felszeichnungen in Alta, sie wurden 4000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung angefertigt und es wird angenommen, dass diese Jäger*innen über sehr lange Zeit eine Identität und ursamische Sprache entwickelten. Foto: Andreas Haldorsen
Die Sámi an den Flüssen und Fjorden, auf den felsigen Inseln im Nordpolarmeer, die dem arktischen Ozean und an seinen wild zerklüfteten Küsten, auf Norwegisch sjøsamer genannt hatten reiche Ressourcen direkt vorm lávvu. Auch wenn die herrschenden Norweger 1871 ihre Fischereirechte einschränkten, auch wenn ihre Subsistenzwirtschaft oft knallhart war. Das lateinische Wort subsistentia deutet auf etwas durch sich selbst Bestehendes. Und ich lese gerade zum wiederholten Male, abwechselnd frösteln und erwärmt die Legende von den zwei alten Frauen aus dem Nomadenstamm der Athabasken. Der lebt auf der gegenüberliegenden Seite der Arktis in einer Region mit ähnlichen Bedingungen wie in Romsa – und kann sich nach aktuellen wissenschaftlichen Annahmen auf Ahn*innen beziehen, die bereits vor 36.000 Jahren über eine damals noch bestehende Landbrücke aus Sibirien eingewandert sind. Sie leben unter anderem vom Lachs. Vilma Wallis, 1960 in Alaska als eines von dreizehn Kindern nach traditionellen athabaskischen Werten erzogen, erzählt in „Zwei alte Frauen“ eine mündlich überlieferte Legende ihres Volkes nach. Sie handelt von der Deckung der dringender Bedarfe in eiskalten Zeiten, von Tapferkeit im Alter und der Verabredung: „Lass uns handelnd sterben!“. Sie sterben nicht, denn sie wissen als Alte richtig gut Bescheid mit Subsistenzwirtschaft. Gelernt ist gelernt. Und die seit Jahrtausenden in diesen Längen und Breiten bewährten Handlungen zur Befriedigung der Bedürfnisse (in anderen Worten: Ökonomie bzw. Wirtschaft) der Indigenen Alaskas ist bis dort im Gegensatz zum Rest der Welt heute gesetzlich geschützt. Sie genießt damit Vorrang vor marktwirtschaftlichen Bestrebungen in Sachen Fischerei, Jagd und Sammeln von Beeren, Kräutern, Holz etc., auf der Jagd nach Elchen und Karibus, Kaninchen und Eichhörnchen und auch auf den jährlichen Lachswanderungen beruht.
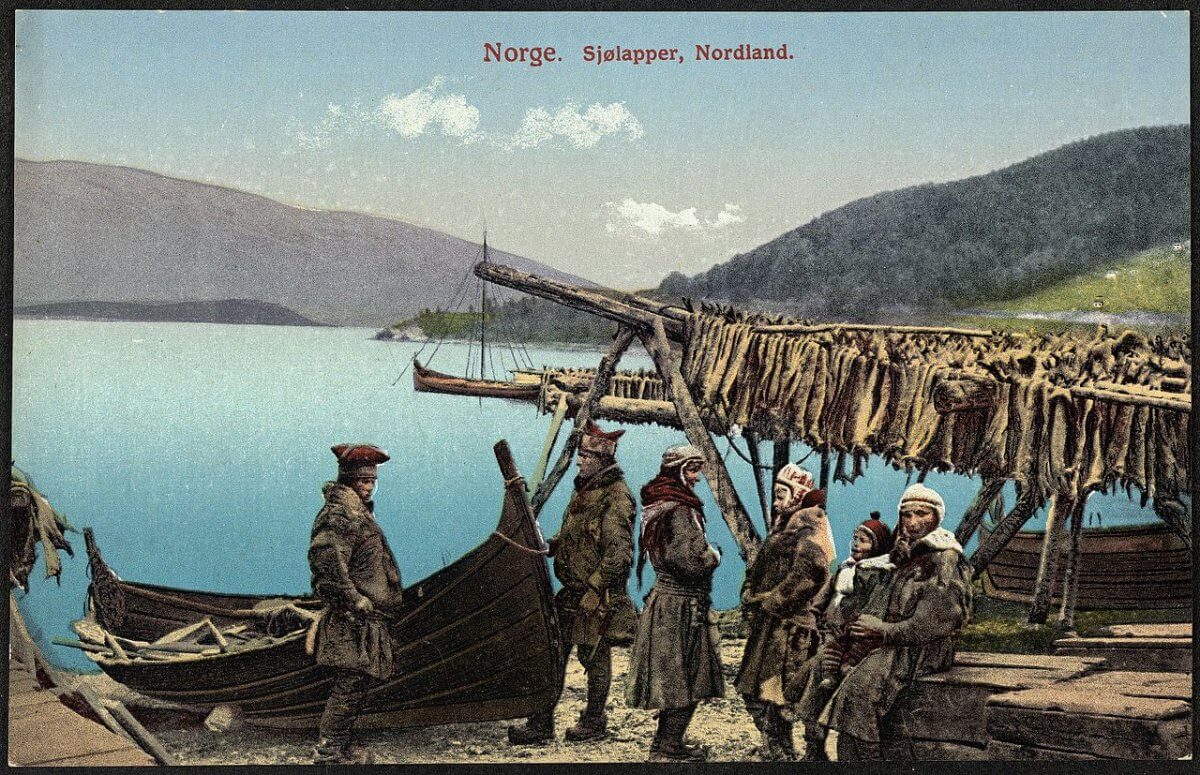
nasjonalbiblioteket
Literarischer Einschub: meine Tochter Marlene habe ich mit der Leidenschaft fürs Lesen infiziert und sie ist mindestens ebenso erfahrene Bücherfinderin wie die Alte. Gerade hat sie ein rororo-Taschenbuch abgestaubt – wegen rororo siehe oben: ankomme Samstag, den 14. – 07:15 – Malmö -. Es handelt von einer Havfrue, einer Seefrau. Jean Lowell, Jahrgang 1902, US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmzeit, behauptet in ihrem 1950 im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen Roman, sie habe im Alter von 11 Monaten bis 17 Jahren auf hoher See mit einer Männercrew gelebt. Das entpuppte sich schon 1929, einen Monat nach dem Erscheinen dieser angeblichen Autobiografie, als Schwindel, aber trotz aller Enthüllungen verkaufte sich „Cradle of the Deep“ beziehungsweise „Ich spucke gegen den Wind“ als hervorragendes Seefrauengarn weiterhin gut. Bis nach Reinbek ist diese unbequeme Wahrheit damals nicht vorgedrungen, der Verlag schreibt zu diesem Buch, die gar nicht „zarte Kapitänstochter“ sei 17 Jahre als Matrosin zur See gefahren. Mir liegt die 14. rororo-Auflage von 1960 vor und ich feiere damit Peggy, Sisilie (siehe unten, 20. Januar) und alle anderen Meer- und Seefrauen samt ihrer wie Seeanemonen, auf denen Seepferdchen thronen, blühenden Fantasie. Gutes Garn, Joan!
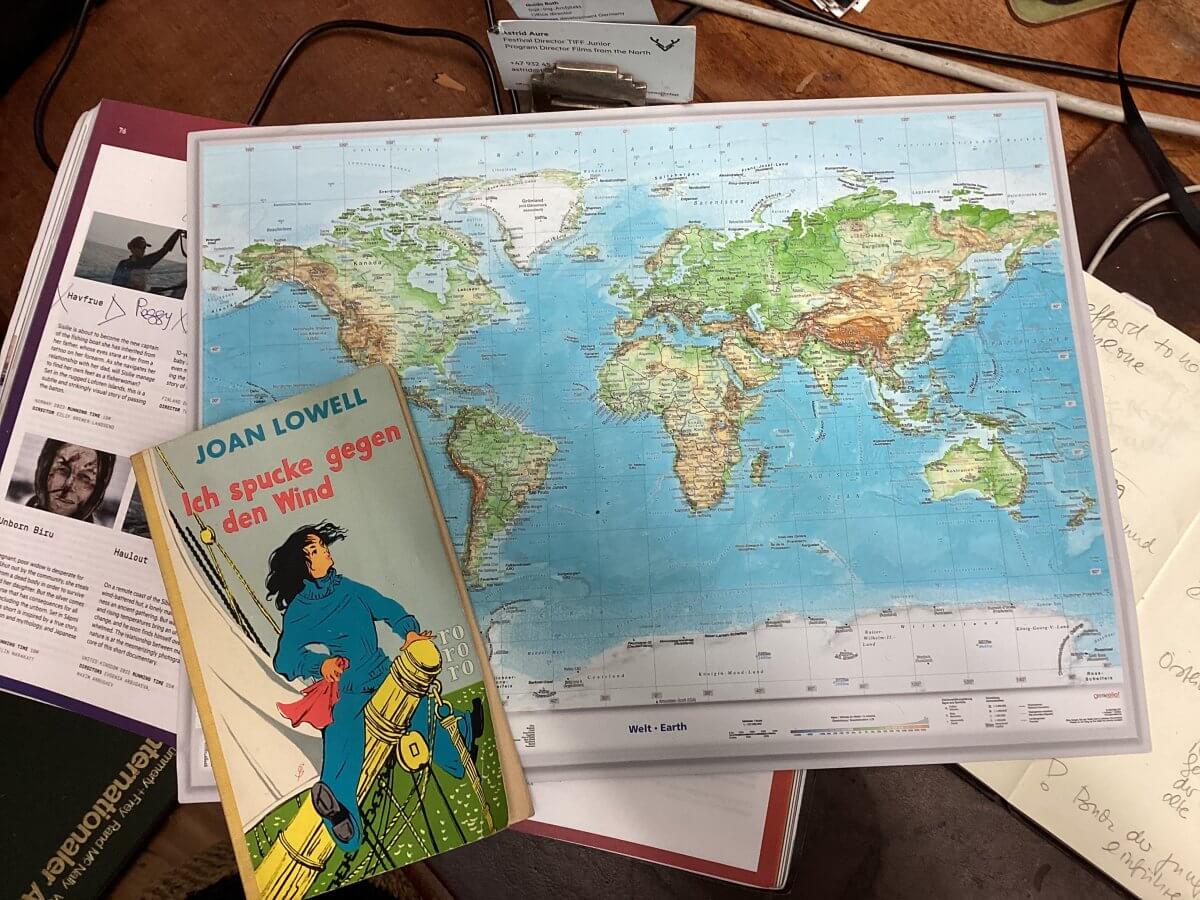
Was hat das aber mit Nordmeerlachs zu tun? Es hat mit Lowells Vater zu tun, Kapitän Nicholas Wagner. Und der beschreibt – Seemannsgarn hin oder her – nach Worten seiner Tochter eine 27-tägige Reise von San Franciso nach Wrangell bzw. Wrangel, Alaska. Ḵaachx̱ana.áakʼw heißt dieser Ort an der Mündung des Stikine in der Sprache der Tlingit, die vor Tausenden von Jahren an den dort mündenden Fluss kamen, als dieser nach ihren mündlichen Überlieferungen noch unter Gletschern floss. Der Nordsame Áilu, sein finnischer Name lautet Nils-Aslak Valkeapää, war Verfasser, Komponist, Musiker, Joiker und Illustrator, gehörte aber ausdrücklich nicht zu den Imperialsten und Nationalisten, die die Arktis wie eine Sahnetorte aufteilen (der größte Happen, fast die Hälfte geht nach ihrer Politik der wenigen an den größten Staat der Welt, die Rossijskaja Federazija; das nächstgrößte Sahnetortenstück, knapp ein Viertel, an einen Staat in Nordamerika, der bis zum Arktischen Ozean reicht; Kalaallit Nunaat, autonomer Teil des Königreichs Dänemark, zu dem die größte Insel der Erde und ihre nördlichste Landfläche gehört, bekommt trotz seiner Pole-Position nur ein gutes Achtel ab; Alaska teilt sich mit Norwegen auf der gegenüberliegenden Seite den Rest). In Áilus hochaktueller Streitschrift aus den 1970ern, einem persönlichen und politischen Pamphlet mit dem fröhlichen Titel „Grüße aus Lappland“ bildet er das leuchtende Kronenchakra des Globus grenzenlos mit den größten dort lebenden Völkern ab. Die Tlingit gehören in diesem Völkerkreis zu den Nordwestküstenkulturen, waren ursprünglich sesshafte Jäger*innen und Sammler*innen, die hauptsächlich von Fischen, Robben und Wildpflanzen lebten.

Schriftsteller Áilu alias Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001)
Valkeapää alias Áilu stellt spöttisch fest, die arktischen Kulturen hätten mehr gemeinsam „als nur die Kennzeichnung „primitiv“.“ Die Ähnlichkeiten der arktischen Völker seien so offenkundig, „dass man von einer gemeinsamen Kultur sprechen kann. Die Musik der Inuit und der Indianer könne man als Joik bezeichnen. Ihr traditioneller Gesang mit oder ohne Worte, bei dem die Kehle stark angespannt wird, der für Eingeweihte Bilder von Leuten, Landschaften, Stimmungen erzeugt, werde wie der Joik der Sámi in persönliche und religiöse Kategorien unterteilt, und: „Allein beim Hinhören kann man schon Gemeinsamkeiten erkennen.“ Das gelte auch für die Tradition des Geschichtenerzählens, manche Geschichten hätten sich in leicht veränderten Versionen rund um den Nordpol verbreitet.
Врангель heißt der Zielhafen der Star of Bengal auf Russisch, er wurde benannt nach Baron von Wrangel. Er gehörte wie meine Urgroßeltern mütterlicherseits zu den Deutsch-Balten oder Deutschbalten oder Baltendeutschen, einer deutschsprachigen Minderheit in den damaligen russischen Ostseeprovinzen, im heutigen Estland und Lettland. Остзейские губернии, Ostsejskije gubernii) Ostseegouvernements hießen die Ostseeprovinzen Russlands im heutigen Lettland und Estland zu seiner und ihrer Zeit. Ferdinand Ludwig Friedrich Georg von Wrangel wurde dort 1797 geboren und verbrachte seine Kindheit auf einem Gut (Waimel-Neuhof bzw. Joosu bzw. Küla) dessen Herrenhaus aussieht wie eine Kopie des Herrenhauses von Gut Schmucken südwestlich von Riga, wo meine Großmutter (Jahrgang 1900) im zaristischen Governement Courlande aufgewachsen ist. Auch sie hat es nach Sibirien verschlagen, das wird in den „Reisen des karierten Koffers, Teil 3“ nachzulesen sein – in Bälde. Maria Poetschke, spätere Holub war im ersten Weltkrieg zunächst eher unwillig, dann begeistert in Sibirien, Wrangel war ein Jahrhundert zuvor Sibirien- und Eismeerreisender, Geograf, Weltumsegler in russischen Diensten und regierte als Gouverneur von Russisch-Amerika, das damals die Aleuten, Alaska und Territorien auf dem nordamerikanischen Festland umfasste und auch den nach ihm benannten Flecken, den er 1834 in Gestalt eines Lagerhauses nördlich einer großen Tlingit-Siedlung gründete, als eine der ältesten nicht von Ureinwohnern gegründeten Siedlungen in Alaska. Heute liegt dort die Stadt Wrangell auf Wrangell Island.
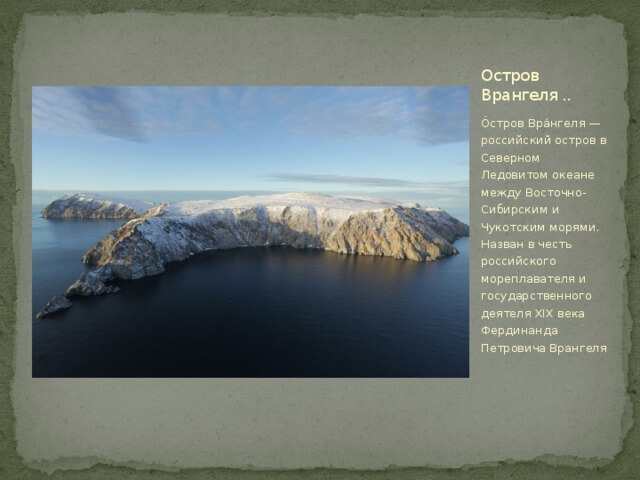
Da könnte jetzt eine geografisch vom Globus kugeln, denn es gibt ja auch noch О́стров Вра́нгеля, Ostrow Wrangelja, die Wrangelinsel. Sie liegt im Autonomen Kreis der Tschuktschen (kurz Tschukotka, mehr als doppelt so groß wie die BRD, weniger als 50.000 Einwohner*innen) im äußersten Nordosten Russlands. Und wurde offiziell erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Obwohl Wrangel bei seiner Kartierung der Nordküste Sibiriens an dieser Stelle „Berge, bei heiterem Sommerwetter … sichtbar“ eintrug, nachdem er Vogelschwärme beobachtet hatte und die Tschuktschen befragt.
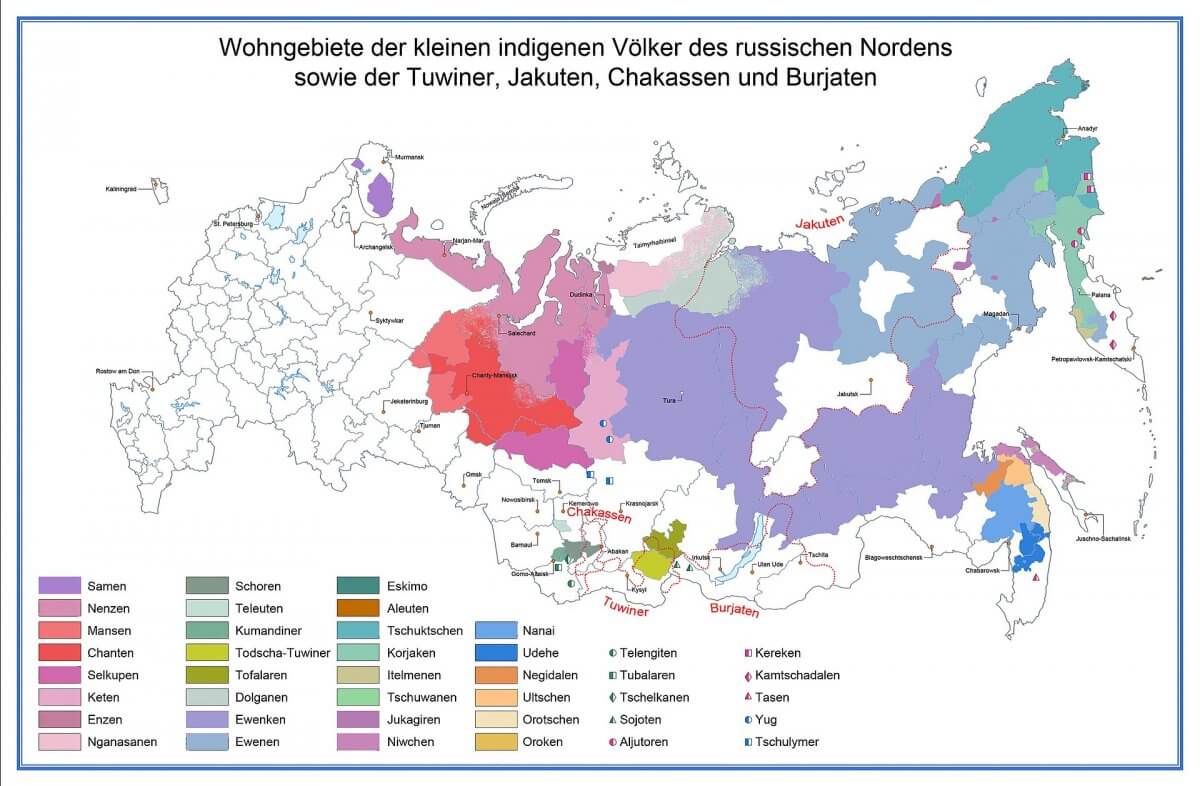
Indigene Völker des Nordens, Sibiriens und des Fernen Ostens, die Tschuktschen leben am nordöstlichsten Ende von Eurasien, Von Original: Olegzima / DE-Version: User:Fährtenleser – CC BY-SA 4.0
Die Tschuktschen hatten wir schon gestreift, aber noch nicht befragt. Ausführliche Auskunft kann Ю́рий Серге́евич Рытхэ́у, Juri Sergejewitsch Rytcheu. Auf dem Buchdeckel wird sein Name zur Verdeutlichung der korrekten Aussprache Juri Rytchëu geschrieben, wiss. Transliteration Jurij Sergeevič Rytchėu, tschuktschisch Рытгэв, Rytgèv.

Ю́рий Серге́евич Рытхэ́у, Juri Sergejewitsch Rytcheu, Juri Rytchëu geschrieben, wiss. Transliteration Jurij Sergeevič Rytchėu, tschuktschisch Рытгэв, Rytgèv
Schon sind wir in der sprachlichen Gemengelage. Die Tschuktschen haben traditionell nur einen Namen, seiner bedeutet „der Unbekannte“. Rytchëu wurde allerdings ziemlich bekannt. 1930 im russischen fernen Osten geboren, in Uëlen (tschuktschisch Увэлен, russisch Уэлен, auf einer alten abbildung auch Whalen), einem Dorf im Autonomen Kreis der Tschuktschen mit weniger als tausend Einwohnern, als Sohn eines Jägers, wurde er der erste Schriftsteller der Tschuktschen.
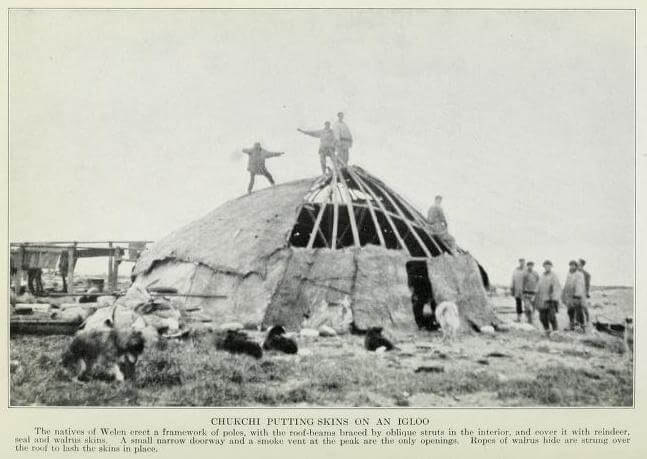
Rytchëus Geburtsort Uëlen (tschuktschisch Увэлен, Uvèlèn; russisch Уэлéн; in älteren englischen Quellen Whalen) 1913, Bau einer Jaranga (Yaranga). Die Wohnstatt der Tschuktschen besteht aus einem kreisförmigen Holzgerüst, das mit Brettern oder Grassoden abgedichtet wird, kuppelförmig überdacht durch eine Konstruktion aus Holzrippe mit darübergebreiteten Walrosshäuten; für den festen Sitz der Häute sorgen darübergezogene Riemen oder Seile, die – seitlich herabhängend – durch darangebundene Steine in Spannung gehalten werden; eine Öffnung in der Mitte der Überdachung lässt licht ein und dient als Rauchabzug; bei mobilen Jarangas der Rentierhirten ruht die überdachung – hier aus Rentierfellen – auf einem zeltförmigen Gerüst aus langen Stangen. Das Innere der Jaranga gliedert sich in den äußeren, unbeheizten Tschottagin, wo häusliche Arbeiten verrichtet, auf offenem Feuer gekocht und in der kalten Jahreszeit die Schlittenhunde gehalten werden, und den durch Tranlampen erleuchteten und beheizten Polog, ausgelegt mit einer dicken Moosschicht und Fellen, dient er u.a. als Schlafraum.
Rytchëus Held John erlebt in „Polarfeuer“ den Landgang der Walrösser, die an ihrem Liegeplatz auf der schmalen Landzunge mit ihren Hauern die Kieselsteine aufwühlen und nach Muscheln suchen. Seine Hauptsache ist auch nach der Russischen Revolution nicht der örtliche Sowjet – zumal Klassenkampf bei den Tschuktschen, wo einst Schaluppen, Waffen und Wohnungen Gemeingut waren, nicht erforderlich erscheint – sondern der Lagerplatz der Walrösser, mit dem sich die Frage entschied, ob es genug Fleisch- und Tranvorrat für den Winter gab.

Walrosse auf dem Eis, Brehms Tierleben 1927, Wilhelm Kuhnert
Und wieder juckt es mir in den Fingern als Hüterin der Vielfalt: meines Wissens nach hat bisher die traditionelle Lebensweise Indigener noch keine einzige Tierart gefährdet hat. Rytchëus Jäger der Meeresküste singen uralte Lieder über die Gabe, mit den Kräften der Meerestiefe in Einklang zu leben.
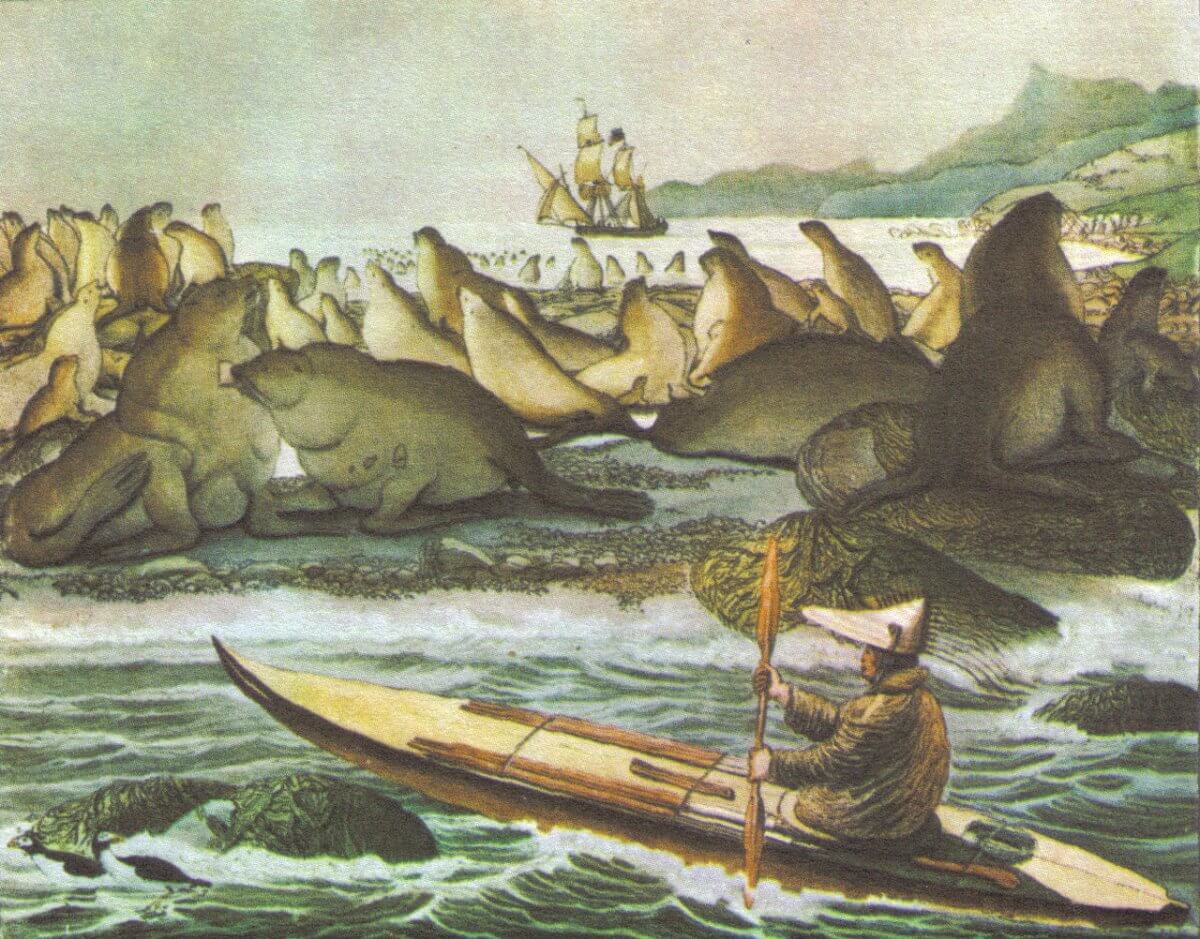
Dieser Liegeplatz, den Louis Choris im Jahr 1817 bei der Rurik-Expedition mehrfach darstellt, liegt auf der Insel Sankt Paul in der Beringsee vor Alaska, und ist bei Seelöwen beliebt.
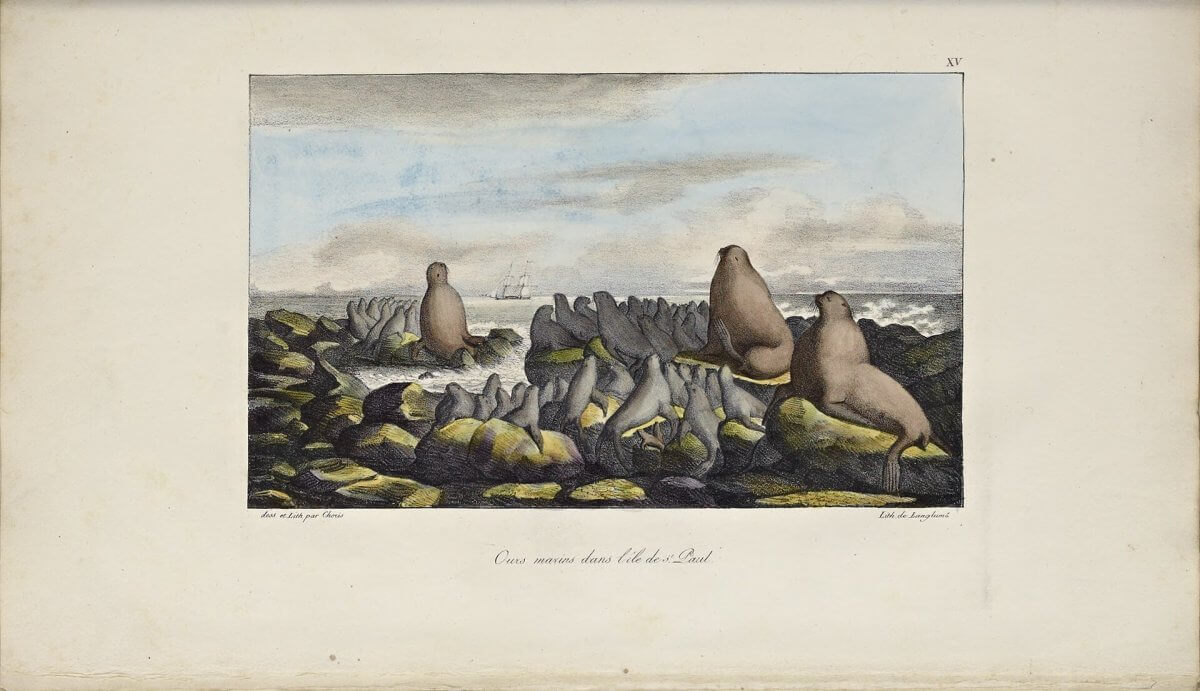
Der kanadische Seemann John, Hauptfigur in „Polarfeuer“, war 1910 nach einer schweren Verwundung von einer Schamanin der Tschuktschen gerettet worden und lebt seitdem bei diesem indigenen Volk, begegnet auch Amundsen, der nach der zweiten Überwinterung an der nordsibirischen Küste in Begleitung zweier Tschuktschen-Mädchen und der Durchfahrung der Nordostpassage über Seattle 1921 nach Norwegen gelangte.

Dieses Bild einer Tschuktschen-Familie malt Louis Choris im Jahr 1817 bei der Rurik-Expedition.
„Im vergangenen Frühjahr ist der große Weltreisende Roald Amundsen von hier weggefahren“, heißt es in Rytchëus Roman. „Hier aber lebten bereits Menschen. Nur schrieben sie keine Bücher. … Indem diese Bezwinger des Nordens sich selbst zu Helden machten, stahlen sie ihren Ruhm von den Nordvölkern, reduzierten sie auf ein Forschungsprojekt“. Das Unglück der Einheimischen bestehe darin, dass sie keine Erfahrung mit Heuchelei und Lüge hätten, mit Hinterlist und Grausamkeit, „alles Eigenschaften, die sich die zivilisierte Welt in ihrer langen Geschichte zugelegt hat.“ Auch schriftlich beschwert sich Rytchëus Protagonist – bei Fridtjof Nansen und dem Völkerbund – über die Verbrechen seitens der Kauf- und Seeleute und auch der Zarenbeamten, die Rentierzüchter und Meeresjäger nicht als Menschen betrachteten, obwohl diese die eisigen Weiten des großen Festlandes bezwungen hatten. Und dort in einer Weise leben würden, die der dortigen und auch allgemein der menschlichen Natur entspräche.
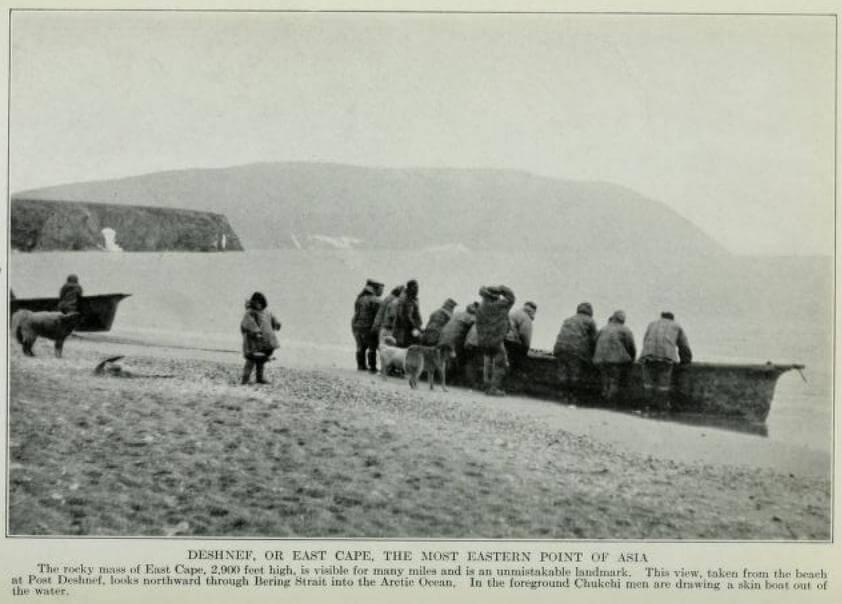
Am Kap Deshnjew, Kap Deschnjow (alternative Schreibweise Kap Deschnew, russisch Мыс Дежнёва Mys Deschnjowa), dem östlichsten Punkt des eurasischen Festlands, lassen Tschuktschen ein Boot zu Wasser, ein Umiak (Inuktitut Umiaq), meist als Frauenboot bezeichnet, ein häufig großes offenes Robbenfellboot, das die Inuit verwendeten, als ihnen noch keine aus dem Süden eingeführten Boote zur Verfügung standen. Bei der „Entdeckung“ des bis dahin weitgehend isolierten Ostgrönlands im Jahr 1884 spielten sie eine große Rolle; die Fahrt dorthin wurde deshalb als Frauenbootexpedition bekannt.
Der Stich unten stammt von 1770, von David Cranz, er war als pommerscher Missionar in Grönland, wo er dieses Frauenboot gesehen hat.
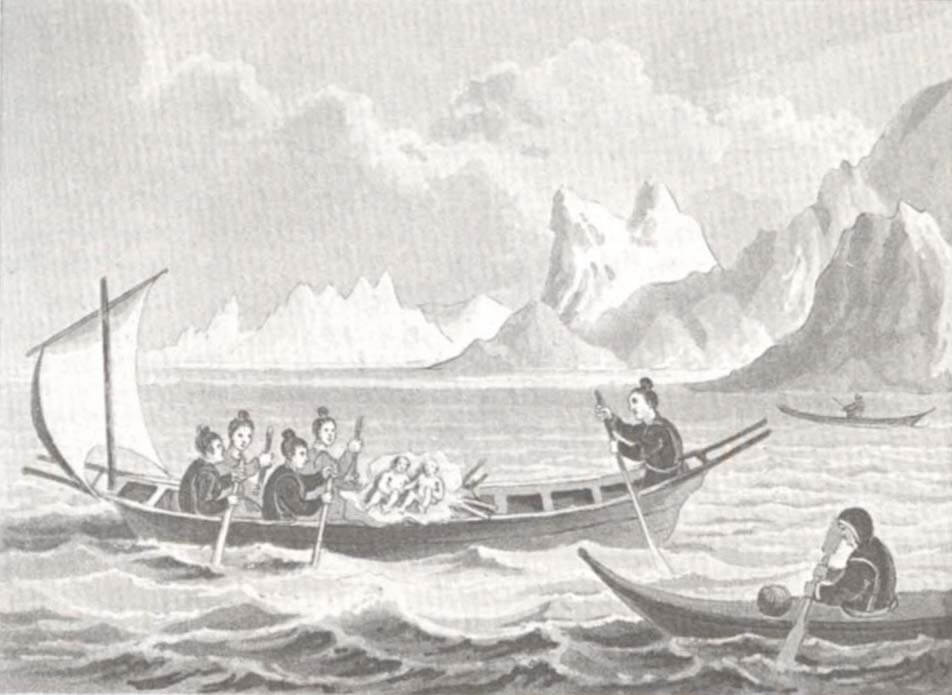
Und ich fange auch noch eine Fischart: „Auf dem Meeresufer liegt der Wekyn!“ so ruft John die anderen herbei und sie teilen das ungeheure Glück, dass ein Schwarm Dorsche von den Wellen ans Ufer geworfen wurde und auch gleich tiefgefroren. Da muss ich biologisch nochmal ran, weil sich die Genforscher nochmal drangemacht haben: der Grönland-Kabeljau gehört molekulargenetisch zur selben Art wie der Pazifische Kabeljau (Gadus macrocephalus), Gadus ogac ist heute also ein Synonym für G. macrocephalus und diese Dorschart bewohnt interkontinental bodennahe Unterwasser-Biotope, meistens nahe den Küsten von der Meeresoberfläche bis in Tiefen von 200 Metern, rund um den nördlichen Pazifik, vom Gelben Meer zur Beringstraße, entlang der Aleuten und südlich bis Los Angeles, von der östlichen Beaufortsee und östlich über die kanadische Arktis, einschließlich der Boothia-Halbinsel in die Hudson- und James-Buchten und die Hudson-Straße, die gesamte Küste von Labrador und in den St.-Lorenz-Golf, mit der Kap-Breton-Insel, Nova Scotia, als südliche Grenze. Und Uëlen. Eine isolierte Population lebt im Weißen Meer im Norden des europäischen Teils Russlands.
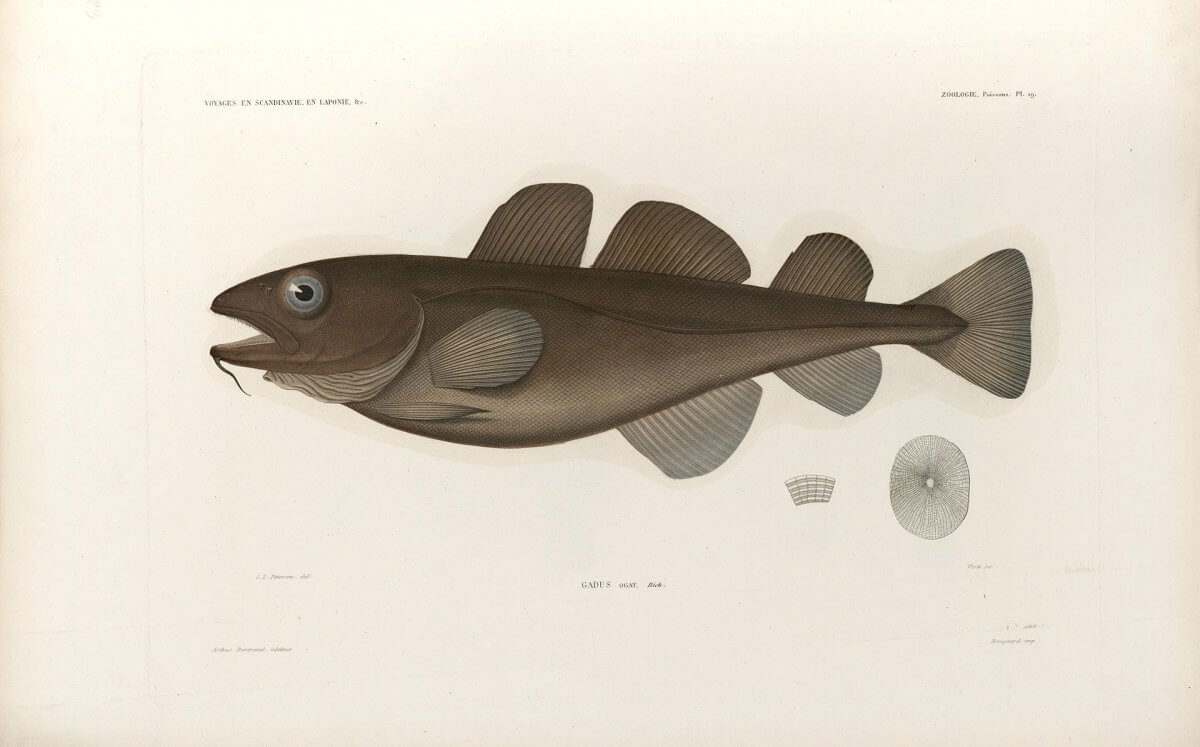
Der Grönland-Kabeljau gehört molekulargenetisch zur selben Art wie der Pazifische Kabeljau (Gadus macrocephalus), Gadus ogac ist heute also ein Synonym für G. macrocephalus
Im Frühling, „zur Walrosszeit“, tauchen in Rytchëus Roman Anfang des 20. Jahrhunderts Inuit auf in Johns Jagdrevier. Sie kommen, wie viele Jahrhunderte zuvor, von der Ecke Kap Deschnjow, alternative Schreibweise Kap Deschnjew oder Kap Deschnew (aleutisch Tugnehalha, inupiaq Nuuġaq; , russisch Мыс Дежнёва Mys Deschnjowa, englisch Cape Dezhnyov oder Cape Dezhnev, früher East Cape or Cape Vostochny, von hier aus betrachtet dem östlichsten Punkt des eurasischen Festlands, mit seinen 2900 Metern eine unübersehbare Landmarke.

Dieses Foto vom Kap Deschnjow, das bei ihm „East Cape, Siberia“ heißt, macht 1907 der US-amerikanische Fotograf Frank Hamilton Nowell, dessen Atelier sich in Seattle befand.
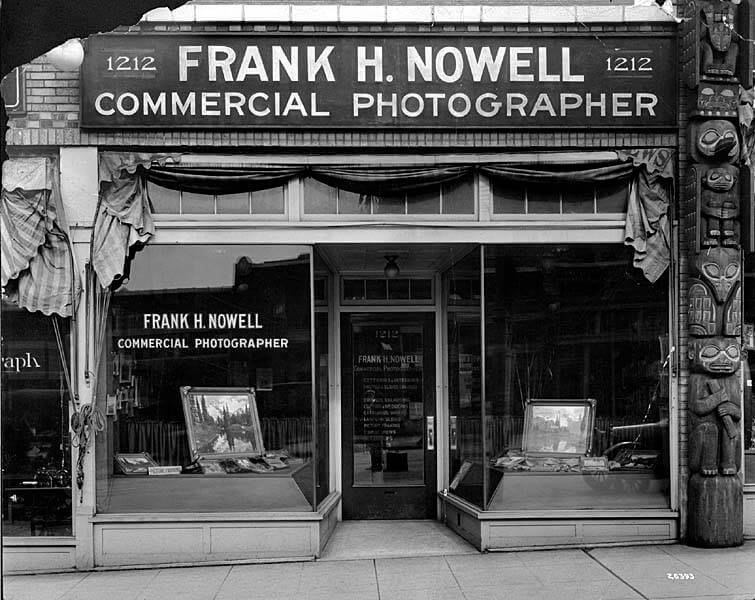
Hierzulande ist diese gewaltige Landmarke nach dem russischen Seefahrer und Pelztierjäger Семён Иванович Дежнёв, Semjon Iwanowitsch Deschnjow benannt. Er umrundete – nicht ganz allein aber in einem ziemlich kleinen Boot – als erster Europäer das nach ihm benannte Cap und widerlegte bereits im 17. Jahrhundert mit seiner Fahrt durch die Beringstraße die Auffassung, dass zwischen Amerika und Asien eine Landbrücke bestehe. Sein diesbezüglicher Bericht wurde anderswo aber erst ein knappes Jahrhundert später bekannt.
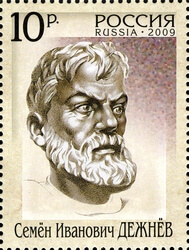
Der russische Seefahrer und Pelztierjäger Семён Иванович Дежнёв, Semjon Iwanowitsch Deschnjow
Zusammen mit Федот Алексеевич Попов, Fedot Alexejewitsch Popow, und Герасим Анкудинов, Gerassim Ankundinow, umrundete Deschnjow 1648 in Pomoren-Kotschen das später nach ihm benannte Kap.
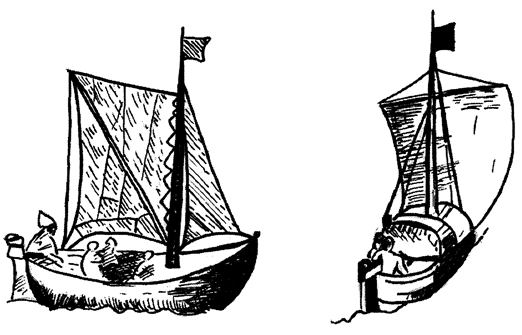
Pomoren-Kotsch, Jan Huyghen van Linschoten
Die Inuit, die in Rytchëus Roman über den Beginn des 20. Jahrhunderts in jenen Breiten auftauchen, kommen, wie wohl schon in vielen Jahrhunderten zuvor, vom Ostende der Tschuktschen-Halbinsel.

Yupik, eine Gruppe von Inuit, die auf der russischen Tschuktschen-Halbinsel leben, am Strand von Uëlen, im Hintergrund das US-amerikanische Küstenwachendampfschiff Corwin, auf dem John Muir über Vereisung und Vegetation erforscht hat.
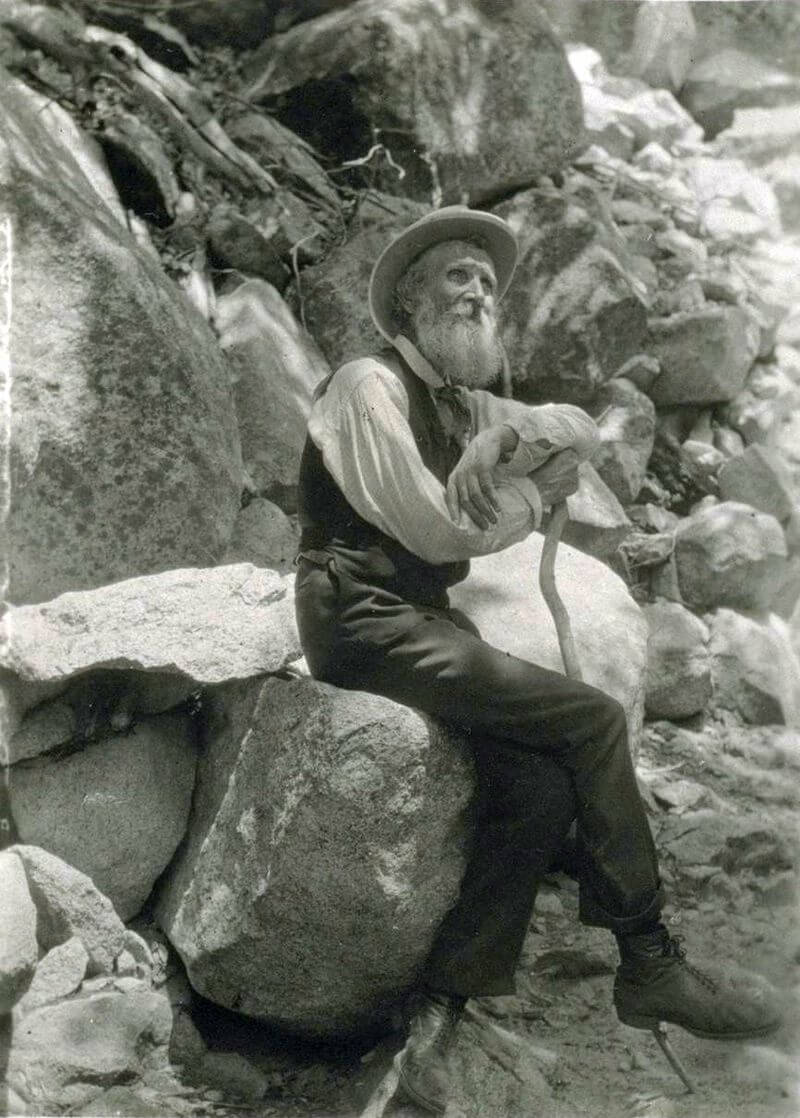
John Muir, ein 1838 in Schottland geborener Autodidakt, betätigte sich weltweit als Naturalist (prima Berufsbezeichnung! immer schön zu lesen, dass es nicht nur Angreifer und Ausbeuter gab:)), Entdecker, Schriftsteller, Erfinder, Ingenieur und Geologe, entwickelte sich immer mehr zum Naturschützer und nahm damit viele der Ideen der heutigen Ökologiebewegung vorweg.
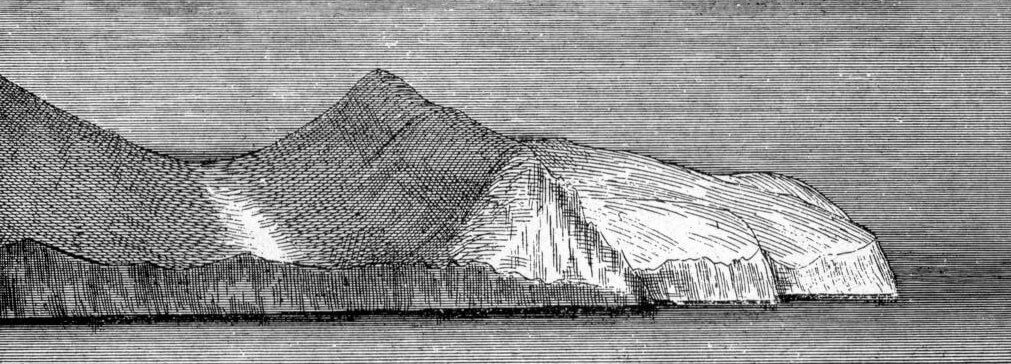
Diesen Stich fertigte Muir bei der Corwin-Expedition 1881 an, er zeigt die Muster der Vereisung am Kap Deschnjow, in der Karte unten EAST CAPE
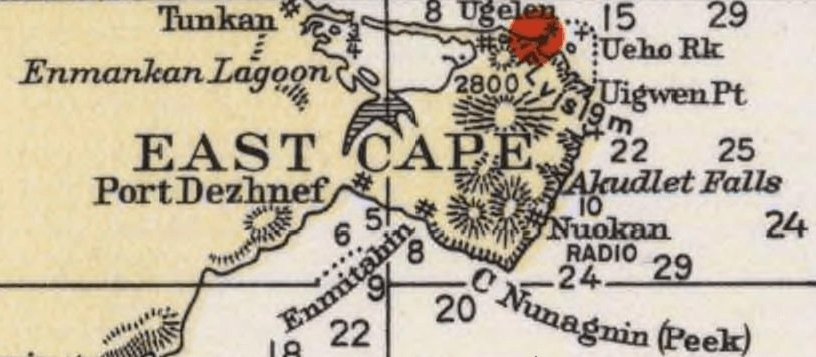
Manchmal kommen Inuit auch vom ganz anderen Ufer, vom Kotzebue-Sund in Alaska. Der ist auch nach einem der umtriebigen deutschbaltischen Adligen benannt. Otto von K. (russisch Отто Евстафьевич Коцебу) wurde 1787 im heutigen Tallinn geboren, das damals noch zum russischen Zarenreich gehörte, gehörte zu dessen Marine und umsegelte dreimal die Welt, unter anderem auf der Rurik (russisch Рюрик). Die Rurik, hinter den Seelöwen auf der Insel St. Paul auszumachen, wurde damals nach einem berühmten skandinavischen Einwanderer benannt, der als der Begründer des russischen Reiches gilt, dem Waräger – die Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch варяги, warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi), eine Teilgruppe der Wikinger, aus Skandinavien stammende Händler und Krieger, sind seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins Kaspische und Schwarze Meer aufgetaucht – Rjurik (Rurik, Рюрик; altnordisch Hrœrikr = berühmter Herrscher). Er soll von streitenden Stämmen in der Gegend von Novgorod als Neutraler von der anderen Seite des Meeres gerufen worden sein. Bei der Rurik-Expedition von 1815 bis 1818 waren Adelbert von Chamisso und weitere Naturforscher an Bord, der Zeichner Ludwig Choris übernahm die Dokumentation, aber der eigentliche Zweck der Investoren, des Zars und der russischen Adligen, war ein wirtschaftlicher, man wollte die Nordwest-Passage finden.

Die Bucht von Prowidenija (Провиде́ния bedeutet Vorsehung) im äußersten Osten Russlands, nahe der Datumsgrenze im Jahr 1921. Sieben Jahre später wurde in diesem durch die Lage am Fjord geschützten Naturhafen ein Lagerplatz, 1937 eine Siedlung, dann ein Militärhafen errichtet. Nach Ende des Kalten Krieges kamen Touristen aus Alaska, sogar 1988 mit einem „Frienship-Flight“ der Alaska Airlines. An diesem Ende der Tschuktschen-Halbinsel leben traditionell sibirische Inuit.

Gelbschopflund, Fratercula cirrhata, Von Mrkoww OR Matthew Zalewski – Eigenes Werk, CC BY 3.0
Zum Sommer hin bringen Johns Leute die Kanus für die Jagd zum Wasser. Und ich entdecke eine ornithologische Besonderheit: „Die Schopflunde mit den roten Schnäbeln badeten im eisigen Wasser und schwammen ganz nah an die Kanus heran.“ Es handelt sich um Fratercula cirrhata, auch Gelbschopflund genannt – am Hinterkopf des Vogels befinden sich glänzende gelbe Federn, die eine Länge von sieben Zentimetern erreichen können. Die Art lebt fast ausschließlich im Nordpazifik. Nur einzelne Exemplare werden gelegentlich in der Tschuktschensee beobachtet und dringen bis zur Wrangelinsel vor.
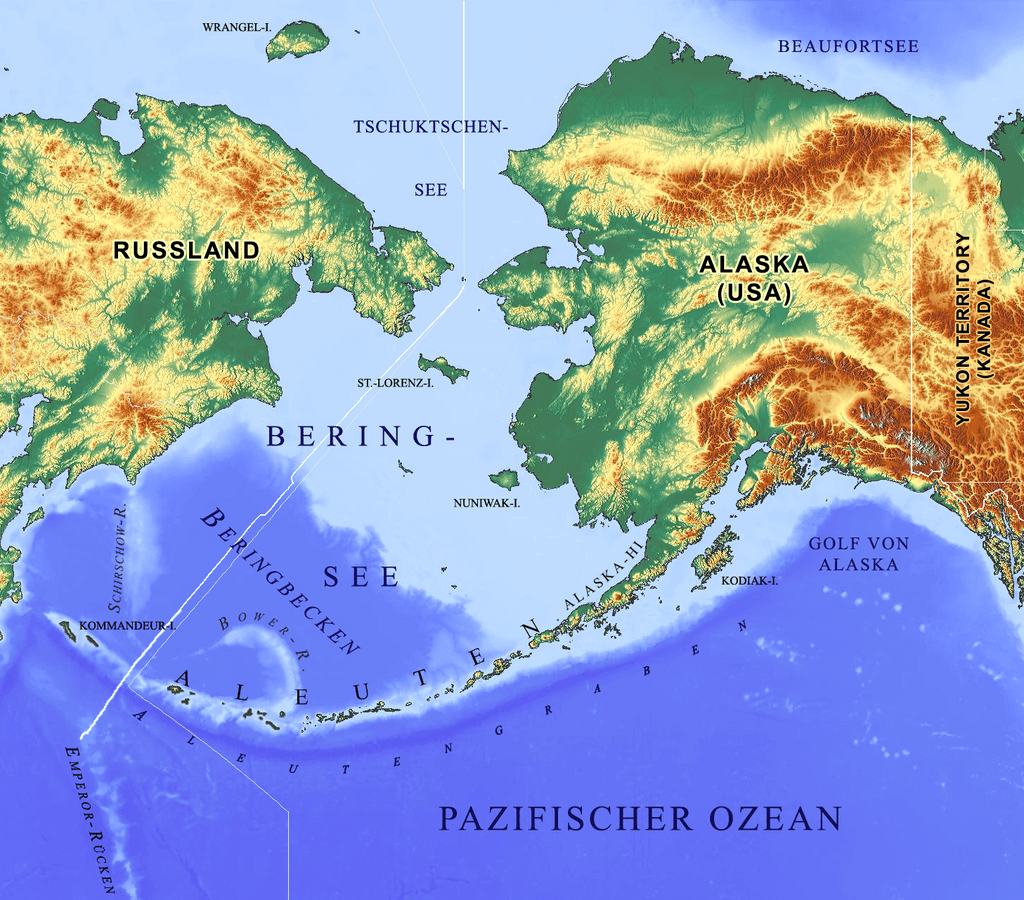
Zur Navigation, Von GretarssonBase map: © OpenStreetMap contributors – Eigenes WerkBase map is from https://maps-for-free.com, CC BY-SA 2.0
Die nach Wrangel benannte Insel im Autonomen Kreis der Tschuktschen ist heute nördlichstes Weltnaturerbe, aber da steigern wir uns jetzt nicht rein. Wir müssen jetzt nämlich leider ein sehr schönes Schiff versenken, die „Star of Bengal“. „Hoch aus dem Netz der Masten und Takelage der vielen Schiffe“, schreibt die Kapitänstochter, „flatterte die blaue Reedereiflagge des berühmten Vollschiffs Star, des schönsten Schiffes der in der Lachsfahrt von Alaska eingesetzten Flotte“. Damit sind wir bei der Gattung Oncorhynchus, deren Name sich von den griechischen Worten für Hakennase ableitet, den Pazifischen Lachsen, und dem Segler von Kapitän Wagner, Lowells Vater, einem Vollschiff.
Da kann eine allerhand verwechseln und es kann einer ganz schön schwindlig werden, das habe ich auf der Мир (deutsch Frieden) gelernt, einem der größten Segelschiffe der Welt, wo ich zwar einigermaßen Windsbraut-mäßig bis zum unteren der drei Körbe am Mast geklettert bin, mich aber beim Abstieg ziemlich viel Zartheit anwehte, und es mir an Deck absolut nicht möglich war, herauszufinden, an welcher Leine wir gerade mit vereinten Kräften zogen. Die Besatzung dieses Schulschiffes, das 1987 in Gdansk gebaut wurde und der Hochschule für Marineingenieure in St. Petersburg gehört, macht seinem Namen Ehre, das erlebten wir als Hängematten-Gäste und auch die Konkurrenten bei weltweiten Großsegler-Regatten, bei denen der Mir-Mannschaft für ihren Beitrag zur internationalen Verständigung und Freundschaft die Friendship Trophy überreicht bekam. Und wo wir schon im Globalen segeln, und Segelschiffe, das mächtige Meer unterm Bauch haben und „über sich Wolken und Sterne“, wie Joachim Ringelnatz, Leichtmatrose aller Meere, erfahren hat, – dessen Gedicht folgendermaßen weitergeht: „Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch. Mit Herrenblick in die Ferne. Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand – Wie trunkene Schmetterlinge. Aber sie tragen von Land zu Land – Fürsorglich wertvolle Dinge.Wie das im Winde liegt und sich wiegt, Tauweb überspannt durch die Wogen, – Da ist eine Kunst, die friedlich siegt – Und ihr Fleiß ist nicht verlogen. Es rauscht wie Freiheit. Es riecht wie Welt. Natur gewordene Planken – Sind Segelschiffe. – Ihr Anblick erhellt- Und weitet unsre Gedanken.“ – wenden wir uns einem Großsegler zu, dessen Heimathafen Bergen etwa auf dem gleichen Breitengrad liegt wie St. Petersburg, ein paar tausend Kilometer westlich. Dort ist die Statsraad Lehmkuhl, nachdem sie mehrere Ozeane unterm Bauch hatte, am 15. April nach einer 19-monatigen Weltumrundung eingelaufen. Ziel dieser Fahrt, der One Ocean Expedition, war es, Aufmerksamkeit zu schaffen. Solveig Maria Etter, eine der Verantwortlichen sagt: „Ozeane bedecken 70 Prozent der Welt und wir wissen nicht viel darüber. Wir wollen zu diesem Wissen beitragen und die Menschen darauf aufmerksam machen, dass der Ozean für unsere Zukunft sehr wichtig ist.“ Noch eine „Havfrue“, die Segel für die Zukunft setzt. Mostly female – mostly young – mostly brave, Ahoi! Ihre 1914 bei Bremerhaven gebaute Statsraad Lehmkuhl, ist zwar kein Vollschiff, der letzte Mast trägt nämlich im Gegensatz zu den quer zur Schiffsachse geführten Rahsegeln längs gesetztes Tuch. Aber damit wollen wir uns nicht lange vertüdeln, denn die alte Dame, die nach dem Staatsmann aus Bergen heißt, der sie gekauft hat, weitete unsere Gedanken, rauschte wie Freiheit, roch wie Welt, als wir auf ihr von Bergen nach Hamburg segeln durften – und Taue tüdeln ohne Ende. Nu aber, auf nach Wrangell Island. Die Insel liegt vor Alaskas Pfannenstiel (Panhandle, ein Blick auf den Globus erläutert den Namen) und dort erledigte Kapitän Lowell, der den Norden liebte, die Aurora Borealis und die majestätische Größe der vereisten Arktis, in fünf Monaten laut Bericht seiner Tochter folgenden Auftrag: „vierundfünfzigtausend Kisten edler Nordmeerlachs in Dosen waren für San Francisco geladen.“ Das beweist, wenn es kein Seefrauengarn ist, zweierlei: es gab sehr viel Oncorhynchus und die industrielle Verarbeitung der Lachse begann schon im 19. Jahrhundert. Und ich finde doch glatt in The Free Encyclopedia den Untergang der Star of Bengal. Sie zerschellte im September 1908 auf dem Rückweg von Wrangel(l) an den Felsen von Coronation Island. Was vorher in der hundertfünfundzwanzig Meilen langen Meerenge von Wrangel(l) (Sumner Strait, Pelzhändler haben diesen schmalen Seeweg zur Mündung des Stikine im 18. Jahrhundert entdeckt) geschehen ist, nach Aussage des Kapitäns, findet ihr ungefähr in der Mitte von „Ich spucke gegen den Wind“.
Biologischer Einschub: In Alaska leben andere Lachsarten als in Europa, darunter sogar eine ausschließlich im Süßwasser. Alle übrigen Lachse wandern zum Laichen die Flüsse hinauf, sie gehören zu den anadromen Wanderfischen (griechisch aná = hinauf). Auch in Hamburg an der Elbe und im übrigen Deutschland gab es riesige Lachsschwärme, bis die aufstrebende Industrialisierung, die an Gewässern besonders hart zuschlug, die Tiere zwang, sich andere Wege zu suchen. Als ich geboren wurde, in den 1950ern, war der Atlantische Lachs (Salmo salar) in Deutschland ausgestorben.

Und schon sind wir beim Thema, das Geir und Hjerborg, in alphabetischer Reihenfolge, wobei es in dieser egalitären und gereiften Beziehung offensichtlich nicht auf die Reihenfolge ankommt, auch wenn Geir uns die Tür zum Restaurant aufmacht, und mich beim middags-lunsj bedient. Die beiden nehmen mich mit ins Skarven am Strandtorget (torget = Markt, dieser Marktplatz befindet sich direkt am Hafenbecken). Dort gibt es Fisch und der Name des Wirtshauses verweist auf Fischfresser: Skarver heißen auf Norwegisch Angehörige der Kormoran-Familie (Phalacrocoracidae). Dazu gehören der Storskarv (Phalacrocorax carbo, Kormoran), eine auch bei uns in Deutschland entgegen anderslautenden Gerüchte heimische Art, und der Toppskarv (Gulosus aristoteles, Krähenscharbe), die bei uns nur als Wintergast auf Helgoland auftaucht. Als Konkurrenten der Fischer sind diese Meerraben (Wortstamm von Kormoran ist corvus marinus = Meerrabe) überall von Sagen umwoben. Geir erzählt, dass skarven in alten nordischen Mythen Fischern Unglück bringt.

Krähenscharben auf der Vogelinsel Runde vor der westnorwegischen Küste, Von T. Müller – Eigenes Werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2024567
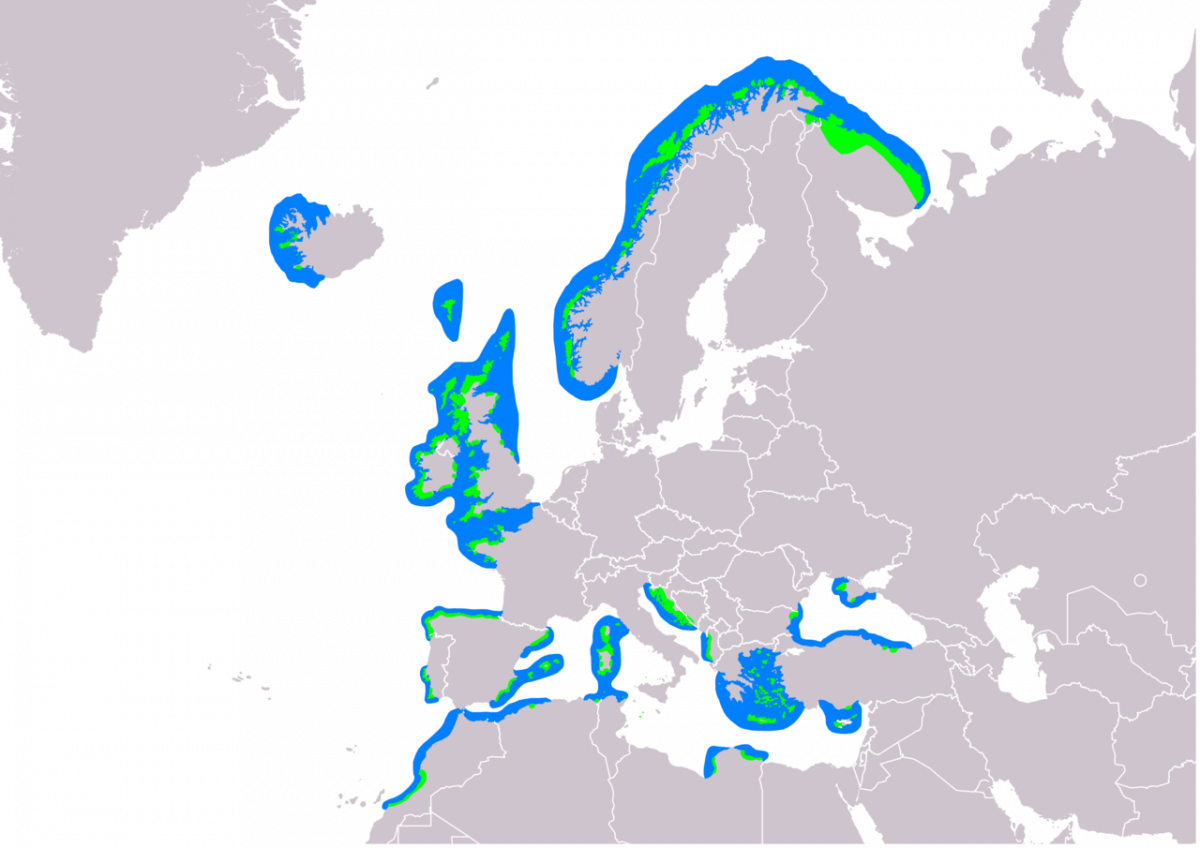
Die Karte der IUCN (International Union for Conservation of Nature; deutsch: Internationale Union zur Bewahrung der Natur) zeigt die Brutgebiete (grün) und die Überwinterungsgebiete (blau) der Krähenscharbe (Gulosus aristoteles), Von IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the authors of the spatial data., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77109979
Herbjorg berichtet beim Mittagessen von dem, was den Fischer*innen heutzutage Unglück bringt. Ihre Partei schlägt sich beim Kampf um die Ressourcen konsequent sowohl auf die Seite des Volkes als auch – das zeichnet die Sosialistisk venstreparti aus – auf die der Natur. Wenn ich sie richtig verstanden habe, macht Norwegen, das zu den weltgrößten Fischereinationen gehört, etwa 150 Milliarden Umsatz mit „seafood“, davon entfallen 100 Milliarden auf die Lachsfarmen. Die großen Konzerne fahren mit ihren schwimmenden Käfigen seit Jahren steigende Gewinne ein. Herbjorgs sozialistische Linke und andere haben jetzt nach Herbjorgs Worten dafür gesorgt, dass solche „Überprofite“, erzielt mit einer Ressource, die allen zusteht, teilweise dem Gemeinwesen zugeführt werden – in Form von Steuern. Konzerne wie Mowi und Salmar, die zu den weltgrößten Fischfarmern gehören, müssen nun für die Fläche, die sie in den Fjorden belegen, eine Art Miete zahlen. Das Volk habe das Recht auf die marinen Ressourcen, betont die eingefleischte Politikerin zwischen zwei Löffeln Fischsuppe. Und dann gucken wir eine Weile aufs Fleisch in dieser Suppe.
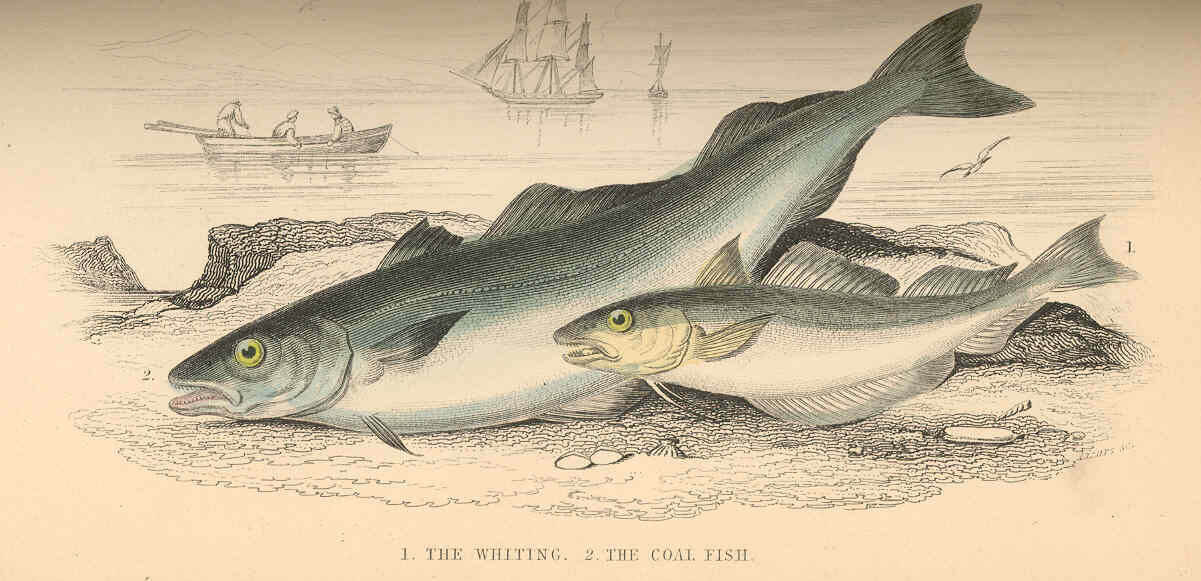
Köhler, Kohlfisch, pale, sei (Pollachius virens) gehört zur Familie der Dorsche und wird in Deutschland verkaufsfördernd Seelachs genannt.
Mein norwegisches Kochbuch von 1959 (What you have eaten in Norway, written from Buster Holmboe „to friends of Norway who have travelled in our country and have liked Norwegian food, and in particular to one of them“) verrät das Geheimnis norwegischer Fischsuppe: „Verwende Haut, Kopf und Gräten des „pale“. Pale oder sei ist die norwegische Bezeichnung für den Kohlfisch (Pollachius virens). Biologisch gehört dieser zur Familie der Dorsche und wird wegen seiner dunklen Färbung auch Köhler oder Kohlfisch genannt; wirtschaftlich ist er aus historischen und vor allem aus verkaufsfördernden Gründen unter dem Handelsnamen Seelachs bekannt und wir erhalten hierzulande gerade mal Filets, fast nie das ganze Tier. Wenn Sie ein solches erbeuten, sollten sie es nach Holmboes Rezept filetieren, das Filet beiseite legen und den Rest zwei Stunden kochen. Dann gießen sie die Brühe durch ein Sieb, um Gräten etc. zu entfernen, dünsten Lauch oder Schnittlauch in Fett, geben Mehl zu, dann die Brühe und etwas Salz. Wenn die Suppe kocht, geben Sie feingeschnittene/n Karotten und Staudensellerie und kochen die Suppe, bis das Gemüse gar ist. Zum Schluss schlagen Sie zwei Eier mit etwas saurer Sahne und gießen sie in die Suppe. Fischklöße auf norwegische Art können, aber müssen nicht dazugegeben werden. Das Skarven serviert eine tolle fiskesuppe. Und wir wenden uns der industri und ihren Raubzügen in der norwegischen Allmende zu, denn bisher ist ja das Meer nicht in Claims – das Claimrecht, das Recht, öffentlichem Gelände Schätze zu entnehmen, wurde während des Goldrausches im Süden des nördlichen Amerikas eingeführt – und Parzellen – eindeutig vermessene und begrenzte Teile – aufgeteilt. Herbjorg erklärt mir, die Vorgänger-Regierung hätte die norwegischen Fischereirechte „für alle Zeit“ an die Eigner großer Trawler verkauft und die neue Regierung habe hier einen Kurswechsel erzwungen. mange takk, Geir og Hjerborg!
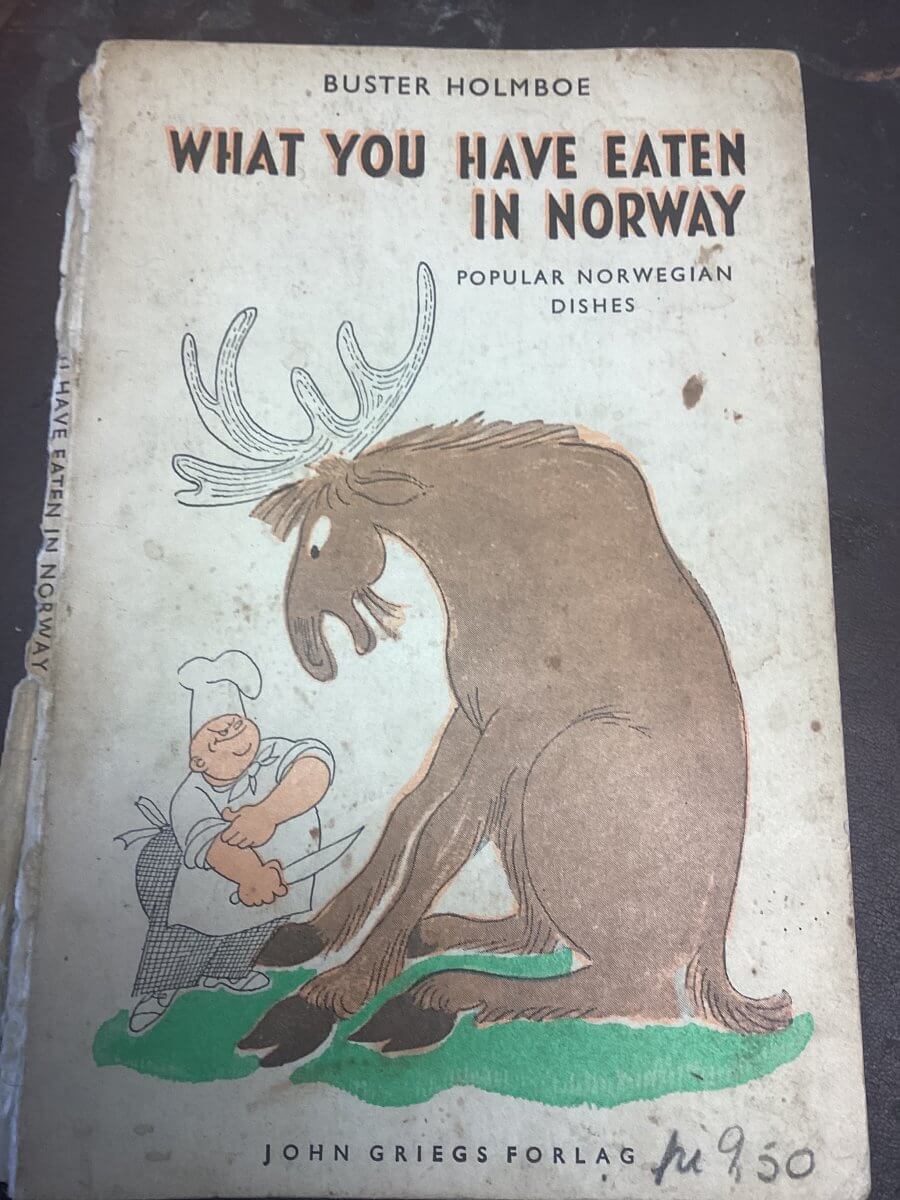
Auch Lachsstücke fischen wir aus der norwegischen Suppe. So kommen wir aufs norwegische „Wirtschaftslachstum“, wie Taras Grescoe den anhaltenden Boom nennt, in seinem mehr als 500 Seiten füllenden Werk „Der letzte Fisch im Netz – Wie wir die wichtigste Nahrungsquelle der Welt retten können – die Meere“. Wir drei wissen das alles ja schon ziemlich lange. Grescoe hat sich auf seiner Reise um die sieben Weltmeere auf die Suche nach dem gemacht, was falsch läuft – und nach dem, was sinnvoller wäre. Die Freunde der Aquakultur sind begeistert, so schreibt der Journalist und Sachbuchautor aus Montreal, von der schönen neuen Welt des billigen Proteins. Ihr optimistisches Drehbuch verdränge die Jäger und Sammler der Meere, die Fischer*innen, durch Züchter und Farmer. „Leider hat die ganze Sache einen Haken, wie die Menschen an der Westküste Kanadas gerade feststellen müssen. Die Fischzüchter plündern die Ozeane, die sie doch zu retten vorgeben.“ In Kanada befindet sich die Lachszucht in den Händen weniger großer Konzerne. Wie auch in Norwegen, wo laut Grescoe die Lachszucht zu grassierenden im Wasser übertragbaren Krankheiten und zur bewussten Vergiftung ganzer Flüsse geführt und so praktisch zur Ausrottung der natürlichen Lachsbestände beigetragen habe. Das sei, so glaubten viele, der eigentliche Grund, warum die Norweger nun nach Kanada kämen. „Nachdem sie ihre eigenen Küsten verwüstet hatten, brauchten sie neues unberührtes Territorium, das sie ausbauen können. … Aquakultur im industriellen Maßstab schert sich keinen Deut um die Wildfischbestände“.
Apfelsinenfarbenes Mittagsleuchten oder Erscheinende Eismöwen
Brauche jetzt erstmal Licht und Luft. Bekomme ich sogleich. Vorm Skarven – der Laden mit dem Kormoran betreibt vertshuset (Wirtshaus), kro (Kneipe), sjømatresturant (Fischrestaurant), biffhuset (Steakhaus) und eine große Terrasse mit Blick nach Osten, zum Festland. Rüber nach Romssavággi (Tromsdalen), das ist einer der drei ziemlich verschiedenen Stadtteile von Tromsø,die zusammen eigentlich alles haben vom Badestrand am Meer bis zum Skilift. Tromsdalen (nordsamisch Romssavággi) liegt in einem Tal (norwegisch dalen), dass sich vom Tromsdalstind (1238 Meter) herunter nördlich Storsteinen (421 Meter) bis zum Tromsøysund erstreckt. Es ist 12:30 Uhr und der Himmel ist leuchtend hell. Allerdings ist die Sonne noch nicht über den Berg. Das alles erfahre ih als Reisende, die immer erst reist, dann liest, dann schreibt erst später. Setze mich erstmal in einer geschützten Nische an einen leeren Tisch und zücke ich entzückt Notebook und Füller. „Why do birds suddenly appear?“ ertönt aus dem Lautsprecher, die Möwen kreisen. Es sind richtig große, ich sinniere, ob es nicht wohl um Eismöwen (Larus hyperboreus) handelt, die bringen es auf gut 80 Zentimeter Flügelspannweite – zum Vergleich: bei der Lachmöwe sind es nur knapp die Hälfte.
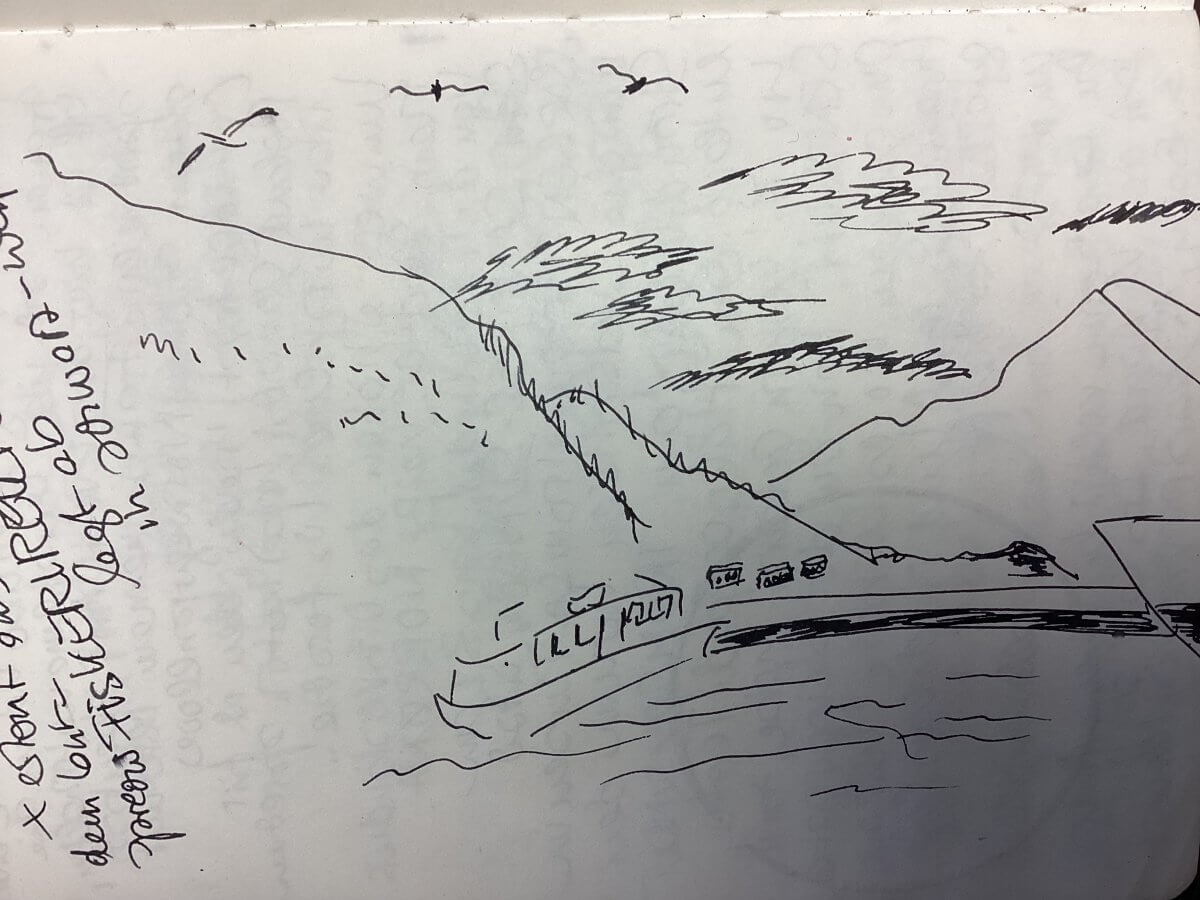
Die da vor pastellblauem Himmel und von hinten unten apfelsinenfarbig angestrahlten Wolken leuchten sehr hell. Die Eismöwe hat im Vergleich zur Silber-und Lachmöwe einen viel helleren Rücken. Sie brütet an den felsigen Küsten Skandinaviens und besucht im Winter auch Häfen. Da haben wir es.

Eismöwe, Птенцы_бургомистра, Larus hyperboreus. Diese wagemutigen Küken wurde auf der Insel Kolguyev gesichtet, о́стров Колгу́ев, in der Autonomen Republik der Nenzen (Не́нецкий автоно́мный о́круг, Ненёцие автономной ӈокрук, romanized: Nenjocije awtonomnoj ŋokruk) bei einer vom Max Planck Institut für Ornithologie im deutschen Radolfzell geförderten Untersuchung des Migrationsverhaltens von Tundrabesucher*innen – birds and science without borders! Von Hobboto4ek – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Vor meinem Zeichenheft legt derweil der schwarz-weiße Dampfer des FISKERIREKTORATET ab, wird die Fischereiaufsicht sein. Quer vor den weißen Bergen im Bildhintergrund – sehr gut ist hier zu erkennen, dass sie die Baumgrenze weit überragen im Gegensatz zu den bis zum Gipfel bewaldeten am Ufer des Sundes, wo ich einzelne Gebäude hinkritzeln kann – liegt ein sehr langer Dampfer. Das Wasser im Hafenbecken leuchtet irgendwo zwischen Abend und Morgen, ebenfalls apfelsinenfarben. Jetzt erklingt norwegischer Jazz.

Vereinzelte Lampen erleuchten diesen leicht fahlen High noon. Licht brennt auch im Løkkekiosken. So heißt er nach seiner ersten Betreiberin. „Entworfen und erbaut 1911 von Baumeister J. R. Erlandsen für die 18-jährige Margit Løkke – Sie besaß und betrieb den Kiosk bis 1929 – Orientalischer Stil – zum Denkmal erklärt 2009“, steht auf dem blauen Emailleschild; „Margit Løkke was the lady that got „the Rocket“ built in 1911. These are photos of her from that time; she was 18 years „old“…. This little kiosk … we who live in Tromsø absolutely adore ist! Don´t you?“, steht auf dem laminierten Schild.

Für die 18-jährige Margit Løkke wurde 1911 der Kiosk entworfen und erbaut, sie besaß und betrieb den ihn bis 1929
Yes, I adore this rocket (der Kiosk wird von Einheimischen auch „die Rakete“ genannt) and this Lady! Ersterer wurde 2009 zum nationalen (!) Kulturdenkmal erklärt. Gro Agnethe Stokke schreibt auf digitaltmuseum.no, er sei ein wichtiges Beispiel für einen Zeitungskiosk aus dem frühen 20. Jahrhundert. In zentraler Lage, an der Kreuzung von Hauptstraße (Storgata) und „byens største og viktigste allmenning“ (der größten und wichtigsten Allmende der Stadt), das ist der große Marktplatz Stortorget, gelegen, spiegele das Gebäude in vorzüglichem und üppigem Maße den Stil seiner Zeit wider.

Ich erwerbe noch ein paar Postkarten, die die Rakete feiern, mit Sommerblumen und Balaenoptera musculus (Blauwal), der den Sommer in den Gewässern vor Romsas Küsten verbringt, wo er reichlich Nahrung findet; mit Tromsøbrua, Nordeuropas größter Spannbetonbrücke, neben Løkkekiosken eines der besonders bedeutungsvollen Objekte der Stadt; mit Ursus maritimus (wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt: Meerbär, üblicherweise Polar- oder Eisbär genannt), der sich Pølse geschnappt hat, aber ansonsten die Robbenjagd um Spitzbergen herum bevorzugt, also in Meeresgebieten, in denen Eis vorhanden ist und durch Wind und Strömung immer wieder aufgerissen und in Bewegung gehalten wird.

Biege vom Sund und von Tromsøs Allmende gesehen links in die Grønnegata ein, zum Aurora Kino, zu den FFN-Shorts 4 im Fokus 2, dem Bonordsalen mit den dick gepolsterten Liegestühlen in der ersten Reihe. Astrid …, Kuratorin der Wahnsinns-Reihe Film fra nord, „the very best films from the high north“, Filme aus Sápmi und dem übrigen Norwegen, Schweden und Finnland; Russland; Kanada, Alaska; Island und Grönland, „inkludert en bred presentasjon av nordlig urfolksfilm“, mit einem besonderen Fokus auf das Filmschaffen der Urvölker, tritt in Kleid und Fellstiefeln vor uns und erzählt uns von den folgenden fünf Kurzfilmen, darunter zwei Weltpremieren, erzählt uns auch von dem roten Faden ihres Programmes: off track! Jenseits der ausgetretenen Pfade.
Sibirische Sehnsüchte oder Wispernde Sterne
Ins neblige Hochgebirge entführt uns Anders Lidin Hansen und zeigt wie eine Wanderung ein norwegisches Paar erschüttert und zerrüttet. Der russische Regisseur Ayaal Adamov nimmt uns mit nach Белая Земля (literarisch: Weißes Land), eine Inselgruppe in der Inselgruppe Земля Франца-Иосифа (Semlja Franza-Iossifa, Franz-Josef-Land), die ich auf keiner Karte finde? Passt doch zum englischen Filmtitel „The Land of Whispering Stars“.
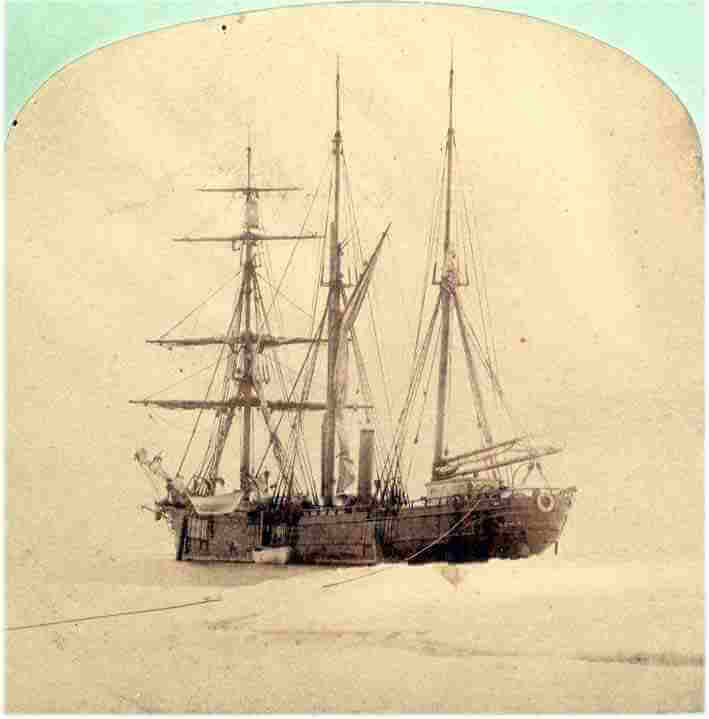
Die Tegetthoff, das Expeditionsschiff von Payer und Weyprecht, den Entdeckern von Franz-Joseph-Land, bei den Barents Inseln vom Eise besetzt. Teil eines Stereophotos.
Im Nachhinein wird mir klar, dass es sich um diese unter Gletschern begrabenen Inseln handelt, welche die Österreicher Julius von Payer, Karl Weyprecht und die überwiegend aus Italien stammende Crew der Tegetthoff auf ihrer österreichisch-ungarischen Expedition – über die einer meiner Lieblingsautoren, Christoph Ranzmayr, in einem meiner Lieblingsbücher, Die Schrecken des Eises und der Finsternis, schreibt – im August 1873 entdeckten.
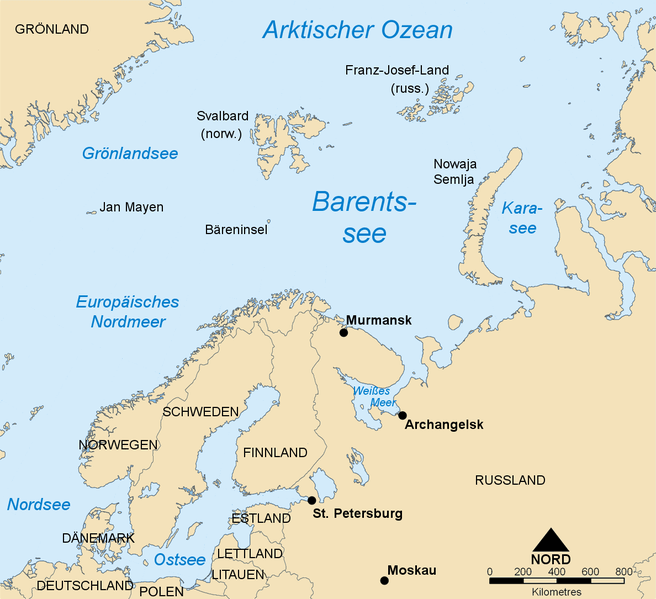
Franz-Josef-Land heutzutage, Von Barents_sea_map_blank.png: Created by NormanEinstein, November 25, 2005. Modified and blanked by historicair 22:27, 28 February 2006 (UTC)derivative work: Hämbörger (talk) – Barents_sea_map_blank.png, CC BY-SA 3.0
Где находится остров Белая Земля? Wo sich die Insel Belaja Zemlja befindet, fragen sich auch andere. Hier die gefühlt-geografische Antwort:
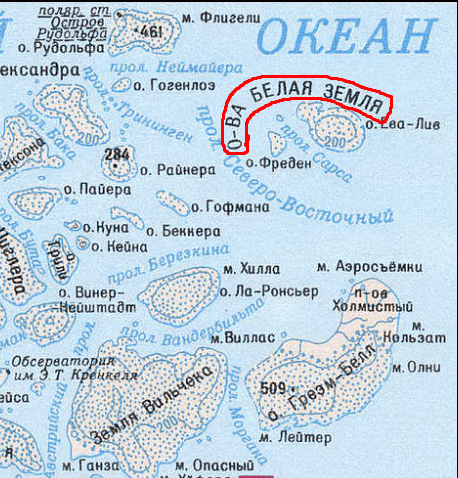
Und dann hilft überraschend wikipedia.it: Belaja Zemlja (in russo Белая Земля, Belaja Zemlja; in italiano Terra Bianca) sono un gruppo di 3 isole russe che fanno parte dell‘ arcipelago della Terra Francesco Guiseppe nell‘ Oceano Arctico; si trovano nella parte nord-orientale dell’arcipelago, a 45 km dal gruppo principale. Dieses weiße Land besteht demnach aus drei unbewohnten eisigen Inseln, liegt im Nordosten des nach dem fernen Herrscher der österreichisch-ungarischen Forschungsreisenden Kaiser Franz Joseph (Francesco Guiseppe) benannten Archipels am äußersten Nordende von Eurasien. Und ist im Film The Land of Whispering Stars wahrscheinlich gar nicht gemeint. Diesen kurzen Dokumentarfilm von Ayaal Adamov habe ich noch immer in den Ohren. Die Partitur hat Elena Rykova (elenarykova.rocks), Komponistin, Performern, interdisziplinäre Künstlerin mit dem Kölner Ensemble Musikfabrik, Marco Blaauw (Trompete), Christine Chapman (Horn) und Melvyn Poore (Tuba) geschrieben.

Elena Rykova (elenarykova.rocks), Komponistin, Performern, interdisziplinäre Künstlerin, hat die Partitur zum Film The Land of the Whispering Stars geschrieben.
Und dann werde ich – der es im zunehmend Nationalstaaten-kleinlicher werdenden Europa langsam zu eng und bedrückend wird, die ich mich hiermit als begeisterte Baltin und enthusiastische Eurasierin bekenne, denn wir brauchen unbedingt mehr Weitblick! – dokumentarisch und geografisch weitergeleitet, lese von der Küste der Laptewsee, diesem Randmeer des Arktischen Ozeans. Das hatten wir schon. Aber noch nicht das Dorf Найба (Nayba) die einzige bewohnte Siedlung im Kharaulakh-(Khara-Ulakkhsky-Gebiet) am Lena-Delta im Distrikt Булун (Bulun, Bulunski), in der Republik Sakha (Yakutien). Das Dorf wird vom indigenen Volk der Ewenken bewohnt, ihr früherer Name, der auch auf den alten Scharz-Weiß-Bildern auftaucht: Tungusen. Ihnen verdanken wir westlichen Akteur*innen, Autor*innen, Artist*innen unsere Schamanismus-Konzepte: Шаманка & Шаман. Es gab in Sibirien zu vielen Zeiten weibliche und männliche Wissensträger, šaman bedeutet in der Sprache der Ewenken jemand, die oder der weiß, zum Beispiel um die Beseeltheit aller Naturerscheinungen.

ScreenShot aus dem Film The Land of Whispering Stars von Ayaal Adamov
Solche animistischen Kenntnisse sind trotz weltweiter Verfolgung, Verdrängung, Unterdrückung nicht ausgestorben, sind scheinbar wirklich kaum auszurotten. Hervey Peoples, Pavel Duda und Frank Marlowe – auch diesen sehr sachdienlichen Hinweis entnehme ich der empfehlenswerten archäologischen Reise zu unseren Anfängen, auf die mich Meller und Michel erfolgreich gelockt haben, Sie wissen schon, es geht ums Rätsel der Шаманка von der Saale – haben festgestellt, dass 100 Prozent der heute lebenden Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, linguistisch und genetisch haben die drei oben genannten Anthropologen 33 Kulturen rund um den Globus, bekennende Anhänger*innen des Animismus sind. Und sie gehen davon aus, dass Animismus weder Religion noch Philosophie sei, sondern „ein Grundzug menschlichen Denkens“. Sámi Ailo Gaup – Iŋgor Ántte Áilu Gaup, genannt Áilloš’ – erfasst diese leicht windigen, manchmal sehr luftigen (das griechische Wort ánemos bedeutet Wind oder Hauch), manchmal auch tonnenschweren Vorstellungen so: „Flüstere zu den Felsen, in dem Versteckten lauscht etwas, nimmt das Wort entgegen, führt es weiter und vollendet es.“

Unsere Schamanismus-Konzepte sowie die Benennung šaman/Шаманка & Шаман verdanken wir Westlichen den Ewenken
Ailo Gaup wurde 1944 in der Nähe von Guovdageaidnu (Kautokeino) geboren, in dem Jahr als der deutsche Kriegsverbrecher Alfred Jodl die vollständige und rücksichtslose Deportation der Bevölkerung und die Zerstörung aller Unterkünfte ostwärts des Ivgovuotna (Lyngenfjords) – weniger als 100 Kilometer östlich von Tromsø befahl.

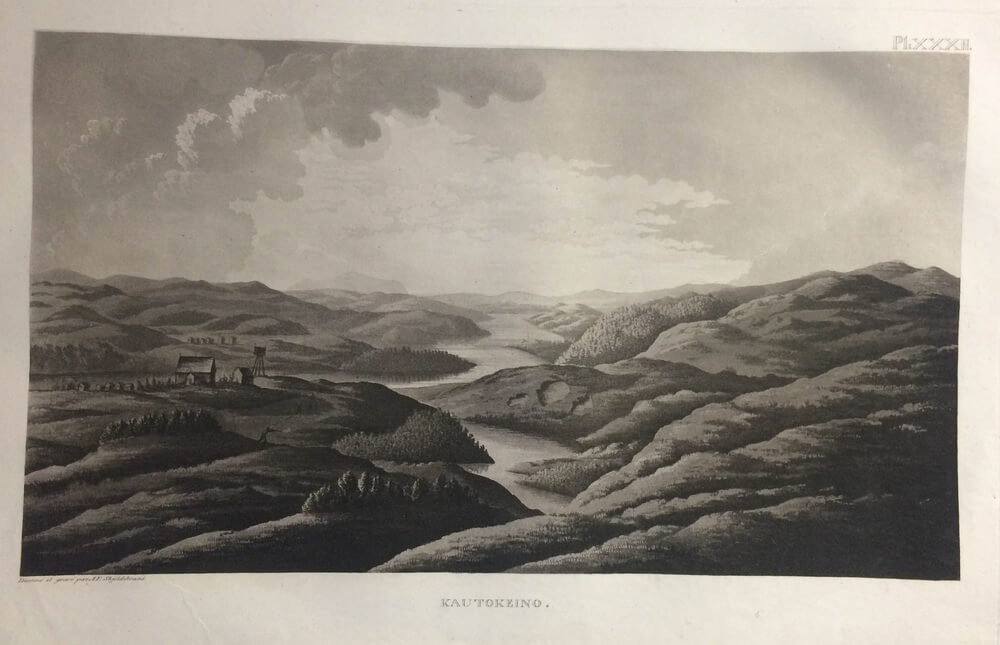
Das Dorf Guovdageaidnu im Juli 1799, Von A.F.Skjöldebrand
Die Order des Wehrmachtschefs, Unternehmen Nordlicht genannt, wird an den meisten Orten in der Finnmark mit der von ihm befohlenen Härte und deutscher Gründlichkeit durchgeführt. Gaup wird nach Süden evakuiert und wächst dort von seiner Familie getrennt als Sámi unter Norwegern auf. In den 1960er-Jahren studierte er in Oslo, arbeitete als Journalist für den Aftenpostenund reiste für eine Reportage zurück in die Finnmark, wo er sich später der Bewegung gegen den Bau des Alta-Staudammes und dem samischen Künstlerkollektiv in Máze (Masi) anschloss. Er wohnte in seinem Geburtsort, beteiligte sich dort 1981 an der Gründung des Beaivváš Sámi Našunálateáhter, fand zu seinen Wurzeln, schrieb über all das in norwegischer Sprache. „Was ich suche, ist das Wissen, das Körper und Seele heilen kann“, sagt sein Held Jon in „Die Feuertrommel“. Das Wissen kehre zurück, herunter von hinter den Sternen und herauf von unter dem Moos. „Wir sind das einzige Volk in Europa, bei dem ein solches Erbe lebendig ist.“
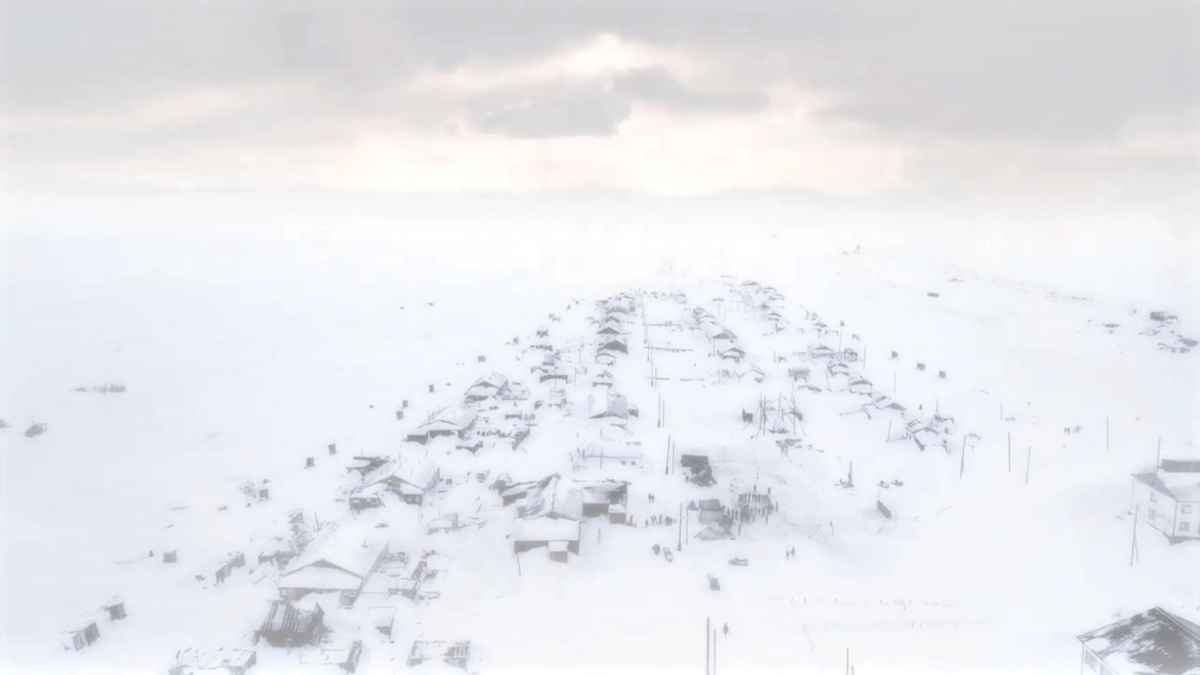
ScreenShot aus dem Film The Land of Whispering Stars von Ayaal Adamov
Nebenan in der russischen Tundra an der Laptewsee hüten dieses mündlich tradierte Wissen die Ewenken. Айаал Адамов, Ayaal Adamov, der 1991 in Яку́тск, Yakutsk, der Hauptstadt der Teilrepublik Sacha (Jakutien) geborene Regisseur, hat sie belauscht beim Erzählen am Feuer, wo sich die Ober-, Mittel- und Unterwelt umspannende Kosmologie entfaltet, die altsibirische Weltauffassung. Nach der die Sterne flüstern – rein physikalisch betrachtet ist dieses Raunen ein bei großer Kälte auftretendes Phänomen: alle innere Feuchtigkeit im kristallisiert beim Ausatmen knisternd – und die besten Rentiere vorm Schlitten vorsichtshalber keinen Namen bekommen. Aber ihre traditionelle Wirtschaftsform, die nomadische Rentierzucht samt (Pelz)-Jagd und (Lachs-)Fischerei – extrem nachhaltig, radikal regional, flexibel – gilt derzeit als „ökonomisch nicht lohnend“. Und ihr zukunftsweisendes Wissen kommt noch nicht bei allen Entscheidungsträger*innen an … Sie werden weniger, die Ewenken in Nayba. Es kommt ihnen manchmal vor, als hätten sie nie existiert. Durch Adamovs Dokumentation wachsen sie mir ans Herz samt ihrer so ruhig erzählten Arktis-Stories.

Junge Ewenk*innen, etniasdelmundo.com
Und ich träume mich noch mal kurz in den riesigen Kreis meiner Träume, das ist nämlich der Эвенкийский автономный округ, der Autonome Kreis der Ewenken, verwaltungstechnisch ein 767.600 Quadratkilometer umfassendes ehemaliges Subjekt der russischen Föderation, ihr einwohnerschwächstes und am dünnsten besiedeltes; beseelt ein riesiges Bergland (Среднесибирское плоскогорье) auf jedem Globus auf halber Strecke zwischen Ural und Pazifik auszumachen; eine Großlandschaft zwischen großen Strömen – Енисей und Лена – die zu den längsten der Erde gehören und in den Arktischen Ozean münden; durchzogen von zwei rechten Nebenflüssen des Енисей (Jenissei), der Unteren und der Steinigen Tunguska; bewaldet mit тайга (den Älteren klingt vielleicht noch Alexandra im inneren Ohr: „Sehnsucht heißt ein altes Lied der Taiga“, wobei ich diese Sehnsucht samt korrekter Betonung: Taigá! eher von meiner Großmutter geerbt habe), dichtem, undurchdringlichen, oft sumpfigem Nadelwald, mit reichhaltigem Unterholz aus Beerensträuchern (bekommt eine mit, wenn die Transsibirische Eisenbahn mal hält und sie bei den örtlichen Babuschkas auf dem Bahnhof shoppen geht, die sagen, die Vitamine eines großen Bechers getrockneter Waldbeeren bringen dich durch den Winter), wie es ihn nur auf der Nordhalbkugel gibt, weil auf der anderen Seite des Äquators schlicht die Landmassen fehlen fürs „Schnee-Wald-Klima“ und auch Βορέας, der Gott des Nordwindes, von dem die тайга ihren wissenschaftlichen Namen hat: Borealer Nadelwald.

Dort wächst auch Pinus sibirica bis zu 40 Meter in die Höhe, die Sibirische Zirbelkiefer, manchmal auch Sibirische Zeder genannt, das aus den Zapfen gewonnene Zedernuss- oder Zirbelnussöl ist schon seit dem 19. Jahrhundert eines der wenigen Exportprodukte dieser mittelsibirischen Sehnsuchtslandschaft. Ihren äußersten Süden durchfließt die Ангара́, ein weiterer Nebenfluss des mächtigen Енисей. Dort lebt ein anderes bedrohtes kleines indigenes Volk. Die Tofalaren sind wie die Ewenken nur oberflächlich christianisierte Animist*innen.

ScreenShot aus dem Film The Land of Whispering Stars von Ayaal Adamov
Es heißt, der staatlich verordnete Atheismus in der Sowjetunion, die damalige Abschaffung des Patriarchats der Russisch-Orthodoxen Kirche habe zwar manche Anhänger*innen deren rechter Lehre Gottes in den Untergrund getrieben, bezüglich der altsibirischen animistischen Weltauffassung nichts umwälzen können. Sie kommt ohne Götter und Patriarchen aus und wird über Storytelling transportiert, bis heute. In die Reihe der Erzähler füge ich nun einen 1937 geborenen russischen Schriftsteller und Umweltaktivisten ein: Валенти́н Григо́рьевич Распу́тин, Walentin Grigorjewitsch Rasputin,, hat mir schon vor Jahren die Tofalaren dicht ans Herz gelegt, mit seinem Kinderbuch „Der Junge, der Fluss und der große Wald“. Es dient mir in Zeiten des imperialistischen und patriarchalen und chauvinistischen Unfriedens als utopischer Reiseführer. „Eine Geschichte im strengen Sinne ist es gar nicht, was Rasputin erzählt. Fast zur Hälfte kommt es als lockere Bilderfolge daher, die sich zu einem Hohelied auf Sibirien, genauer auf das Gebiet um den Baikal und die Angara rundet.
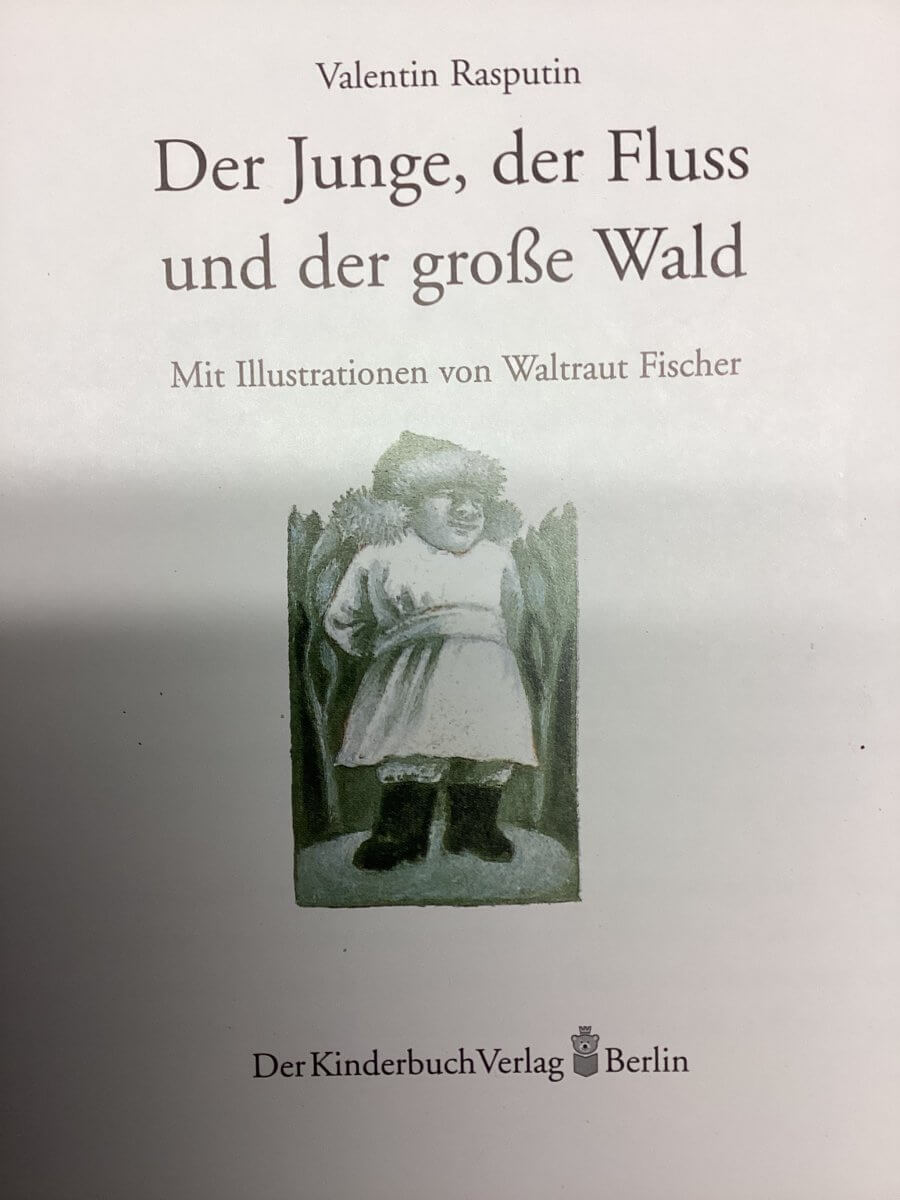
Naturbeschreibungen voller Poesie und plastischer Bildhaftigkeit bezeugen Rasputins Heimatliebe. „Nie, möchte ich behaupten, könnten solche Beschreibungen aus rein äußerlicher Begeisterung für eine Landschaft entstehen: „Wenn die Winde toben, grüßen die Berge einander, indem sie sich mit den Zweigen der Bäume zuwinken.“ Die Art und Weise, wie Walentin Rasputin sich das ideale Verhältnis von Mensch und Natur vorstellt, wirkt bis in die Struktur dieses kleinen Buches hinein: die Passagen, in deren Mittelpunkt der Junge Sanja steht, fügen sich nahtlos und in keiner Hinsicht exponiert in das Ganze ein.“ So schreibt Dr. Eckhard Ullrich 1988 in der Tribüne, einer „Zeitschrift zum Verständnis des Judentums“, die 2012 eingestellt wurde, unter dem Titel „Sibirische Ansichten der Sehnsucht nach Harmonie“. Animist*innen gibt es überall …
Indigene Informationen oder Schmelzender Kesselkamm
Der dritte Kurzfilm holt mich zurück zu meiner Anreise vor nur erstaunlich wenigen Tagen, an den Duortnosjávri, wie er in der Sprache der einheimischen Lulesamen heißt, den Torneträsk – an diesem 70 Kilometer langen See ist unser Nachtzug entlanggefahren – beamt mich in Off-pist-Höhen, lässt mich sicher landen mit den schwedischen Snowboarder*innen Kajsa Määttä und Viktor Björnström. Ihre Doku Tracks von zeigt das absolute Abheben im Schnee, ihr immenses Geschick auf den Brettern, ihre immense Liebe zur verschneiten Natur, zu all dem, was sie „für selbstverständlich hielten, was wir riskieren zu verlieren“.

Als professionelle Kenner*innen des Fjäll (schwedisch), Fjell (norwegisch), der Berge und Hochflächen oberhalb der Baumgrenze, sind sie hochgradig besorgt über immer häufigere „zero-crossings“, immer häufigeres Tauwetter. Der Torneträsk ist im Jahresdurchschnitt einen Monat kürzer zugefroren als in ihrer Kindheit, die nur zwei Jahrzehnte zurückliegt. Sie haben Klimaforscher*innen ausgefragt und gelernt, dass in den Polarregionen das vom Menschen radikal veränderte Klima die Natur schneller zerstört als anderswo. „Wir verspielen etwas“, kritisieren die sportlich wagemutigen Snowboarder*innen, die den Mut zum Risiko auf keinen Fall auf die Schneewelten des Torneträsk ausdehnen wollen, wo die Schnee-Saison immer kürzer wird, die kalten Winter ausbleiben. Seit 2010 ist es dort im hohen Norden nicht mehr richtig Winter geworden.

Tracks ein Dokumentarfilm der schwedischen Snowboarder*innen Kajsa Määttä und Viktor Björnström
Määttä und Björnström haben Keith Larson aufgesucht. Als evolutionären Ökologen und Kommunikator bezeichnet er sich, erforscht, wie indigenes und lokales Wissen zum Verständnis des Ökosystemwandels in der Arktis beitragen, ist Direktor des Arktis-Zentrums der Universität Umeå, lebt und arbeitet zur Zeit am Duortnosjávri/Torneträsk. Dort, in Abisko, einem Kleinort (schwedisch småort), einer Siedlung mit weniger als 200 Einwohnern, koordiniert Larson die Klimafolgenforschung. Dort, „in the field“, macht er auch atemberaubende Fotos (arcticcirc.net) und lässt sich vom Draußensein und der täglichen Naturerfahrung inspirieren. Auch seine Tochter tritt im Kurzfilm auf. Sie halte den Torneträsk für den Ozean, erzählt der Forscher. Und kommt dann auf das dahinschmelzende „cooling system“ der Erde zu sprechen. Schnee und Eis im hohen Norden reflektieren die Energie und bremsen so die Erderwärmung ab. Wenn sie nicht abschmelzen wie im Nationalpark Vádvečohkka (schwedisch Vadvetjåkka) der Gletscher Čunujökeln. Den gibt es schon seit 2017 nicht mehr. Der 1920 westlich des Torneträsk eingerichtete und schwer zugängliche Nationalpark schützt die hochnordische Gebirgslandschaft der Provinz (schwedisch län) Norrbottens län.
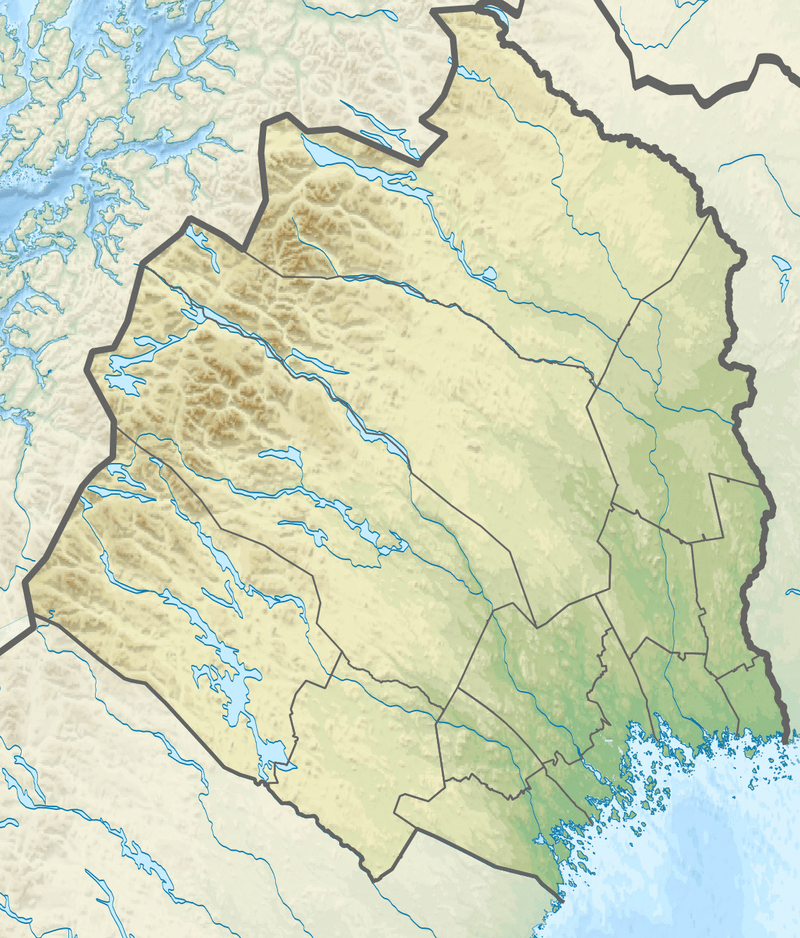
Torneträsk: der lange See oben links nahe der schwedisch-norwegischen Grenze
Die hat weitere Naturschätze zu bieten: hier befindet sich Schwedens höchster Berg der Giebnegáisi (schwedisch Kebnekaise, übersetzt in etwa Kessel-Kamm (2111 Meter)) von dem Lagerlöfs Leitgans stammt. „Ich bin der, den man Däumling nennt und der mit den Wildgänsen reist …“. Das kann er für Deutsch Lesende so, wie sich seine Schöpferin Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf es vorgestellt hat, erst mehr als hundert Jahre nach dem Erscheinen dieses wunderbaren Reiseberichtes. Denn „Nils Holgerssons underbara resa genomm Sverige“ liegt erst seit 2014 vollständig ins Deutsche übertragen vor, und hat 700 Seiten, die sich allesamt total spannend lesen. Thomas Steinfeld, der Übersetzer, hat es geschafft, das schöne Schwedisch von Lagerlöfs Epoche im wahrsten Sinne des Wortes zu übertragen, quasi über die Ostsee zu schippern in die Jetztzeit. In seinem Nachwort gibt er Nachhilfe: Im 49. Kapitel würde Lagerlöf auftreten, in Gestalt einer Schriftstellerin, „die ein Buch hätte schreiben wollen, „das sich für Kinder in der Schule eignet“, die darüber monatelang nachgedachte und noch keine Zeile geschrieben habe. Ihre selbstgestellte Aufgabe bestand darin, die Lebensweise ihrer Zeit und ihrer Heimat darzustellen und für spätere Generationen zu bewahren. Nicht nur der Nobelpreis, sie war die erste Frau überhaupt, die ihn erhielt, beweist, dass ihr das generationenübergreifende Storytelling spitzenmäßig gelungen ist. Ich bin beim Lesen total beeindruckt von ihrem Nachhaltigkeitskonzept. „Leider“ bin ich ja Limnologin (Süßwasserkundlerin) geworden und keine Literaturwissenschaftlerin, sonst hätte ich ja meine Magistra-Arbeit über Lagerlöfs Tipps zum Umgang mit Ressourcen zum Wohle aller Wesen schreiben können. Keine Angst, dies ist nur ein sehr langer Blog…:) Extrem ausschweifend, aber nie vollständig. Wenn eine über längere Zeit Material gesammelt hat, kann ihr schon mal die Struktur abhanden kommen. Lagerlöf war Ende 40, als ein Riesenhaufen geografischer und naturkundlicher Informationen und mündlich überlieferten lokalen Erzählungen ihr den Weg zum Schreiben verstellte. Sie begibt sich, so könnten wir der Begegnung mit dem wichtigen Wichtel auf dem Herrenhof, „der weit entfernt vom Rest der Welt lag“ interpretieren aufs Gut Mårbacka, etwa mittig zwischen Christiania (seit 1924 Oslo) und Stockholm. Dort ist sie geboren, dort ist sie weit genug entfernt vom Druck dessen, was sich später als eines der größten Publikationsprojekte des damaligen Schweden herausstellte. Abgesehen von ihrer selbstgestellten Aufgabe (s.o.) wollten Lehrerverband und Unterrichtsministerium von ihr ein Geografie- und Naturkunde-Lesebuch, das Eigenart und Größe ihrer Heimat mit Rücksicht auf die Phantasie von Neun-bis Elfjährigen erzählt. Hat geklappt. Erst später enthüllen Wissenschaftler*innen die äußerst raffinierte Technik dieser Zauberin. Und auch 68-Jährige vertrauen sich Akka von Kebnekaise an. Genau, wir landen!
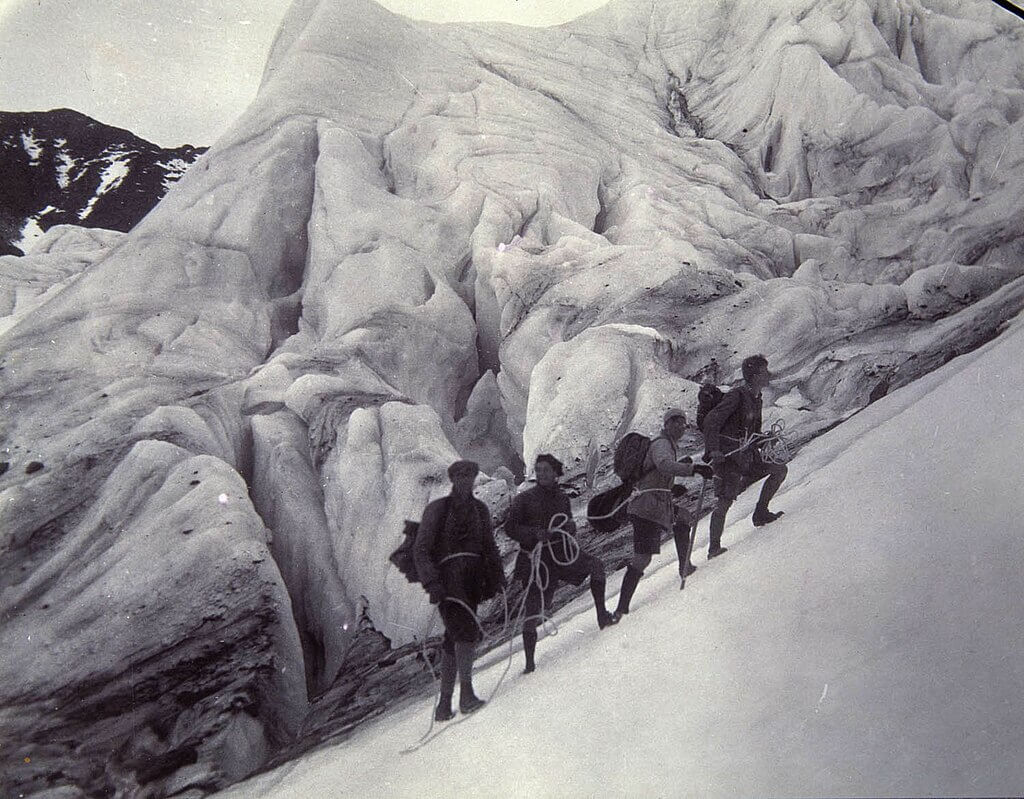
Besteigung des Kebnekaise in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Ernst Herrmann
Bei Lagerlöf heißt der Doppelberg Kebnekajse und liegt im äußersten Norden Lapplands. Das meinte sich sicher nicht abwertend. Auf Russisch heißt diese nordeuropäische Landschaft Лапландия, auf Finnisch lappi, auf Norwegisch und Schwedisch lappland. Der niederländische Kartograf Joan Blaeu wählte den lateinischen Namen Lapponia und ließ es südlich bis auf die Höhe des späteren Oslo und nach Nordwesten bis zu Lofuohta, den Lofoten, reichen, zumindest einige der 80 Inseln vor der Küste des heutigen Nordnorwegens sind drin.
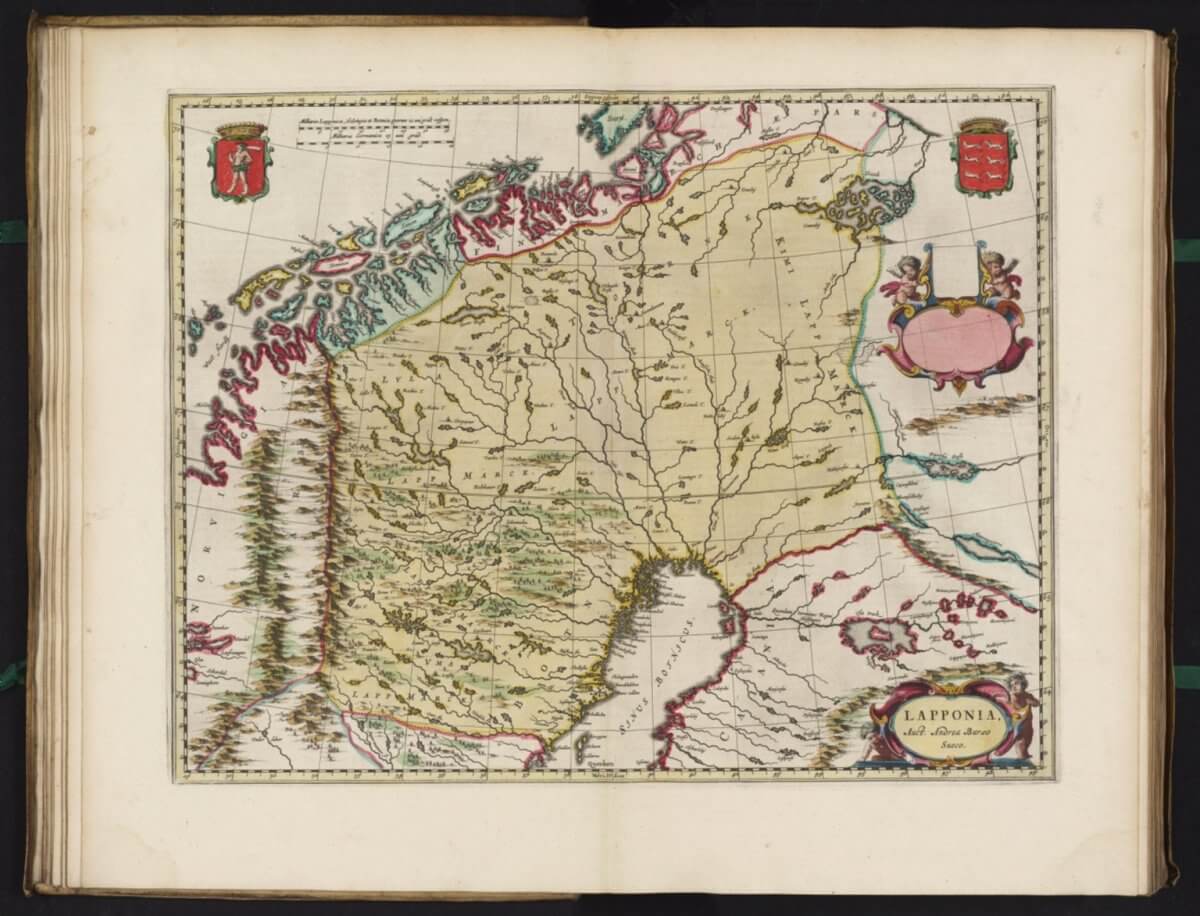
Lapponia auf dem Atlas Maior des niederländischen Kartografen Joan Blaeu
Im Nordosten umfasst Blaeus Laponia die Halbinsel, auf der es unter anderem Multebeeren gibt, die auf Samisch Guoládatnjárga und auf Russisch Кольский полуостров heißt, um nur zwei Sprachen zu nennen, in denen sie auftaucht. Auf Kola, wie der östliche Teil von Fennoskandinavien auf Deutsch heißt – die Deutschen sind dort bisher überwiegend als kriegführender Part aufgetaucht, abgesehen von vereinzelten Abenteurer*innen und Bewohner*innen von Kreuzfahrtschiffen – 17 Nächte Russland incl. Nordkap kosten knapp 20.000 € – war, wie Steinmalereien und -labyrinthe zeigen, schon vor mehreren tausend Jahren besiedelt. Über lange Zeiten kamen Menschen zu ihren heiligen Plätzen dort. Im ersten Jahrtausend vor Christus lebten dort wahrscheinlich nur Sámi-Clans, Siida, die ursprünglichen lokalen Gemeinschaften der späteren samischen Völker. Ihr Sápmi besiedelten sie in seiner heutigen Ausdehnung etwa ab 100 vor Christus. Im 12. Jahrhundert stießen an der Südküste der Halbinsel Kola, die помо́ры (auf Russisch bedeutet das Küstenvolk, auf Deutsch heißen diese russische Siedler*innen Pomoren), sie kamen überwiegend aus Но́вгород (Novgorod) übers Бе́лое мо́ре (Weiße Meer) – und trugen Norwegerpulli und Elbsegler, so sieht es jedenfalls auf dem Foto aus, das ich gerade aus dem weltweiten Netz gefischt habe.

Novgorod war im späten Mittelalter auch ein wichtiger Handelsplatz für die Sámi, die dort ihre Pelze anboten, Apollinarij Vastnetsov; «Novgorod torg» (1909]
Sie kamen vom Белое море (Beloye more), dem Weißen Meer, in das – gezwungen durch den Ersten Weltkrieg – auch meine Urgroßeltern mütterlicherseits stachen, deren Urahnen väterlicherseits aus dem Rheinländischen kommen. Sie gingen am Ende des Ersten Weltkrieges an Bord eines Dampfers, der sie aus ihrer heißgeliebten Heimat im inzwischen ehemaligen Zarenreich nach Westen brachte, wo sie in Berlin weitermachten. Aber das ist eine andere „Siedler-Story“.

Mitten in jenem Krieg, 1916, gründen die Romanows, sie sollen vom legendären litauischen Geschlecht des legendären Prinzen Glauda Kambila entsprossen sein und herrschten bis zu dessen Ende über ihr offiziell als All-russisches Imperium bezeichnetes Reich, Романов-на-Мурмане (Romanow-na-Murmane, auf Deutsch heute Murmansk). Als Мурман (Murman) wurde damals in Russland die Nordküste der Halbinsel bezeichnet. Dieses russische Wort stammt wiederum aus dem Norwegischen und bedeutet ursprünglich Nordmänner, Norweger. Die romowsche Stadt an der Küste mit dem norwegischen Namen war Haltestelle der Murmanbahn. Diese Anbindung an Petersburg wurde im Ersten Weltkrieg von 60.000 österreichisch-ungarischen und deutschen Kriegsgefangenen, von denen 25.000 beim Bau umkamen. Ziel des mörderischen Vorhabens war die Versorgung des Russischen Kaiserreichs mit Rüstungsgütern ihrer Alliierten Großbritanniens und Frankreich, um den damaligen Wahnsinn mal zu detaillieren. Auch mein Urgroßvater und mein Großvater waren in diesem Krieg in zaristischer Gefangenschaft, aber anderswo. Während des nächsten Weltkrieges unternahmen die deutschen „Eismeerjäger“ Luftangriffe auf die Bahnlinie, die wieder enorme strategische Bedeutung hatte, von einem Standort am Fuße der Halbinsel Kola, der auf Skoltsamisch Peäccam, auf russisch Печенга, auf Finnisch und Deutsch Petsamo heißt, um die vielen örtlichen Player auf den Plan zu bringen. Der Abzweiger der Murmanbahn in das damals fast ausschließlich von Skoltsamen bewohnte Gebiet Peäccam stellte Anfang des 20. Jahrhunderts die nördlichste Bahnstrecke Europas dar.
Über den Wahnsinn, der sich dort jetzt wieder entfaltet, müsst ihr euch bitte (!) aktuell in formieren – leider ist Murmansk weiterhin von größtem imperialistischen Interesse. Die Ausbeuter*innen aller Länder werden unter anderem von umliegenden Bodenschätzen, Flotten, einem dank Golfstrom ganzjährig eisfreien Hafen, der im Zweiten Weltkrieg als Nachschubhafen der Alliierten diente angelockt, wie die sommerlichen Mücken von der Tundra. Wir konzentrieren uns auf die Moltebeeren (hjortron) und die auf Kola ansässisgen Forschungsinstitute, deren internationale Wissenschaftsprojekte in Sachen Artis zur Zeit leider einfrieren. Science must go on! Миру Мир!
Dystopische Diktaturen oder Magische Muttersprachen
Akka ist das egal. Einerseits ist sie vor dem Ersten Weltkrieg, den manche die größte Katastrophe der Menschheit nennen, unterwegs, andererseits verabscheut sie Menschen – aus Gründen. Und Nils hört allen zu. So hat der Däumling vom alten Sámi gehört, was der dem Schweden, der nördlich noch nie über Harnösand am Bottnischen Meerbusen (mittig zwischen Luleå und Stockholm) hinausgekommen war, unterbreitet hat, eine geografisch-naturkindliche Story, auch Sage genannt. Sie handelt von den Vogelvölkern (Wald-, Flachland-, Meeres-,Wasser- und Bergvögeln) „südlich des großen Samenlandes“, die Späher aussandten, die Nistplätze, Futter und Verstecke im Norden auskundschaften sollten. Die Sturmmöwe (Larus canus) stellt fest, es sei ein gutes Land da oben im Norden, voller fischreicher Sunde und bewaldeter Landzungen und Inseln. „Die meisten von ihnen sind unbewohnt und die Meeresvögel werden auf ihnen hinreichend Nistplätze finden.“
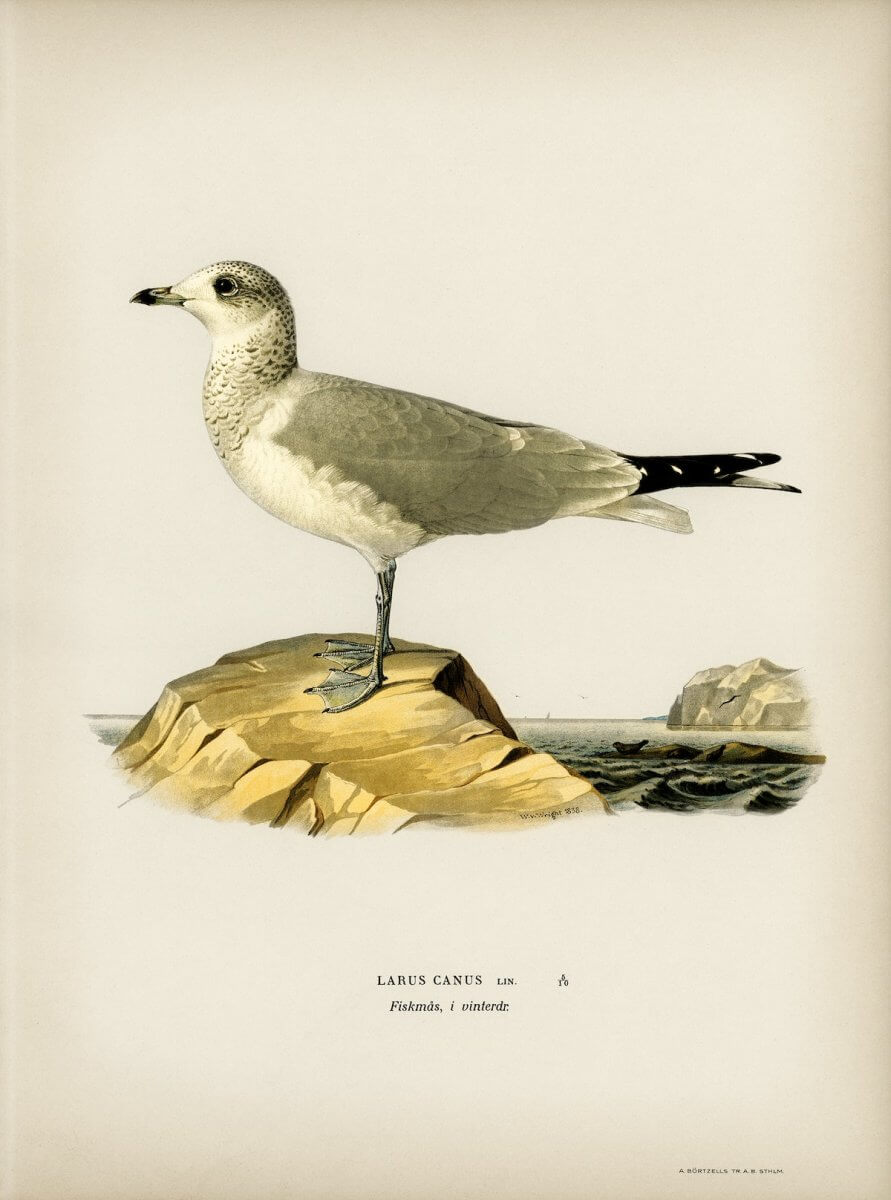
Nun spricht die Lerche. Die Alaudidae, die Großfamlie der Lerchen, umfasst 90 Arten, die Lagerlöf ihren jungen Leser*innen nicht zumutet. Sie sollen ja vor allem etwas über Lebensräume lernen. Die Alaudidae schwingen sich trällernd in die Luft, lassen unser Herz aufgehen und sind ansonsten allesamt schlichtgefiederte Bodenbewohner. Sie brauchen brauchen Flachland, am liebsten menschenleer, die größte Artenzahl weist Afrika aus, gefolgt von Asien. Im Norden singt die Ohrenlerche (Eremophila alpestris, die Männchen protzen mit schwarzen Feder“ohren“). Sie singt etwa so wie die Feldlerchen der offenen Agrarlandschaften im restlichen Europa und brütet in den Kältesteppen (Tundren). Und zwar schon lange. In Jakutien fand man den 42.600 Jahre alten gefrorenen Kadaver einer Ohrenlerche.
Als nächstes erzählt der alte Same dem Schweden was vom Auerhahn.Da müssen wir jetzt mal gendern, denn der aufgeblasene Kerl, der bei der Balz den Schwanz fächert wie ein Pfau, ist in biologischer Wirklichkeit das männliche Auerhuhn (Tetrao urogallus) und sein berühmter Balzgesang in den frühesten Morgenstunden – „telak telak – tick tick tick – titock -, den ich leider nie life gehört habe, klingt eher nach hölzerner Percussion und Sensenwetzen als nach Arie. Trotzdem wollen wir diese Vogelart, den größten Hühnervogel Europas richtig wichtig nehmen. Hahn und Henne. Mein auf unzähligen Exkursionen zerfledderter „Parey“ (die 1972 in London erschienene Originalausgabe dieses Vogelbuches hieß „The Birds of Britain and Europe“, lange vorm Brexit:)) sortiert sie zu den Rauhfusshühnern, wegen ihrer gefiederten Läufe. Ansonsten hätten sie wie alle Hühnervögel kurze runde Flügel und würden, besonders beim Auffliegen, ein purrendes Fluggeräusch verursachen. Und der Parey gibt Lagerlöf recht: Die Waldvögel haben mit Tetrao urogallus genau den richtigen Späher gewählt. Er kennt sich mit Nadelwaldungen samt reichem Unterwuchs an Beerensträuchern bestens aus und kehrt mit klarer Meinungsbildung aus Sápmi alias Laponia zurück, hat dort nichts anderes gesehen als Kiefern- und Fichtenwälder. „Alles was nicht Moor oder Fluss ist, ist dunkler Nadelwald“. Auerhuhn und -hahn fliegen vor allem auf die Taiga Nord- und Osteuropas. Und die Struktur dieser borealen Nadelwälder habe sich, seit Naturkennerin Lagerlöf vor fast 100 Jahren über die Vogelvölker Schwedens schrieb, durch, wie es bei Wikipedia heißt, „moderne“ Forstwirtschaft „nachteilig verändert“. Aber sie beherbergen immerhin noch 1,5 bis 2 Millionen dieser rauhfüßigen Waldhühner.
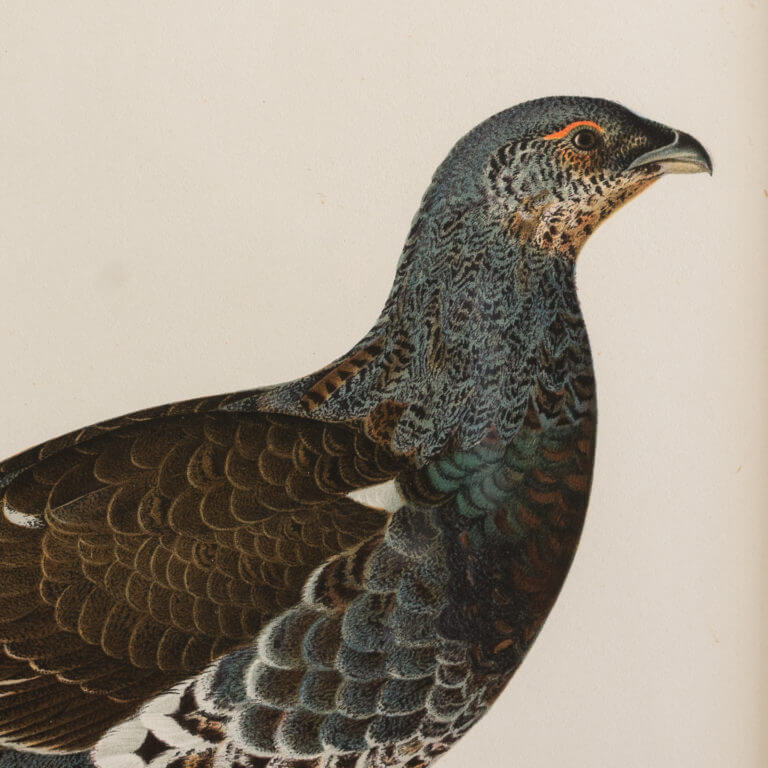
Die Wasservögel haben als Kundschafter einen Taucher gewählt. Es wird sich um einen Angehörigen der Seetaucher (Gaviidae) gehandelt haben, denn Lappentaucher wie der Haubentaucher kommen im hohen Norden nicht vor. All diese Taucher tauchen von der Wasseroberfläche aus und sind extrem ans Wasserleben angepasst. Die Seetaucher wie der Pracht- (Gavia arctica) oder Sterntaucher (Gavia stellata) halten sich im Winter auf eisfreien Flüssen oder in Küstengewässern auf, ihre Nester errichten sie an Binnengewässern. Daher schwärmt der nach Norden gesandte Wasservogel von den vielen Seen: „es gibt fast kein Land dort oben“. Zwischen schönen Ufern würden tiefblaue Bergseen glitzern, „die sich in donnernde Wasserfälle ergießen.“

Schneeammer (Plectrophenax nivalis)
Die Schneeammer (Plectrophenax nivalis) – um das schon mal vorwegzunehmen: sie ist der einzige Singvogel auf der Inselgruppe svalbard, die auf Deutsch nach ihrer Hauptinsel spitsbergen Spitzbergen heißt – hat sich bei ihrem Erkundungsflug an den Verlauf der Riksgränsen, der Grenze zwischen Schweden und Norwegen, gehalten. Sie fliegt gen Norden entlang der höchsten Höhen der Skanden, des skandinavischen Gebirges, das die Halbinsel vom Skagerrak bis zum Nordcap durchzieht, von Jotunheimen bis zur Finnmark. Als Vogel der nördlichen Breiten und Angehörige der Familie der Tundraammern brütet sie oberhalb der Baumgrenze auf der Fjell-Tundra und hat oben im Norden „keine Bauern, keine zahmen Tiere, keine Höfe“ entdeckt, aber Rentiere und Sámi und deren Koten; Böden, die mit Weiden, Zwergbirken und Flechten bedeckt sind, gefunden und ein großes Gebirgsland, … Hochland neben Hochland“. In dessen Norden befördert den Däumling der Adler. Es wird ein Steinadler (Aquila chrysaetos) sein, denn dieser sehr große Greifvogel errichtet sein Nest an Felsen. Und er gleitet und segelt majestätisch, leicht, elegant, oft stundenlang, mit breit gefingerten Schwingen. Früher war diese Art in Europa und anderswo weit verbreitet, sie wurde aber vielerorts verfolgtund hat sich in abgelegene Gebirgsgegenden zurückgezogen, wie das Kebnekaise-Massiv.
Früher (seit 1880 wird gemessen) war dessen vergletscherter sydtoppen, der Südgipfel, höher als der felsige nordtoppen, 2018 war er das erste Mal niedriger. „Es ist nicht hoffnungslos!“, betont Larson und Snowboarderin und Filmemacherin Määttä ruft uns zu: „Die Winter liegen in eurer Hand!“
Helfende Haldí oder Kolonialisierte Ortsbezeichnungen
Der vierte Kurzfilm irrt mit uns durch ein leerstehendes kanadisches Hotel, der fünfte greift eine Sámi-Legende auf über einen Kampf zwischen – Ja, zwischen was und wem? Das weiß ich nicht – auf. Mojunjálmmiid, der samische Titel, bedeutet: mit einem Lächeln um den Mund. Das ist Asta Mitkijá Balto vergangen. Ich treffe sie vorm Kino, ungefähr an der gleichen Stelle wie beim ersten Mal. Sie protestiert kurz und heftig gegen die Darstellung samischer Männer im oben genannten Film als ausschließlich brutale Täter.

Waldfrau Háldi, eine mythische Gestalt der Sámi, in Eadni/Mother von Liselotte Wajstedt
Balto ist als Freelancerin nie ohne Arbeit und unter anderem ehemalige Präsidentin der Sámi allaskuvla (SA), der 1989 gegründeten samischen Hochschule in Guovdageaidno. Das höre sich doch auf davvisámegiella (Nordsamisch) viel schöner an als der kolonialisierte Name Kautokeino? Diese Frage der Professorin ist suggestiv, ich stimme trotzdem gerne zu, betört von wilden und weichen Tönen – wo sie sich unter anderem auf die Arbeit mit und fürs Sámi konzentriert hat, eine Gruppe von elf nahe verwandten Sprachen, von denen fünf fast oder gänzlich ausgestorben sind, die wie magyar nyelv (Ungarisch), suomen kieli (Finnisch), eesi keel (Estnisch) zum Uralischen gerechnet werden. Wobei dessen ugrischer bzw. ungarischer ebenso wie der jukagirische Zweig in Саха Сирэ (Sacha, Jakutien und noch weiter nordöstlich in Sibirien) schon ziemlich abgedriftet auf der Sprachlandkarte erscheinen, und der permische, zu dem die Sprache der Komi gehört, eine Mittelachse knapp westlich des Urals bildet. Wir driften jetzt mit Asta ins verzeigte und gebündelte Gebiet ihrer Commitments: Pädagogik und Weitergabe von Kultur, Dekolonialisierung und Vitalisierung. Selbstgewählte Hauptaufgabe ist ihr, akademische Kenntnisse zu verbinden mit dem Wissen der Sámi-Gesellschaft. Deren Essenz wiederum hat Balto forschend in der traditionellen Kindererziehung herausdestilliert. Kurz vor ihrem Abflug klärt sie mich über Háldi auf. Die sei eine Helferin, eher Heilige als Hexe, lebe unter der Erde, manche ihrer heiligen Berge hätten die Sámi nach ihr benannt.

Indische Haldi-Zeremonie
Über sieben Berge muss die geistige Pfadfinderin gehen – und stolpert dabei doch tatsächlich auch über das von ihr extrem bewunderte Altai-Gebirge und eine eher asische als eurasische Haldi-Zeremonie (We are all one! so begrüßte mich der Festivalmanager 2017 als einzige „european“ auf seiner beglückenden Veranstaltung BOTETHO, aus dem Russischen ins Amerikanische transkribiert: What Ethno? in der Autonomen Republik Altai…:)) und dann: der Háldi (nordsamisch), Haltitunturi (finnisch, wobei tunturi Gebirge bedeutet) gilt mit einer Höhe von 1324 Metern als höchste Erhebung Finnlands, wobei der 1331 Meter hohe Gipfel Háldičohkka und das 1361 Meter hohe Massiv Ráisduottarháldi (kvenisch Raisin Haltii) sich in Norwegen befinden. Die spinnen die Finnen – und die anderen Grenzzieher*innen ebenso – finde ich als Grenzfahrerin. In Norwegen gab es von 2015 bis 2016 Überlegungen, Finnland zum 100. Jubiläum der finnischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 2017 den 1331 m hohen Nebengipfel Háldičohkka zu schenken. Dazu wäre eine Verlegung der finnisch-norwegische Staatsgrenze um etwa 200 m notwendig gewesen. Im Oktober 2016 wurden diese Pläne von der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Stolberg aufgrund hoher juristischer Hürden abgelehnt. Und man versucht sich zu orientieren:
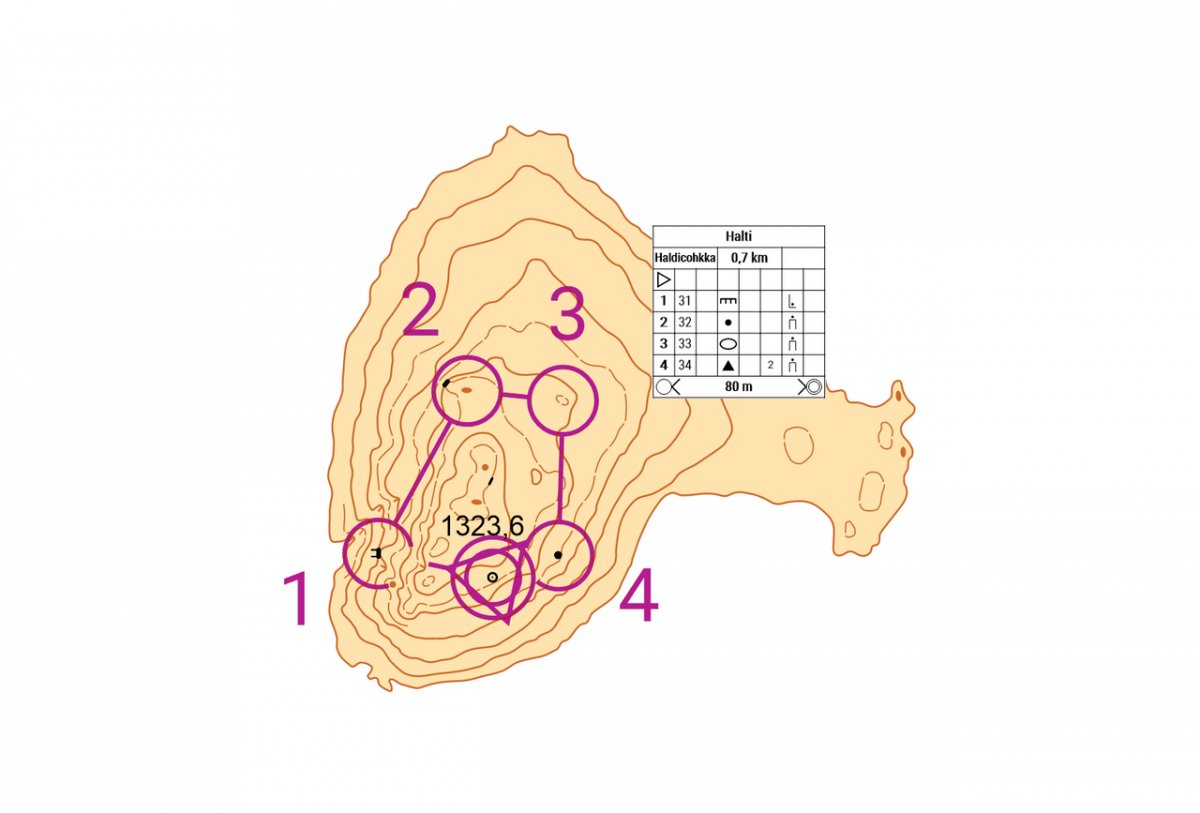
Orientierungskarte, Von Timolaurus – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92949103
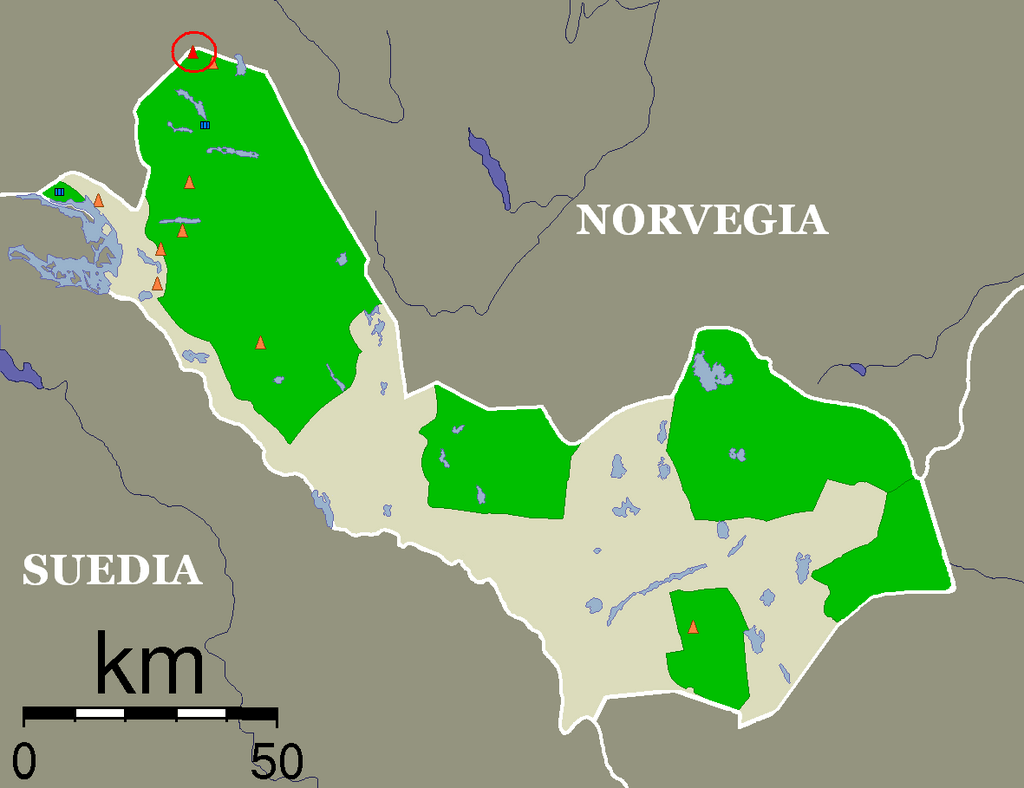
noch eine Orientierungskarte, Created by BishkekRocks, translated in Basque and modified by kanuto90, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5059011

In Wirklichkeit liegen die Massive Háldi & Co glücklicherweise in der Wildnis. Und Háldi als Waldfrau kann auf dem baumlosen Fjell auch nicht helfen, Kiedditsohkka Ritnitsohkkan alarinteeltä kuvattuna, Halti kohoaa kuvan oikean reunassa.Von Ari Mure – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23209413
Háldi und andere Geistwesen würden uns quasi unseren Platz im Universum zuweisen, uns mit der Erde verbinden und daran erinnern, dass wir nicht allein hier sind. Und schon gar nicht alleine „regieren“ können. Sie weist mich noch schnell auf andere einflussreiche Sámi-Frauen wie Anne Laila Utsi, die Direktorin des ISFI, des Internationalen Samischen Filminstitutes, hin, übersetzt mir noch kurz, dass árran eine Feuerstelle ist, ruft: „keep the fire going!“ und verabschiedet sich zum Flughafen. Giitu Asta!!

Anne Laila Utsi, Direktorin des ISFI, des Internationalen Samischen Filminstitutes
Bei der Presseparty in der Ølhallen, dem ältesten Pub der Stadt, betrieben von der nördlichsten Brauerei der Welt, begrüßt uns ein Mitglied der Familie Mack, in deren Händen sie seit 1877 sprudelt, dessen Ururgroßvater dieses Gebäude 1928 gleich nach Ende der Prohibition errichtet hat. Zunächst tranken im Erdgeschoss von Brauerei Macks nur Männer, überwiegend Fischer und Jäger.


Copyright für die historischen Fotos: Ølhallen
Als dann 1972 die Universität eröffnete – nämlich UiT Norges arktiske universitet, an der ich so gerne studiert hätte – stießen Student*innen und Dozent*innen zu ihnen. Und ich gerate dort 50 Jahre später unter die finnischen Filmemacher*innen und spreche mit Saara Saarela über ihren Film Memory of Water (Der Geschmack von Wasser), während wir Crab-Rolls futtern. Die kommen von Stella Polaris. Saarela berichtet vom bedrohlichen Rechtsruck in Finnland, die zweitgrößte Partei, genannt die wahren Finnen, seinen wahre Populisten. Und sie erzählt vom Shooting in NRW. Ich sehe hinterher nach bei der Film und Medien Stiftung NRW (filmstiftung.de), die diesen Film gefördert hat. Die finnische Regisseurin und Cutterin hat im Sauerland gedreht, in einem historischen Schieferbergwerk. Ihr Science-Fiction-Film spielt in einer Zukunft ohne Trinkwasser.

Saara Saarela, Regisseurin von Memory of Water, ls24.fi
Wir trinken Øl (Bier) und sprechen über PFAS, ewige Gifte. Sie erzählt, dass auf Grund industrieller Verunreinigungen der Regen in Schweden und in der Schweiz nicht mehr trinkbar sei, und empfiehlt mir Recherche, auch wenn uns noch so schlecht wird von diesen industriellen Machenschaften auf Kosten aller künftigen Generationen. Fange von hinten an und verwende meinen neuen, persönlichen Nachhaltigkeits-Slogan: DAS KANN WEG! Nämlich mit per- and polyfluoroalkyl substances, gegenüber chemischem, physikalischem und biologischem Abbau beständigen Ewigkeitschemikalien getränktes Outdoor-Outfit (igitt!). Die Textilindustrie verwendet – Konsum, Kommerz, Komfort … – solche fluorhaltigen, nahezu nicht abbaubaren organischen Verbindungen zur Herstellung wasserabweisender, atmungsaktiver Kleidung. Lasst sie hängen, unsere Eltern und Großeltern etc. haben auch ohne solches Zeug im Regen gestanden, geht doch. Und wenn ihr unbedingt schmutz-, fett- und wasserabweisendes Papier braucht, dann versucht es doch mal mit Wachs. Wir sind doch nicht die ersten Menschen, und wollen auch nicht unbedingt die letzten sein.

Memory of Water von Saara Saarela
Darin sind Saara und ich uns einig, und geben die Hoffnung nicht auf. Hinterher nahgelesen habe ich auch über Emmi Häranta, deren Roman Saarelas dystopische Diktatur-Story beruht. Die finnische Autorin wurde 1976 geboren und arbeitet als Kolumnistin, Theaterkritikerin und Drehbuchautorin. Ihr Debütroman „Der Geschmack von Wasser“ wurde internationaler Bestseller. 2022 hat sie „The Moonday Letters“ herausgebracht, „a thing entirely its own, full of melancholy, a sense of wonder and hope. It takes you on a shamanistic journey to a living and breathing future, carried by a mystery that slowly unravels“, der neue Roman sei eine ganz eigene Sache, schreibt der finnische Science Fiction und Fantasy Autor Hannu Rajaniemi, sehr melancholisch, mit Sinn für Wunder und Hoffnung. Er nehme uns auf eine schamanische Reise mit in eine lebende und atmende Zukunft, getragen von einem Mysterium, das sich langsam enthüllt. Das brauchen wir ganz dringend!

Der Eisbär in der Ølhallen 是特罗姆瑟最古老的酒吧,过去曾是渔民、农民还有市民们欢聚的场所,今天,它是特罗姆瑟的地标之一,供应 72 种挪威优质桶装啤酒,不浪费一点爱酒之人对啤酒的热情。macht international auf sich aufmerksam.

Eugenia ist auch melancholisch und hoffnungsvoll. Sie ist 2003 aus Российская Федерация, der Russischen Föderation, genauer aus dem 500 Kilometer entfernten Му́рманск (Murmansk) aus- und nach Romsa, genauer an Norwegens Arktische Universität (UiT) eingewandert, wo sie – wie ich sie erlebt habe und wie ihr linkedin-Profil mir im Nachhinein bestätigt, positiv denkend, ständig lernend und hart arbeitend (womit wir inclusive des Tanzens vier Leidenschaften teilen) – ihren Master in Tourismus-Marketing hingelegt hat und nun in staatlichem Auftrag dazu beiträgt, Norwegen als Reiseziel zu vermarkten (www.visitnorway.de) und seit 2011 jedes Jahr ehrenamtlich beim TIFF schuftet. Das sind aber nicht unsere Themen an diesem Abend. Wir werden blitzschnell privat. Wie auch immer ich darauf komme, ihr zu erzählen, dass mein Vater für die SS gemordet hat, für sie öffnet es eine völkerverständigende Verbindung und den Raum für geteilte Traurigkeit. Mitten im Kneipengedrängel vorm ausgestopften Eisbären stehen zwei scheinbare Feindinnen zusammen und weinen. Eugenias Ex-Heimat, den größten Staat der Welt, dessen Regierung offiziell vom Volke ausgeht (Republik), wo aber ähnlich wie in vielen anderen Staaten einst und jetzt, Gewalt- und Selbstherrschaft (Autokratie und Despotie) regieren, haben Millionen Menschen in den vergangenen Jahren verlassen.

Arctic Pride Parade 2022
Eugenia war nicht auf der Flucht – sie wollte nicht von etwas weg, eher auf etwas los, „going toward something“ – aber leidet jetzt wie viele Russ*innen unter Anfeindungen, erzählt, dass manche es nicht mehr wagen, Russisch zu sprechen, und betont, sie lasse sich ihre Muttersprache nicht nehmen. Ich erzähle etwas radebrechend auf frisch gelerntem Russisch von meiner Großmutter, die viele Jahre in Sibirien gelebt und mir als ausgesprochene Anhängerin der deutsch-russischen Freundschaft auf den Weg gegeben hat, dass wir uns unter keinen Umständen gegeneinander aufhetzen lassen dürfen. Миру Мир! Frieden der Welt! большо́й спасибо, дорога́я Евгения!!
Weit nach Mitternacht werde ich ein paar Häuser weiter im Driv café, die Gaststätte von Norges arktiske studentsamskipnad ist jetzt Disko, bei der Arctic Pride´s Queer Night so heftig wie herzlich in die Community gezerrt: „Du må danse!“ Ich tanze. Bis in die Morgenstunden. Und klettere dann mit Laurens und seiner italienischen Kollegin Margareta, die auch in der WG Unterschlupf gefunden hat, über die Insel, unter sehr sternklarem und diesmal Nordlicht-freiem Himmel.
debattiere Freitag, den 20. – 15:30 – Tromsø bibliotek –
vorher gucke ich nach dem Ausschlafen im stillen WG-Haus am Grønlandsvegen – das Einzige, was ab und zu zu hören ist, sind die Flugzeuge – aus dem Fenster gucke, schneit es in dicken Flocken. Die Weihnachtsbeleuchtung ist allenthalben angeschaltet, dehnt das X-mas-feeling aus und erhellt punktuell die wochenlange Polarnacht.

Blick von der Insel herunter über den Sund zum Festland, 20. Januar 2023, 14:01
Steige spontan – wozu reist eine, wenn alles nach Plan geht? Bin ja wie jahrzehntelang erprobt, insgesamt ins Blaue gefahren, ins Blaue dieser Insel, von dem ich nichts wusste – am Roald-Amundsen-Plats aus, vorm Prostneset terminal. Dort legen die hurtigbåter und die busser ab. Bahn gibt es nicht, gab es nie. In diesem schicken Terminal für Überlandbusse und Passagierschiffe steige ich „aus Versehen“ schon mal in den Fahrstuhl zum Kai, zur Abfertigung der Hurtigruten. Übersetzt heißt sie „schnelle Route“, die norwegische Postschifflinie, die seit Ende des 19. Jahrhunderts die zuvor weitgehend voneinander isolierten Bewohner*innen der 2700 Kilometer langen Küste verbindet. An diesem frühen und dunklen Nachmittag fotografiere ich die NORDLYS, das Hurtigrutenschiff namens Nordlicht, das lockt am Kai in Tromsøs Zentrum. Kreuzfahrten sind mir aus diversen Gründen ein Gräuel, aber nun habe ich ja diese Einladung auf die Lofoten (siehe unten) und könnte dorthin von Bodø oder Tromsø die hurtige Schiffsroute wählen, quasi als öffentliches Verkehrsmittel.

NORDLYS, ein Hurtigrutenschiff namens Nordlicht, 20. Januar 2023, 14:53
Dramatische Dorschfixierung oder Breitmäuliger Breiflabb
Mit arktischen Träumereien aufgeladen erreiche ich die älteste Kulturinstitution der Stadt, die Tromsø bibliotek. 2005 ist sie unters ausladende und selbsttragende ehemalige Dach des Fokus Kinos gezogen. Unter sein ehemaliges Dach ist 2005 die Stadtbibliothek gezogen, da hatte sie schon spannende Geschichten hinter sich. Im Jahr 1863 saß und las in einem Holzhaus in der Meer-/Seegasse (Sjøgata) die Tromsø Læseselskab, eine „Lese-Gesellschaft“, vier Jahre später übernahm die städtische Bibliothek Literatur und Räume, weitere sieben Jahre später wurden die Bücher in die 2. Etage des Grand Hotels getragen, es folgten Fortsetzungen und Umzüge.

1863 zog die „Tromsø Læseselskab“ in die Sjøgata 16, Foto: Einar Dahl (2018), lokalhistoriewiki.no

1878 befand sich die Bibliothek im Grand hotell, Foto: Jørgen Wickstrøm, lokalhistoriewiki.no

1894 zog Tromsø bibliotek in die Kirche, lokalhistoriewiki.no
Und eineinhalb Jahrhunderte nach der Gründung der Tromsø bibliotek findet in deren aus- und einladender Literatur-Kathedrale etwas statt, von dem Astrid Aure, Kuratorin des TIFF-Programmes über und für den Norden inclusive dieser Veranstaltung, sagt: „Det kanskje bli en debat, men det er en samtale“. Es könne eine Debatte werden, aber geplant sei ein Gespräch.

Dieses tolle Foto oben von der Tromsø bibliotek zu Zeiten des TIFF stammt nicht von mir! Es ist von Brian Aslak. Von mir ist die Innenansicht:
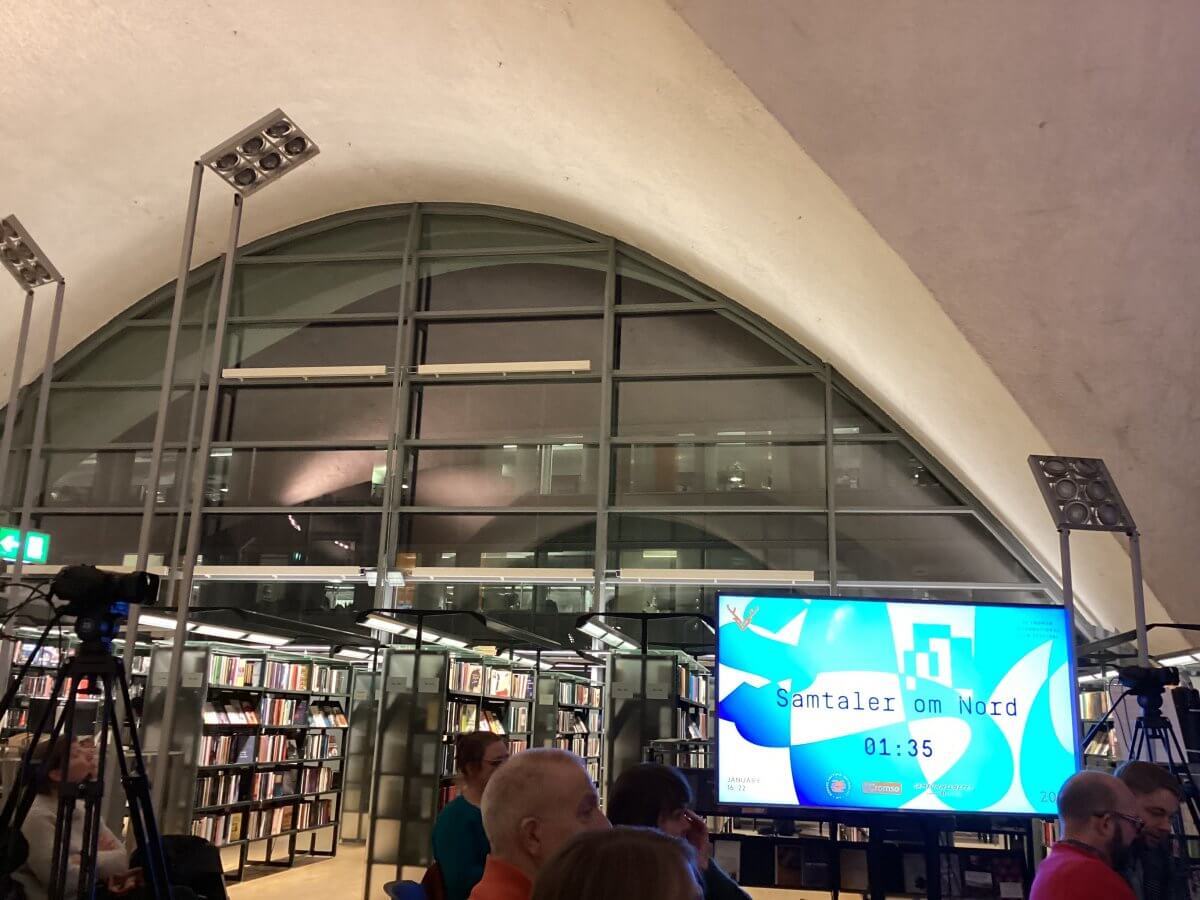
Zu diesen samtaler om fiskeri gehören zwei Filmausschnitte: Ottar Brox – Kampen for Kysten und Havfrue (eine Doku über die Zeit, als Sisilie das Fischerboot von ihrem Vater übernommen hat). Zur Debatte steht heute so einiges: der „kampen for kysten“, den beispielsweise der heute 90-jährige norwegische Sozialwissenschaftler Ottar Brox, von Hans Eirik Voktor im gleichnamigen Film porträtiert, seit 1966 führt, den Kampf der nordnorwegischen Küstengemeinden um die Kontrolle über ihre Lebensgrundlage, das Meer; auch das Ringen ums Recht auf dieses Gemeingut zwischen regionalen Fischer*innen und großen Konzernen wie Aker Seafoods, die auch auf dem Podium vertreten sind. Dieser norwegische Konzern nennt sich seit einigen Jahren Havfisk, übersetzt See- bzw. Meerfisch, macht an 200 Millionen $ Umsatz; beliefert unter anderem Nestlé, Unilever und Findus; ist in die Kabeljau-Mast eingestiegen, die Fische werden in marinen Farmen aufgepäppelt; wurde 2010 von der Küstenwache beim illegalen „Dorsch-Dumping“ erwischt (wobei ich nicht herausfinden konnte, ob sie damit über die Fangquote hinaus gefangenen Meeresfisch versenken wollten, aber das ebenfalls aufgedeckte Fälschen von Logbüchern deutet darauf hin) und betreibt 15 Trawler nördlich des 62. Breitengrades, der etwa das südliche Ende von Sápmi markiert, ungefähr mittig zwischen Bergen und Trondheim, wo der Kopf des Landkarten-Tigers in seinen ungekämmten langen Rücken übergeht, die ausgefranste, zottelige Küste. Sie erstreckt sich bis zum Nordkap – ein scheinbar unendlicher Fischgrund. Wäre er unendlich, gebe es keine Fangquoten und keine Kabeljau-Mast. Da sind wir also wieder beim Dorsch, beim atlantischen. Durch vorwiegend kapitalistische Fischereipolitik sind die ehemals gigantischen Bestände dieses havfisk zwischen Westgrönland und der kanadischen Provinz Neufundland nicht mehr – für Menschen – nutzbar.

Die Menschen auf dem Podium werden skandinavisch mit Vornamen angesprochen. Ganz links sitzt Sven und spricht für die Fiskeriforvaltning, die staatliche Fischerei-Verwaltung; neben ihm sitzt Fischerin Sisilie; neben ihr Hans, Regisseur des norwegischen Films The Coastal Warrior, der Dokumentation über Ottar Brox; rechts neben ihm Kristina, sie vertritt die Industrie.
Wikipedia entnehme ich im Frühjahr 2023 Folgendes: „Kanada hatte vor 1992 trotz entsprechender Warnungen der Wissenschaft die Bestände nicht geschützt, so dass diese kollabierten. Seit 1992 gilt ein Fangverbot, wodurch 40.000 Arbeitsplätze in Neufundland verloren gingen. Die EU hatte 2006 vor Westgrönland die Bestände nicht für ein weiteres Jahr geschützt, um diesen das Ablaichen zu ermöglichen. Das hatte ähnliche Folgen wie die falsche Fischereipolitik in Kanada und war auch der Hauptgrund, warum Island nicht der EU beitreten wollte.“ Das ist alles durch und durch anthropozentrisch, das anthroprozentrische Weltbild (hier als Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert) ist echt antik, stellt den Menschen in den Mittelpunkt und betrachtet alle weiteren Wesen quasi als Lieferanten und Dienstleister. Es ist so überholt, dass es inzwischen sogar manchen auffällt, die sich chronisch für den Mittelpunkt der Welten halten. Wir stellen jetzt mal Gadus morhua in den Mittelpunkt. Als mittelmäßig fleißige ehemalige Studentin der Fischereiwissenschaft – in Hamburg, an der Pallmaille, mit Elbblick – muss ih ab und zu im „Muus-Dahlström“ nachschlagen, die Autoren dieses Meeresfische-Bestimmungsbuches sind Dänen, der Titel der dänischen Originalausgabe lautete „Havfisk og Fiskeri i Nordvesteuropa“, die BLV Verlagsgesellschaft hat es 1978 deutschen Student*innen in den Schoß gelegt, meine 4. Auflage war mit mir unter anderem auf Fischereiforschungsfahrt auf der Nordsee. Da ging es aber nicht um den Kabeljau.
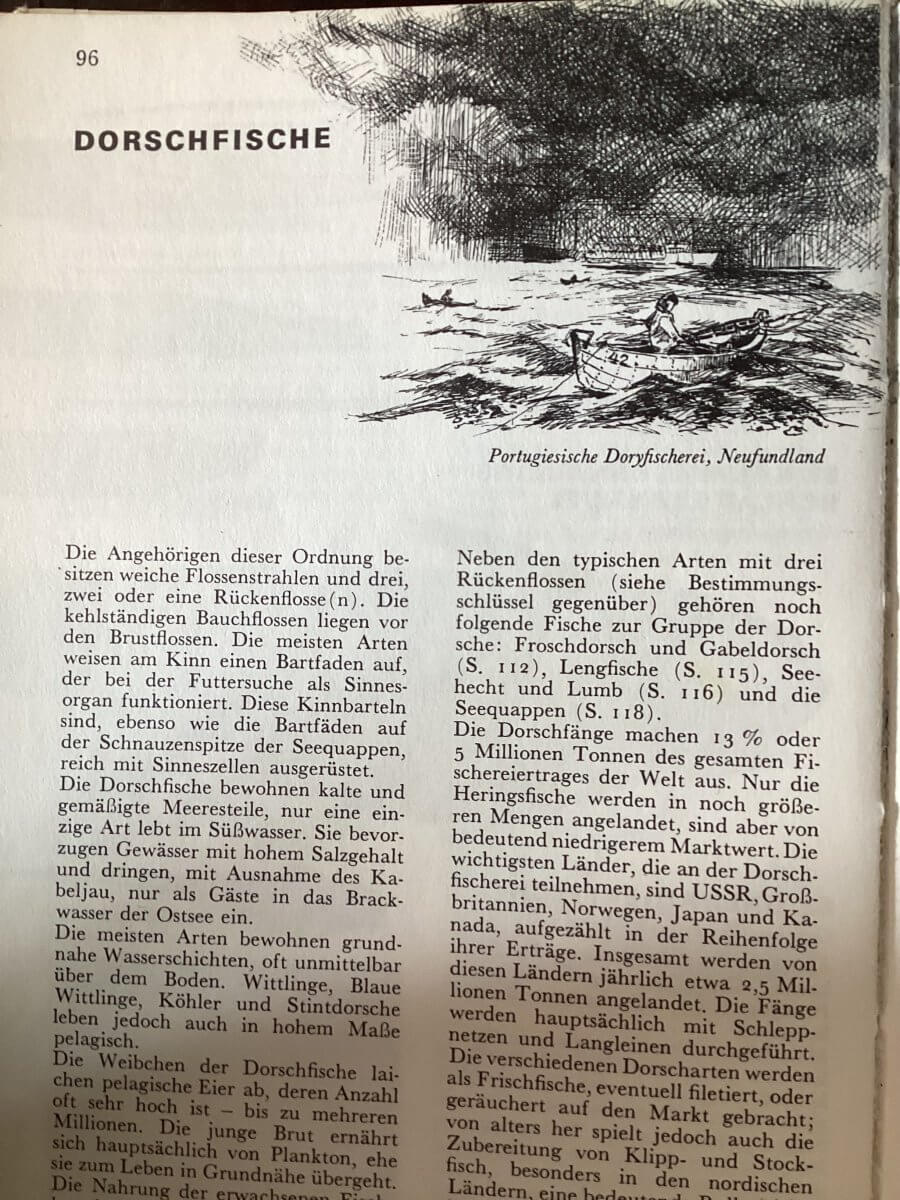
Mein BLV Bestimmungsbuch leitet das Kapitel Dorschfische mit einer Abbildung von portugiesischer Doryfischerei vor Neufundland ein. Das Dory ist ein kleines, ruder- oder segelbares, flachbordiges, plattbodiges Fischereiboot und die Portugiesen fischten sich mit Langleinen von ihren Dories aus seit 1500 bis Anfang der 1970er-Jahre über den Unterwasserplateaus der Neufundlandbank, in einem für seinen hohen Seegang bekannten Gebiet, den Rohstoff für ihren Bacalhau. Da sind wir doch schon wieder bei den Menschen, obwohl: die Doryfischerei hat den Kabeljau = Dorsch bestimmt nicht an den Rand der Ausrottung gebracht. Wir mussten lernen, dass Dorschfische ihre kehlständigen Bauchflossen vor den Brustflossen tragen und am Kinn einen Bartfaden, der bei der Futtersuche als Sinnesorgan funktioniert. Und das Exemplare von mehr als einem Meter Länge und mehr als zehn Kilo Gewicht in isländischen gefangen werden: in isländischen Gewässern und bei den Lofoten.
Dann kann das Gespräch über den Norden und seine Fische ja beginnen. Wir sind geistig vor Ort. samtale om nord muss pünktlich um 15:30 Uhr – mittlerweile ist es bis auf die Weihnachtsbeleuchtung finster in Tromsø – starten, denn es wird als Life stream übertragen. Die Menschen auf dem Podium werden skandinavisch mit Vornamen angesprochen. Sven sitzt ganz links und spricht für die Fiskeriforvaltning, die staatliche Verwaltung, spricht über eine weitestgehend dezentralisierte Struktur an der Küste, erwähnt, dass sich nun die Diskussion über kleinere Fahrzeuge wieder erhebt. Kristina, rechts auf dem Podium, vertritt die Industrie und deren Vorstellungen darüber, wie das Leben an der Küste und die Arbeitsplätze dort zu sichern seien. Bezüglich der Arbeitsplätze höre ich heraus, dass ihr Konzern Havfisk/Aker Seafoods in der Fischverarbeitung nicht unbedingt die Menschen vor Ort beschäftigt, sondern viele Arbeitsmigrant*innen, aber mein Norwegisch reicht für solche Finessen nicht aus.
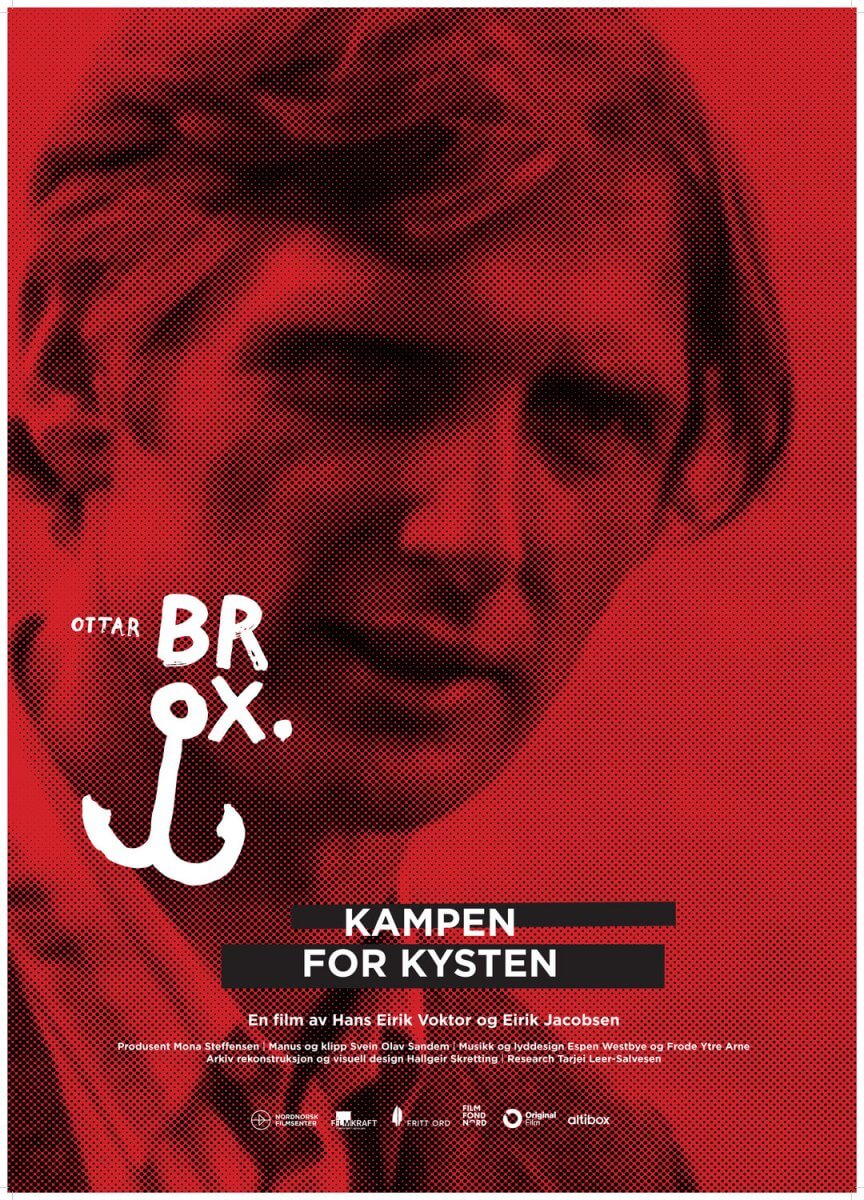
Hans Eirik Voktor, Regisseur des norwegischen Films The Coastal Warrior, der Dokumentation von Ottar Brox´lebenslangen Kampf für die Küste und ihre Bewohner*innen, kritisiert die norwegische Flottenpolitik, meint das Überhandnehmen von Trawlern wie denen von Havfisk/Aker Seafoods. Sisilie fischt von einem kleinen Boot aus. Regisseur Eilif Bremer Landsend und der Kameramann Tor Edvin Eliassen, der seine analogen Gerätschaften gerade mal so auf ihren Kutter kriegte, haben eine hinreißende Dokumentation über die Übergabe der Fischerei vom Vater auf die Tochter, nämlich Sisilie, gedreht und die junge Fischerin streitet nun auf dem Podium für die nächste Generation. Sie hat drei Kinder und fühlt täglich die Abhängigkeit ihres Gewerbes mitsamt seiner innewohnenden Tradition und Kultur von einer „guten Politik“, beklagt, dass sie ihren Fang aus verschiedensten Gründen nicht in den Laden bekommt. Voktor wirft ein, dass die Küstengewässer ja im Grunde „almeningen“ seien, Gemeingut, Allmende. Aber seit 1990 wäre dieses in einem neoliberalen System zu „kapitalistischen Marktpreisen“ verschleudert worden. Das Kapital sei aber kein/e gute/r Steuerfrau/-mann („kapitalen er ikke god om at styrer“).

In Havfrue porträtieren Regisseur Eilif Bremer Landsend und Kameramann Tor Edvin Eliassen die Fischerin Sisilie Skagen aus Stamsund, einem Hafen mit Skipiste auf Vestvågøya/Lofoten
Sisilie wird deutlicher: Die norwegische Fischereipolitik setze mehr und mehr auf die Trawler-Flotten. „Wir können zu Hause nicht mehr fischen“ – Erläuterung: weil die Konzerne die Küstengewässer leeren – und sie könne nicht mit ihrem Kutter auf Weltreise gehen.
Voktor wirft ein, die einzige Perspektive sei bærekraft, Nachhaltigkeit. Die genaue Übersetzung bedeutet Tragkraft. Ganz einfach und ganz schwer: Wieviel und welche Fischerei erträgt das Meer? Mehr Ertrag geht nicht. Sisilie erläutert das so: wir wollen alle noch lange vom Meer leben, wir können (und wollen?) nicht alle auf Trawlern arbeiten. Voktor ergänzt, dass die Fischerei mit den kleinen Kuttern wie dem von Sisilie alle Vorteile in Sachen Tragfähigkeit (bærekraft) auf ihrer Seite habe. Sie liefere die beste Qualität, verbrauche den wenigsten Treibstoff pro Kilogramm Fang und würde quasi als „ekstrabonus“ auch die Meeresvegetation und Bodenfauna nicht ruinieren. Sisilie legt noch einen Happen drauf und berichtet, dass sie ja nicht nur Skrei fische. Skrei wird in Norwegen der geschlechtsreife arktische Kabeljau genannt. Was Sisilie sonst noch fischt, kriege ich hinterher beim Interview erst heraus, jetzt lenkt Kristine ein und wirft das Ruder ein wenig herum. Auch die Industrie sei mittlerweile nicht mehr so „Dorsch-fixiert“.
Nun bekomme ich die wunderbare Chance, mich über nicht fixierte Fischerei schlau zu machen, bei einer Expertin, bei Sisilie Skagen aus Stamsund. Dieser Hafen mit Skipiste liegt auf Vestvågøya. Das maritime Klima verschafft dieser Lofoten-Insel milde Winter und Sonnenbademöglichkeit am Sandstrand zu Füßen des nicht ganz Tausenders Himmeltindan. Traditionell lebten die Insulaner*innen von der Produktion von Stockfisch, Lebertran und Guano, hauptsächlich aber vom Fischfang. Skagens Arbeitsplatz sind die Wasser von Verdens vakreste øyrike, des weltweit hübschesten Inselreiches, wie es die stolze Norwegerin Kristin Folsland Olsen in ihrem „Turguide“ nennt, den ich mir am Vormittag in der Touristen-Info geholt habe, der fröhliche Fitte in Paddelbooten, mit Kletterhelmen, in Bikinis, mit Angelruten, auf Mountainbikes, auf Snowboards, mit Fallschirmen und in abgedrehten Yogahaltungen auf Berggipfeln zeigt.

Steilküste bei Stamsund, www.fotocommunity.de
Sisilie wird zu solcherlei Outdoor-Aktivitäten nicht kommen, ist aber am liebsten draußen. Und beklagt die immer mehr werdende Papierarbeit. Die neuen Fischereiregelungen verlangen eine sehr ausführliche Dokumentation, die sie, die sich Angestellte nicht leisten kann, samt und sonders eigenhändig erledigen muss. Wenn sie nicht auf die Schuppe genau digitalisiert, wo sie was und wieviel davon gefangen und wohin sie es gebracht hat, lauert Strafe. Nun kommen wir zum Fisch, zuerst zum Skrei. Da habe es gerade eine Kampagne in der BRD gegeben, erzählt mir die Fischerin. Und ich erinnere mich an einen Besuch im Fischgeschäft, bei dem der Händler die enormen Vorzüge dieser Ware pries. Die Deutsche See GmbH schwärmt ebenfalls von Omega-3-Fettsäuren, feinstem Aroma, Vitaminen, Proteinen. Ihr Werbewort S…d kommt mir nicht über die Tastatur, statt der Fischfutterin taucht die Biologin in mir auf und will es genau wissen. Skride heißt schreiten, und auch wenn der geschlechtsreife arktische Kabeljau (Gadus morhua), auch Winterkabeljau genannt, aus den eiskalten Wassern um Spitzbergen nicht zu Fuß zur Fortpflanzung schreitet, hat er seinen norwegischen Namen vielleicht von diesem Verb, immerhin legt er bis zu 1000 Kilometer zurück zu seinen Laichgründen bei den Lofoten. Skrei, nicht „Skrai“, sondern „Skräi“ gesprochen, heißt aber auch Schwarm, weiter möchte ich die Linguistik nicht treiben. Seit Generationen feiern die Menschen an Nordnorwegens Küsten im Winter die Ankunft der Langstreckenschwimmer, die dieser „sportlichen“ Leistung ein besonders festes und fettarmes Fleisch verdanken. Und Sisilie und ihre Kolleg*innen werfen Leinen und Netze aus.

Skrei, lifeinnorway.ne
Zu anderen Zeiten fängt sie, wie sie mir ins Buch schreibt „sei, hyse, breiflabb, blåkveite“. Sei hatten wir schon, siehe Donnerstag, den 19. …. Subsistenzkrimi oder Wrtschaftslachstum etc., es ist der Köhler (Pollachius virens). „Die höchsten Erträge kommen im Sommer aus den Finnmarken (Erläuterung: damit werden die ehemaligen Siedlungsgebiete der Sámi in Nordnorwegen gemeint sein, Finnmark bedeutet auf Deutsch Feld der Samen) im Winter aus den Gewässern um die Lofoten-Inseln, wo die Köhler auf ihren Laichwanderungen gefangen werden“, so steht es in meinem „Muus/Dahlström“ aus den 1970ern. Also fängt Sisilie den Sei ebenfalls im Winter.
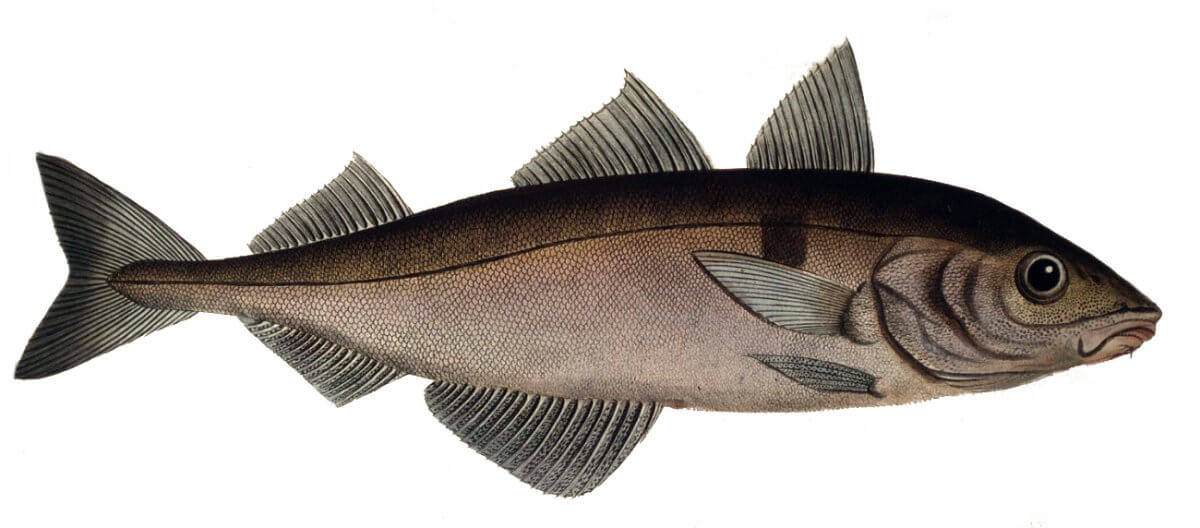
hyse alias Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus)
Hyse ist Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) und gehört auch zu den Dorschfischen. Wir lernten damals, er sei leicht erkenntlich am großen schwarzen Fleck über der Brustflosse. Und kriegten als Student*innen vor mindestens 45 Jahren zu lesen und hören, dass die Schellfisch-Bestände in der Nordsee alle Zeichen der Überfischung aufweisen. Daher hier nochmal das kleine Einmaleins für Fischfans, Umweltaktivist*innen und ökologisch Interessierte: Zum Beispiel der Schellfisch in der Nordsee wird im 3. – 4. Lebensjahr mit einer Länge von 30 – 40 Zentimetern geschlechtsreif. Die damalige Konvention für die Nordsee sah ein Mindestmaß von 27 Zentimetern vor. Es ist ganz einfach: keine Eier, keine Fische. Die Internationale Nordseeschutzkonferenz wurde erst nach vielen Kämpfen in den 1980ern ins Leben gerufen. Vor Nordnorwegen werden hyse von Mai bis November gefangen. Breiflabb ist der Seeteufel (Lophius piscatorius). Auf so einen seiner Umgebung sehr gut optisch angepassten Grundfisch bin ich bei einem biologischen Barfuß-Praktikum im Helgoländer Felswatt mal getreten. Sowas prägt sich ein, auch in die Fussohle. Wir haben beide überlebt. Lophius piscatorius hat armähnliche gestielte Brustflossen und ist auch sonst gut ausgestattet: ein Strahl (eine „Gräte“) seiner vorderen Rückenflosse ist beweglich und trägt an der Spitze einen fleischigen Hautlappen als Köder. Ist das so angelockte Opfer nahe genug, schnappt das riesige Maul zu, die spitzen Fangzähne biegen sich nach innen um und erleichtern das Verschlingen der Beute. Daher der Zweitname Anglerfisch. In den Handel kommen meist nur Seeteufelschwanz und -bäckchen, Sisilies Kund*innen werden wahrscheinlich das gute Fleisch des ganzen breiflabb genießen, das auch nach der Zubereitung hell und fest bleibt.
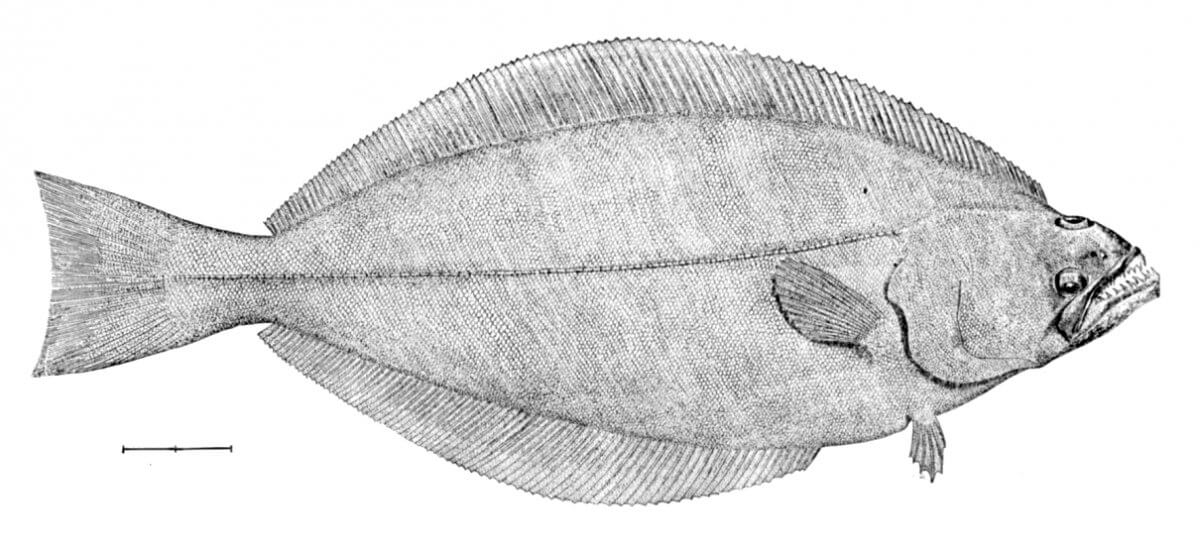
blåkveite alias Schwarzer Heilbutt, Reinhardtius hippoglossoides
Über blåkveite schweigt sich GYLDENDALS Handwörterbuch Norwegisch aus, da brauche ich no.wikipedia und erfahre, dass es sich hier um Reinhardtius hippoglossoides handelt, den Schwarzen Heilbutt. Das ist ein rechtsseitiger Plattfisch, seine Larven sehen aus wie üblich, im Laufe ihrer Entwicklung wandert das linke Auge etwas auf die rechte Körperseite. Da guckst du:) Der Schwarze Heilbutt gilt als weniger asymetrisch als andere Plattfische wie Scholle und Flunder und schwimmt im Gegensatz zu ihnen aufrecht. Mein altes Bestimmungsbuch schreibt, Wachstumsverlauf, Laichplätze und Wanderungen dieses arktischen Fisches seien nur wenig erforscht. Ich forsche nicht weiter. Sisile hat mir noch erklärt, sie arbeite jeden Tag, fische und liefere das ganze Jahr, und da sie mit ihrem Kutter eher küstennah unterwegs sei, sei ihre Ware wirklich fangfrisch und sie verbrauche weit weniger Energie als die weit reisenden Trawler. Auch aus ökologischer Sicht sind ihre Fangmethoden zukunftsweisend. Sie verwendet verschiedene Netze für verschiedene Fischarten und verzichtet auf das Ausräumen des Meeresgrundes mit Schleppnetzen. Es sei heutzutage sehr teuer, Fischer*in zu sein. Aber, wenn ich zwischen ihren Worten richtig gelauscht habe, ist es auch mit Geld nicht zu bezahlen. mange takk, Sisilie!
Kommunaler Kinematograf oder Monolinguale Einfachheit
Dekolonialisierung, Vitalisierung, Erwärmung, Überfischung, nicht zu fassen, was an so einem TIFF-Tag alles ertönt und aufblitzt, sortiere im Foyer des Fokus erstmal die verhedderten Filmstreifen in meinem Kopf. Von solchen 35-mm-Spulen in opulenten Blechdosen habe ich originalgetreue Vorstellungen, weil wir damals unserer WG-Mitbewohnerin über die Schulter gucken durften, sie war Filmvorführerin in unserem Cineastinnen-Heiligtum, dem Abaton. Das griechische Wort ἄβατον bedeutet heiliger Ort und dieses seit 1970 in Hamburgs damals heftig bewegten Stundentenviertel bestehende Lichtspielhaus war eines der ersten Programmkinos in Deutschland und nur wenige Schritte von unserer ebenfalls sehr bewegten Frauen-WG entfernt.
Nach den interessanten Auseinandersetzungen über Fischerei in der Bibliothek habe ich eine Weile im Aurora Café gesessen und an meinem Blog geschrieben. Schreibe darüber am nächsten TIFF-Tag: „Schreibe mich frei, auch wenn´s manchmal hakt bei all dem Input. Erinnere gerade das Zitat von Cora Sandel, darüber, dass sie mal eine Sprache hatte, scharf wie ein Messer. Sprache schärfen.“
Über meinem Nachdenken und Nachforschen inmitten von anwachsenden TIFF-Besucher*innenströmen versäume ich es doch glatt, meine nächste Spielstätte zu lokalisieren – und das, wo ich doch in diesem Fall noch nicht mal ein elektronisches Billet habe und mich für ein Rush-Ticket anstellen muss! Recht spät habe ich realisiert, dass der Film über Ottar Brox, den Sozialwissenschaftler, der mich total an Ivar Lasse Larsen As erinnert, einen meiner beiden fabulösen Norwegischlehrer, der (Brox) jahrzehntelang dafür gekämpft hat und das noch mit 90 tut, dass die nordnorwegischen Küsten-Communities die Kontrolle über die Ressource Ozean (ocean commons) wiedererlangen; nicht im AURORA läuft.

Verdensteatret heißt Theater der Welt. Dieser Name reflektierte damals nach Angaben des Arkitekturguide for Nord-Norge, dass der 1915/16 errichtete städtische Kinematograf die Bewohner*innen Tromsøs dem Rest der Welt aussetzen solle.
„Verdensteatret!“ ruft mir eine ebenfalls Eilige zu – sie will auch zu „Ottar Brox “ – und zeigt mir den Weg zur Storgata 93 b. Ich also quer über den Stortorget, schräg an diesem schönen Kiosk vorbei, drängle mich durch die Eingangshalle, dieses zauberhaften Altbaus, wo fürs TIFF-Wochenende in den Norden geflogene Norweger trinken, essen und über Filme sprechen, ins quer verlaufende schmale Foyer, erhalten im Originalzustand von 1916, wo ein Filmprojektor aus jenen Anfangszeiten ausgestellt ist, den ich erstmal keines Blickes würdige; wo es eine Unisex-Toilette gibt, was insofern bedeutsam ist, als ich dort einen wiedertraf, mit dem ich bei der opening reception im Halogaland TeaterCafé über die unterschiedlichen Abläufe auf Damen- und Herren-Toiletten sprach, und der nun als Tontechniker unter den gammeldags-Wandgemälden mit alten Versen die Anlagen fürs abendliche Stummfilm-Konzert aufbaute, und es mir ans Herz legte.

Das quer zum Eingang verlaufende Foyer des Verdensteatret hat bis auf die geschlechtsneutralen Toiletten seine Originalausstattung behalten. Hier steht ein alter Filmprojektor, Jan Martin Berg, arkitekturguide.uit.no
Mein Ziel war die Rush-Schlange. In der stellte ich mich ziemlich weit hinten an. So zog ich die Nr 12 und reihte mich auf einer Bank in das ein, was ein älterer Staff-Mitarbeiter als „nice ladies“ bezeichnete. Die saßen auf Stühlen an der Wand des Querfoyers. Und dann flog mir ein ausgedrucktes Ticket zu, wirklich! Wurde mir glatt in den Schoß geworfen. Womit ich das verdient habe, ignoriere ich ebenso wie die spektakulären Wandmalereien im Saal, dessen Bühne stark an ein Theater erinnert. Für die Märchen- und Volksliederszenen, die riesigen, die der Tromsøer Sverre Mack 1921 an die Seitenwände gemalt hat, habe ich kein Auge.

Die 1921 von Sverre Mack geschaffenen Wandgemälde des Verdensteatret sind von norwegischen Märchen und Volksliedern inspiriert. Der versteckte Orchestergraben dieses Welttheaters stammt noch aus der Stummfilmzeit, Jan Martin Berg, arkitekturguide.uit.no
Bin erstmal ganz Ohr für meinen Sitznachbarn. Warum ich eigentlich Norwegisch verstehe? Das fragt er, weil es Kampen for Kysten, die Dokumentation über den unermüdlichen Kampf von Ottar Brox, bisher nur im norwegischen Original gibt, ohne Untertitel. Erzähle ihm die Geschichte meiner Bewerbung an der damals gerade gegründeten Uni in Tromsø. Was ich nicht erzähle, steht bei Áilo alias Valkeapää: „Eine neue Sprache zu lernen kann so sein, wie zu lernen, etwas aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. … kann aber auch das Lernen einer neuen Denkweise beinhalten.“ Es erlöse uns von „monolingualer Einfachheit“. Meine Norwegisch-Kenntnisse haben mir zudem fast eine Atlantiküberquerung verschafft. Als ich in den 1970ern auf Madeira Biologie-Kommiliton*innen vom Forschungsschiff abholen wollte, war dieses noch nicht eingelaufen. So geriet ich an den zuständigen Agenten im Hafen von Funchal (das heißt übrigens „viel Fenchel“, weil die portugiesischen Eroberer bei der Entdeckung dieser Atlantikinsel westlich von Marokko auch Gemüse entdeckten), und der entführte mich der Einfachheit halber kurzerhand zu einem Abendessen mit norwegischen Seeleuten. Denen war der Schiffskoch verloren gegangen. So heißt der wichtigste Mensch an Bord aber nur auf Passagierschiffen, auf den anderen wird der Mensch in der Kombüse Smut, Schmutt, Schmuud oder Smutje genannt und muss nicht unbedingt eine einschlägige Ausbildung haben. Als die Norweger nach einigen Litern portugiesischen Weins erfuhren, dass ich sowohl über Groß- und Kleinküchenerfahrungen, als auch über Seetauglichkeit und weitgehende Resilienz gegen Seekrankheit verfüge, und auf Norwegisch betrunken über Fiskeboller (zu Deutsch circa Fischklöße) diskutieren kann, wollte der Kapitän mich als Smutje anheuern. Da in alten Zeiten Heuerverträge (Heuer ist der Lohn von Seefrauen/-männern) per Zuruf zwischen Kapitän und Angeheuerten geschlossen wurden, wurde der sonst ziemlich coole Agent neben mir unruhig. Er bemerkte, dass ich ziemlich abenteuerlustig war und ermahnte mich draußen vor der Kneipe sehr streng. Ich dürfe auf keinen Fall als einzige Frau mit einer kleinen Männercrew in See stechen. Fünfzig Jahre später verschaffen mir meine Norwegischkenntnisse den Genuss eines norwegischen Biopic ohne Untertitel. Det ga bra! Mange takk til Jostein Soland og Ivar Lasse Larsen As!
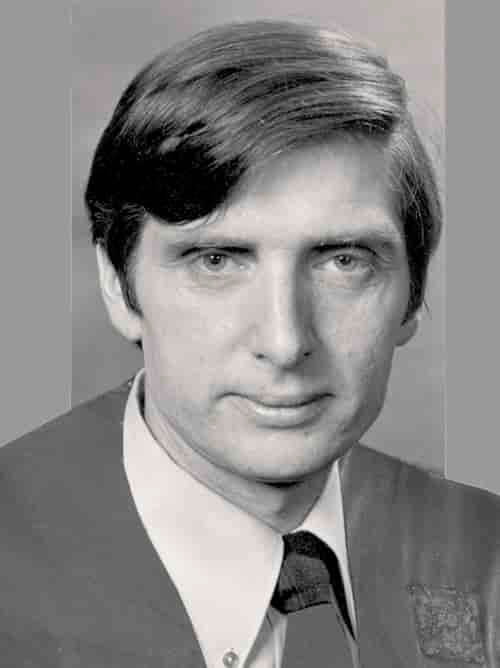
Dieses Bild von Ottar Brox stammt aus dem Archiv des Stortinget – wörtlich aus dem Norwegischen übersetzt großes Thing oder Großversammlung – dem norwegischen Parlament in Oslo, wo er von 1973 – 1977 für die Sosialistisk venstreparti (SV) saß
Ein paar gesprochene Schlagzeilen notiere ich im Dunklen in mein kleines Notizbuch: Fischfang und -verarbeitung in Nordnorwegen werden von wenigen „Playern“ kontrolliert – sie verkaufen den Fisch billig – in der Verarbeitung sind viele schlecht bezahlte osteuropäische Einwanderer tätig – Tiefkühlfisch liegt in großen Lagern – schon seit 1945 geht es für die Menschen an der nördlichen Küste stetig bergab – die nordnorwegische Region werde zunehmend ungastlich durch diese Bewirtschaftung – der Run auf Elektrizität und Aluminium ist in vollem Gange – der minimale Einsatz von Kapital und Energie – der Verkauf von Fischereirechten – die große Umverteilung ab 2007 (die Partei Høyre, Die Rechte, bekam bei den damaligen Kommunalwahlen fast 20 Prozent der Stimmen und wurde zur zweitstärksten). Zitiert wird ein norwegischer Wissenschaftler, der Anthropologie (die Wissenschaft vom Menschen) mit Wirtschaftswissenschaft verknüpfte und sich kritisch mit der Rolle des Unternehmertums bei den sozialen Veränderungen in Nordnorwegen auseinandersetzte, Thomas Fredrik Weybye Barth, geboren 1928.
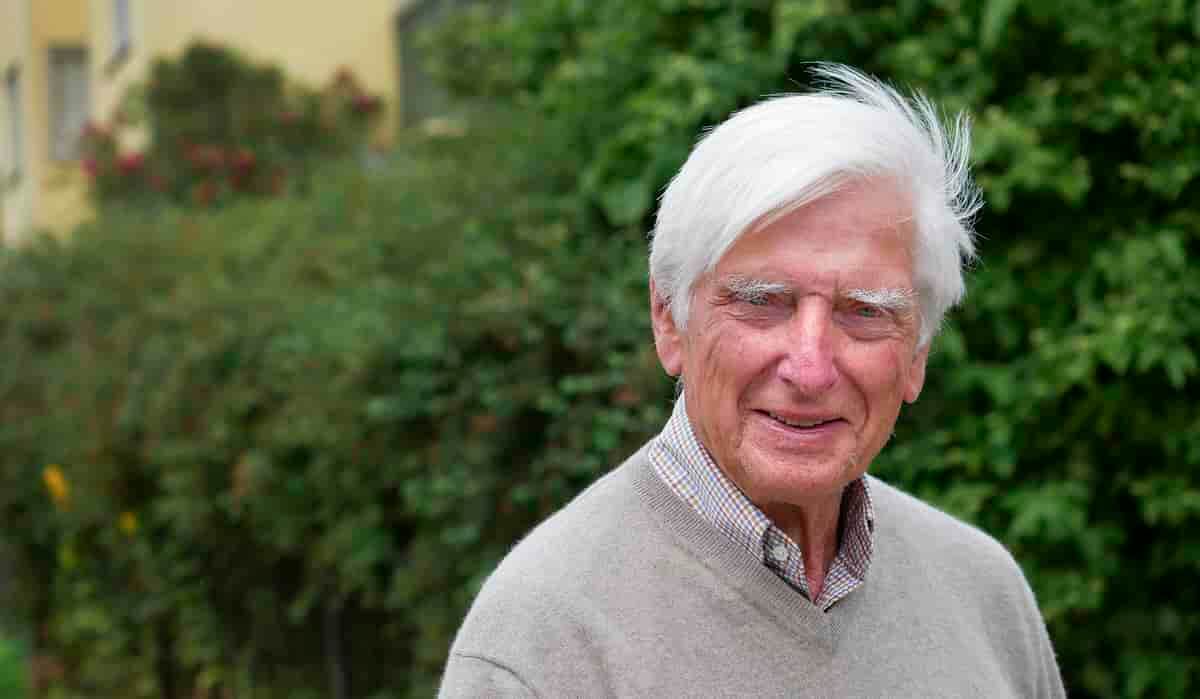
.
Brox wird 1932 geboren, in Doaskku suohkan (norwegisch 1306 Thoskar, 1490 Toskana, 1567 Thoskenn, 1661 Torschen, 1865 Thorsken, heute Torsken. Alle Namen verweisen auf den Dorsch). Die Geschichten und Namen dieses Fischerdorfes, auf Altwestnordisch heißt es þorskr, gehen bis mindestens auf die Wikingerzeit zurück. Es liegt auf Sážža (norwegisch Senja), einer Insel, an deren Westküste ausschließlich Fischerei betrieben wird; studierte Sozialwissenschaften und schrieb 1966 hochaktuelle Klassiker über die Ausbeutung der ehemaligen Allmende (norwegisch allmenning) Norskehavet, des Europäischen Nordmeeres: Hva skjer i Nord-Norge? und Fra allmenning til koloni – übersetzt: Was geschieht in Nordnorwegen und Von der Allmende zur Kolonie – und engagierte isch in der 1975 gegründeten Sosialistisk Venstreparti (SV), der Sozialistischen Linkspartei für die Region und die regionale Fischerei, für eine Ausdehnung der Küstenfischereizone und ein nachhaltiges, dezentrales Ressourcenmanagement, das Fischfang und -verarbeitung an der Küste sichert. Der 1932 geborene Wissenschaftler und Widerständler schrieb 2021, ein halbes Jahr vor den Wahlen in Norwegen einen Aufruf an die nordnorwegischen Küstenkommunen, worin er sie aufforderte, die Kontrolle über ihre wichtigste Ressource wiederzuerlangen, allmenning havet, the ocean commons.

Dieser Ort befindet sich an der Nordwestküste der Insel Sážža/Senja in Romsa/Troms, Nordnorwegen. Av Ximonic (Simo Räsänen) – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23236338
Beim Stummfilm-Konzert: Arsenal/Live music: Attan war ich Nummer 1 der Rush-Ticket-Jäger*innen. Und setzte mich in die letzte Reihe, wie meine russische Bekannte aus Murmansk, die so gerne tanzt, Eugenia empfohlen hat, weil Attan eine recht laute Hardrock-Band ist. Im Programm steht doomsday orchestra. Am Bass stand der russische Gastmusiker Nikolai Olshansky, sein ebenfalls eingeladener ukrainischer Kollege und Freund war erkrankt. Der Film entführte mich mit einer saustarken Bildsprache in die Teeniezeit meiner Großmutter, beginnt am Ende des Ersten Weltkrieges. Who is the enemy? lautet seine Frage.

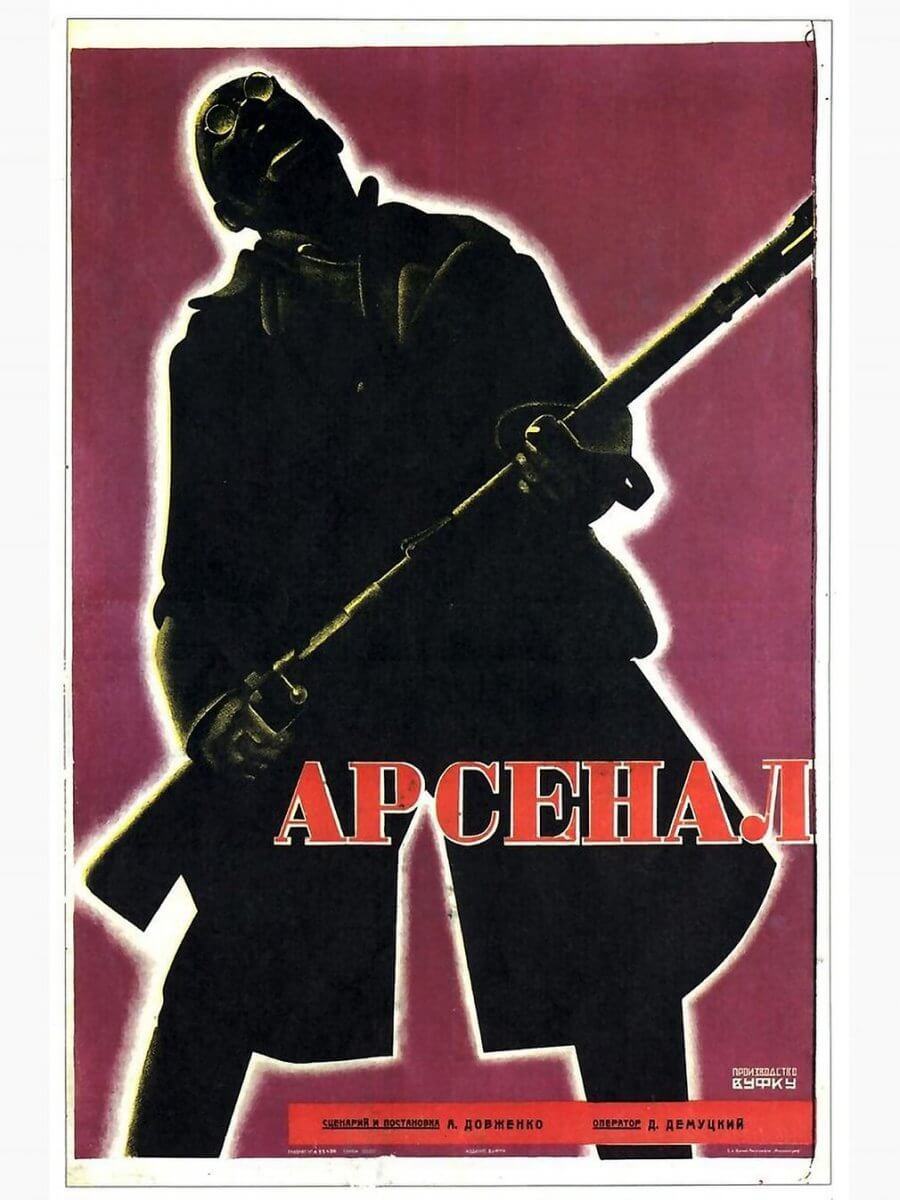
Den Stummfilm Arsenal drehte Oleksandr Petrowytsch Dowschenko (ukrainisch Олександр Петрович Довженко) 1928. Er spielt im Russischen Bürgerkrieg zwischen kommunistischen Bolschewiken, den Roten, und einer heterogenen Gruppe von Gegnern, den Weißen, dessen Beginn und Ende umstritten sind. Er dauerte maximal von 1917 – 1923, minimal von 1918 – 1920. In jedem Fall geriet meine Großmutter mütterlicherseits im Teeniealter zwischen die Fronten und war zeitlebens Kriegsgegnerin. Auch Dowschenko steht kriegerischen Auseinandersetzungen kritisch gegenüber.

Habe mich als Flaneurin in Fellstiefeln dann noch in das eingefädelt, was auf der Hauptstraße tobte: arktisches Outdoor-Nachtleben. An diesem TIFF-Wochenende sind Norweger*innen in Scharen in den Norden geflogen. Erst jetzt komme ich dazu, die jugendstilige Fassade von Norwegens ältestem Kinogebäude, das noch in Betrieb ist, zu betrachten.
feiere Samstag, den 21. – 12:42 – AMTMANDENS –
vorher rutsche ich, nur von meinen Isbroddern gebremst, bergab gen Alaskasvingen. Auf der leicht angetauten Eisdecke des Bürgersteigs liegt eine trügerische dünne Schneedecke. Fühle mich mit all dem total zuhause. Mein Periodebillet/24 timer/Honnør/Senior 67+ gilt noch ein paar Stunden. Bli vild! lautet die erste schriftliche Aufforderung dieses Tages. Bli heißt bleib … den Rest reimt ihr euch selbst zusammen. Meine innere Cineastin ist schon hellwach, lässt mich genau den richtigen Bus und in Tromsø City die richtige Nebenstraße erwischen.
Morgenkino ist erfrischend, besonders, wenn einer polare Winde um die Ohren gehauen werden wie bei „The Visitors“. Der tschechische Film nimmt mich mit nach Longyearbyen. Hatte vor fast 40 Jahren, in denen sehr viel Wasser die Gletscher runtergeflossen ist, das unwahrscheinliche Glück, dort Mittsommer zu begehen.
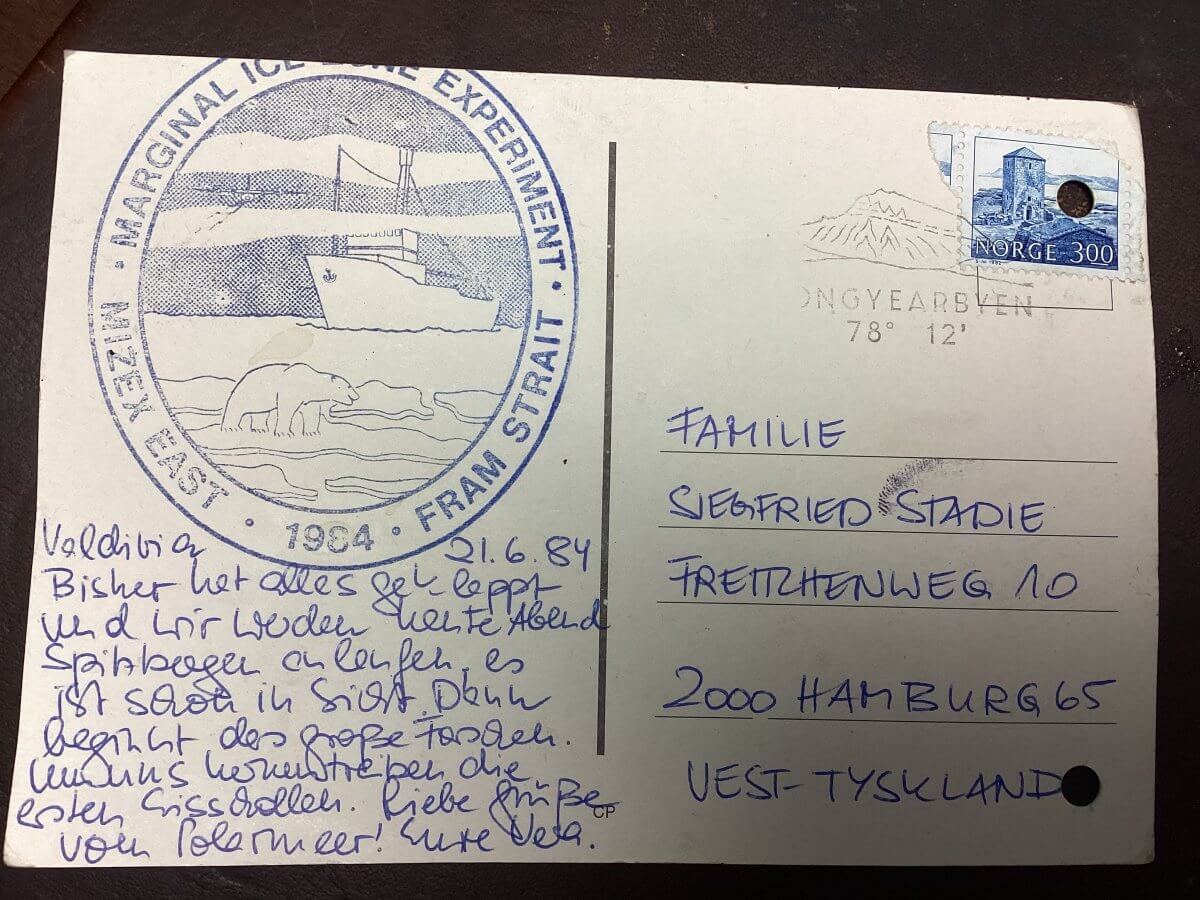
Auf dieser Postkarte ist so einiges zu erkennen. Zum Beispiel auf dem Poststempel der Breitengrad von LONGYEARBYEN: 78° 13′, und der Umriss der Berge dahinter. Auch, dass es zu NORGE, Norwegen, gehört. Und dass die Fahrt des umseitig abgebildeten Forschungsschiffes Valdivia im Rahmen des internationalen MARGINAL ICE ZONE EXPERIMENT (MIZEX EAST) uns durch die Framstraße, einen Seeweg zwischen Grönland und Spitzbergen, benannt nach Roald Amundsens Forschungsschiff Fram, an den Eisrand und zu den Eisbären führte.
Zum Archipel Svalbard. Dessen norwegischer Name entstammt einer Schrift aus dem Jahr 1194, dort stand nämlich Svalbardi fundinn = kalte Küste. Die arktische Inselgruppe liegt zwischen Norwegen und dem Nordpol. Ihre größte Insel ist mit fast 38.000 Quadratkilometern Spitsbergen (Spitzbergen, danach wird im Deutschsprachigen das gesamte Archipel genannt). Der Golfstrom ermöglichte dort die nördlichste eisfreie Siedlung der Welt: Longyearbyen.
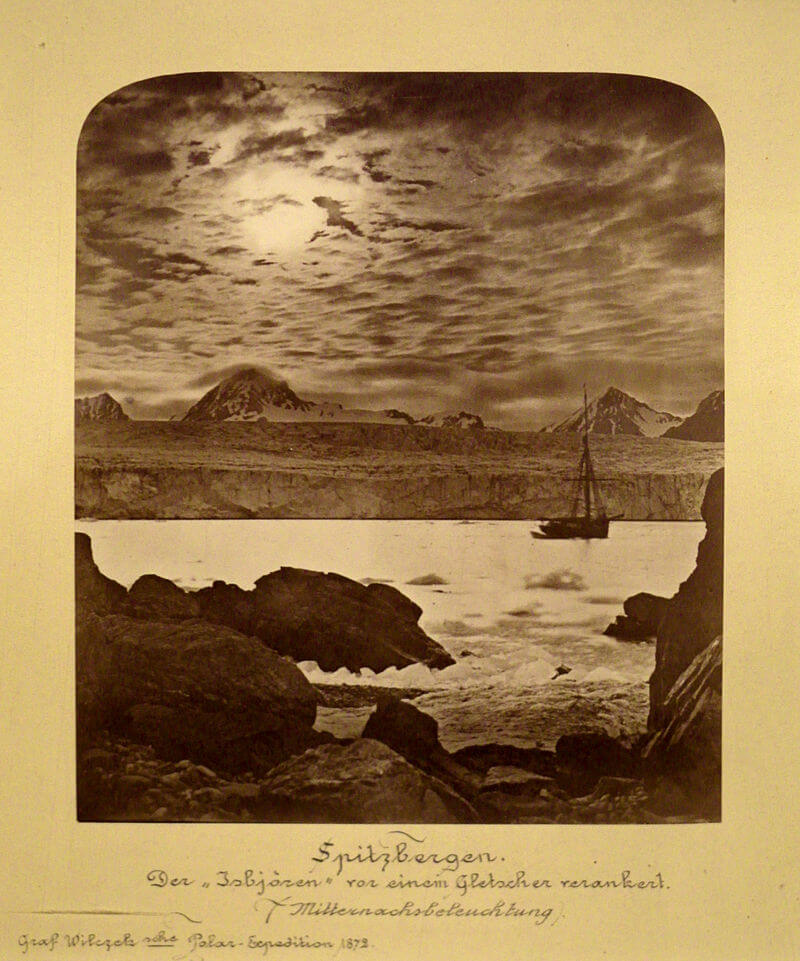
In Sachen Beleuchtung hat sich nicht viel geändert. Dieses Bild von Spitzbergen schoss der österreichische Fotograf Wilhelm Burger Mittsommer 1872.
Die Inselgruppe Svalbard, insbesondere die Insel mit dem norwegischen Namen Spitsbergen, erzählt laut deutscher Wiki „ungewöhnlich abwechslungsreiche und komplizierte“ geologische Geschichten. Mangels Zahlenverständnis verlagere ich mich eher auf Storytelling und gefühlte Geologie statt auf harte Fakten und bitte kleinere millionenschwere Irrungen zu verzeihen. Meine Kollegen bei der Zeitung pflegten mich zu warnen: „Vera, trau bitte keiner Zahl über drei!“

Der Newtontoppen ist der höchste Berg der Inselgruppe Spitzbergen und liegt im Nordosten der Insel Spitzbergen. Dieses 1923 aufgenommene Foto zählt zu den ersten Luftbildern vom Archipel, Walter Mittelholzer
Svalbards versteinerte Story hat mit Laurentia und Rodinia zu tun, erdgeschichtlich uralten Kontinentalblöcken, sogenannten Superkontinenten. In Laurentias Landmasse, die auch Grönland umfasst, wurden die ältesten Gesteinsformationen der Welt gefunden. Sie sind möglicherweise mehr als vier Milliarden Jahre alt. Da hilft selbst die coole englische Abkürzung mya – für million years ago – nicht weiter. „Is´nur ´ne Simu´“, hätte ein alter Bekannter zu den Rekonstruktionen erdgeschichtlicher Festländer gesagt. Mir verschwimmen bei der Betrachtung aufs Angenehmste im Anthropozän (diesem vom Menschen „gemachten“ Erdzeitalter) zementierte Weltbilder. Ich mag die Anordnung der ehemaligen Kontinentalblöcke um den Nordpol, entdecke meine Lieblingslandmasse: Baltica. Und neue Perspektiven für den globalen Umgang mit Ressourcen. Vor gut einer Milliarde Jahre gab es nur einen Ozean, das passt doch perfekt zur oben erzählten one-ocean-mission der Statsraad Lehmkuhl?
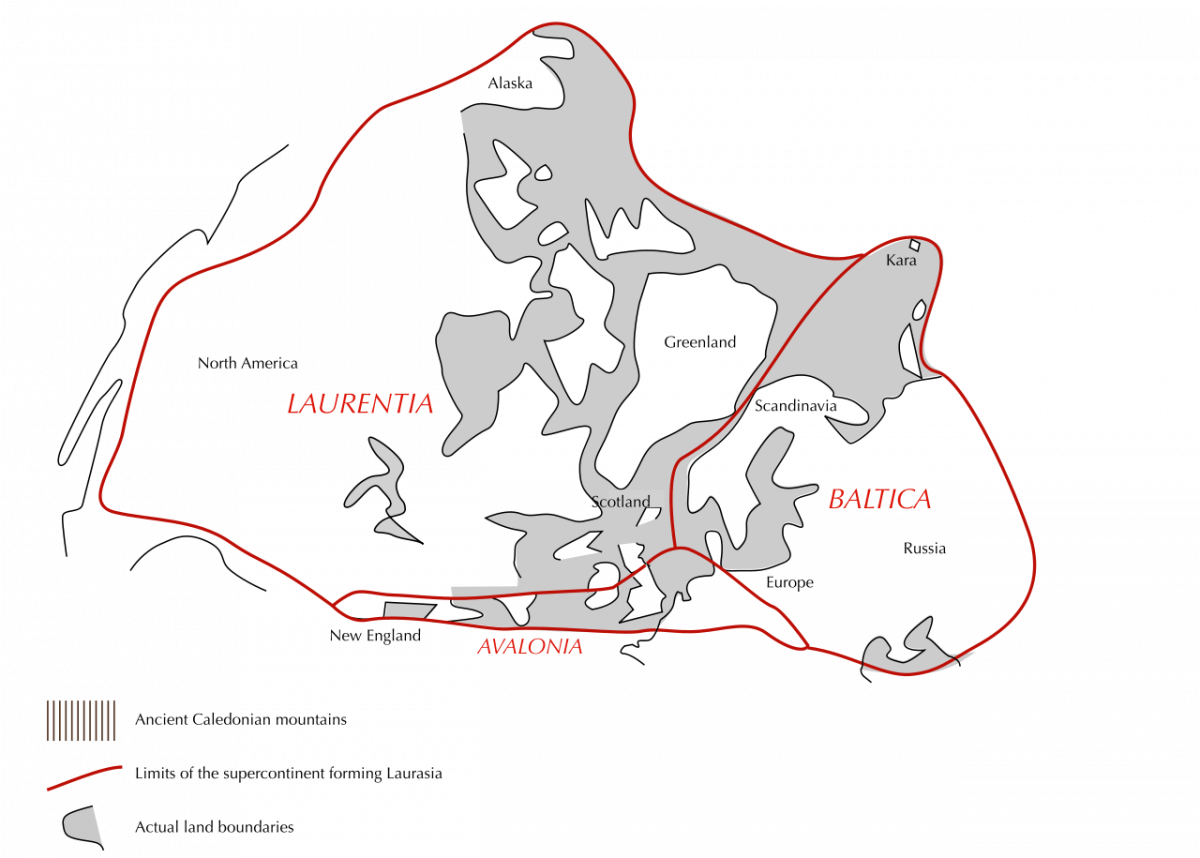
Der Großkontinent Laurussia im Devon, bestehend aus den zuvor getrennten Kontinenten Laurentia, Baltica und Avalonia. Von Thomas ROBERT, CC BY-SA 3.0
Mir wird jetzt doch schwindlig, denn die Gesteine vor mir auf dem Schreibtisch – eine Platte enthält den Abdruck eines Halmes mit allen Adern – könnten sehr viele mya zurückführen. Soll ich zur Entschuldigung einfügen, dass wir illegale Steineklopfer allesamt recht junge Forscher*innen (diverser Disziplinen und Nationen, darunter auch Geolog*innen) waren und bei unserem kurzen Landgang im Juni, in den 1980ern, nicht nur vom sogenannten Polartag, diesen hellen Wochen, in denen die Mitternachtssonne nicht unter Spitsbergens Horizont sinkt, berauscht waren? Und mir das sonnenwendliche leichtbekleidete stundenlange Steinklopfen eine sehr schmerzhafte Nierentzündung mit auf die Rückreise gab?
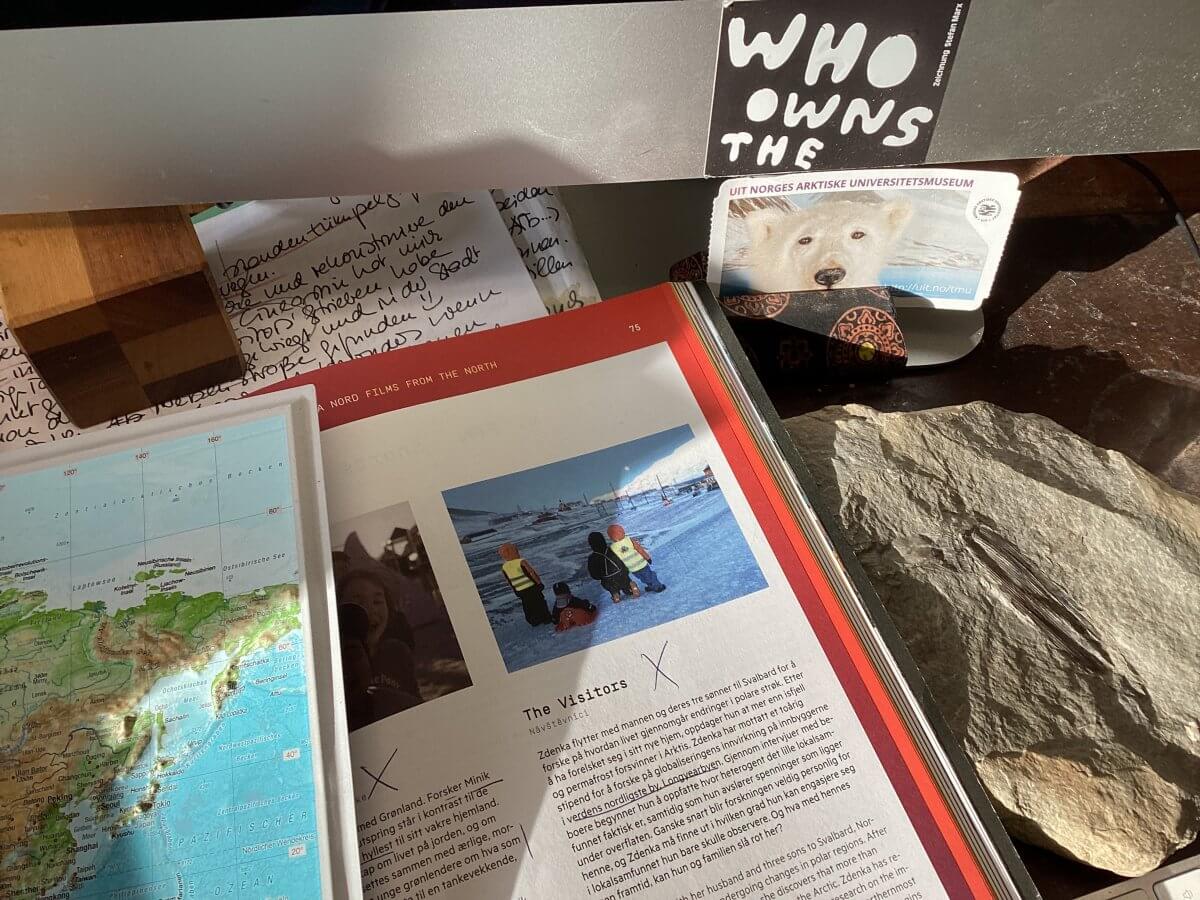
Das Arrangement WHO OWNS THE Eisbär hat sich zufällig ergeben, die geklaute Versteinerung habe ich unterm TIFF-Programm versteckt.
Jetzt gehe ich der Sache auf den Grund, Jahrzehnte später – mit ganz anderen Werten. Spitsbergens Grundgebirge stammt aus dem Erdaltertum (Paläozooikum, 1750 mya) und war möglicherweise mit moosartigen Pflanzen besiedelt. Im Zeitalter des sichtbaren Lebens – es wird von nicht nur mit dem Mikroskop sichtbaren Fossilresten bezeugt und daher Phanerozoikum genannt, von den griechischen Wörtern φανερός phanerós = sichtbar und ζῷον zôon = Lebewesen – so um die 400 mya herum, entstanden auf dem späteren Spitsbergen mächtige Ablagerungen.
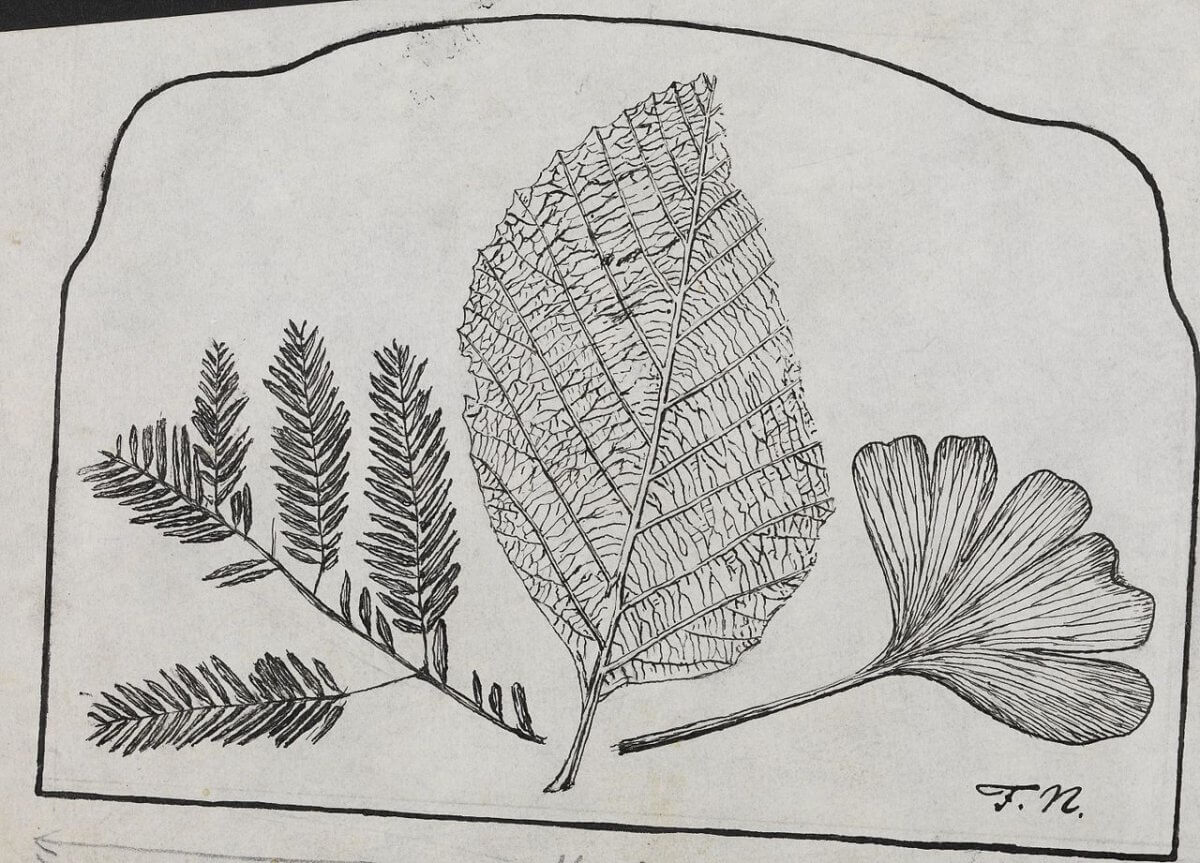
Fridtjof Nansen skizzierte Spitzbergens versteinerte Botanik: von links die Blätter einer Sumpfzypresse, ein Blatt aus der Kreidezeit und ein Ginkgo-Blatt.
Und diese Ablagerungen sind in unserem Erdzeitalter berühmt für ihren Reichtum an Fossilien (von lateinisch fossilis = ausgegraben), jenen Zeugnissen vergangenen Lebens, die wir damals, allerdings in ganz kleiner Menge und nur für den Hausgebrauch, entwendeten. In der Gegend Nordenskiöld-Land beim Hafen Longyearbyen, wo wir uns in jener hellen Nacht herumtrieben, gibt es einen extrem erforschten Sandsteinkamm namens Festningen.

So zeigt sich das Sandsteinprofil auf Festningen. Av Hannes Grobe 21:21, 26 October 2007 (UTC) – Eget verk, CC BY-SA 2.5
Seit 2003 ist dieser Sandsteinkamm Geotopschutzgebiet. Dort liegen 135 Millionen Jahre alte Muscheln und Tintenfische begraben, die Abdrücke von Dinosaurien zeugen von Zeiten vor 100 Millionen Jahren. Die Pflanzenfossilien auf der Insel versteinerten vor 65 Millionen Jahren, in dieser Zeit entstanden auch die Kohlelagerstätten, auf Grund derer Spitsbergen irgendwann in anderen Zeitaltern in Claims aufgeteilt wurde – es folgten Eingriffe von Ausbeutung bis Zerstörung.
Seltsame Weltferne oder Fabelaktig Fangstkarriere
Anders waren die Jäger drauf, von denen Christiane Ritter erzählt. Ihr Buch, Eine Frau erlebt die Polarnacht, erwerbe ich in jenen 24 Stunden Polartag in Longyearbyen, die mir in der Rückschau unendlich lang vorkommen. Die österreichische Malerin und Autorin wird 1897 in Karlovy Vary, Karlsbad, einem Kurort im Westen Tschechiens geboren und ist damit Zeitgenossin meiner Großmutter mütterlicherseits und sozuschreiben „Landsmännin“ ihres Schwiegervaters. Urgroßvater Peter Holub wurde in Lowny (deutsch Lauen/Böhmen oder Laun) am Rande von Österreich-Ungarn, mittig zwischen Dresden und Nürnberg geboren. Und das liegt nur gute zwei Zugstunden von Karlovy Vary entfernt. Und so entsteigt der zirkumpolaren Recherche das nächste Filmfest:): Mezinárodni filmovy festival Karlovy Vary (KVIFF). Das internationale Festival hatte 1946 Premiere und ist damit eine der ältesten Filmschauen der Welt. Ich stelle mein Zelt auf die Festivalwiese, tauche diesmal in osteuropäische Bilderwelten und Wortwolken ein, und wenn Crew und Staff dort ausziehen, leiste ich mir für mindestens eine Nacht ein Zimmer im Grandhotel Pupp. Als Belohnung für diesen ewig langen Blog:)


Der Geburtsort von Malerin und Autorin Christiane Ritter, Carlsbad, Karlsbad, ein internationaler Kurort in der Monarchie Österreich-Ungarn, zu ihrer Kinderzeit, Anfang des 20. Jahrhunderts

Grandhotel Pupp in Karlovy Vary, Česká republika, zu meiner Zeit (es wird vor allem gebaut, vor allem dort, wo es sich finanziell lohnt:))
Zurück zu Ritter und ihren Ortszeiten. Den Nachnamen hat sie von einem durchaus im freundlichen Sinne ritterlichen Jäger und Seemann mit finnisch-österreichischen Wurzeln. Herrmann Ritter betrieb mit seinem Kutter Eismeerfang, und wenn das Nord-Polarmeer im Winter vereist war, auf dem dortigen FestlandPelztierjagd. „Lass alles liegen und stehen und folge mir in die Arktis“, schrieb er seiner Frau. Sie folgt nicht sogleich. Doch dann begannen, wie die Autorin schreibt, „die im Sommer eintreffenden Tagebücher aus dem hohen Norden“, die von den Tieren und dem Reiz der Wildnis, „von den seltsamen Beleuchtungen der Landschaft, von der seltsamen Beleuchtung des eigenen Ich in der Weltferne der Polarnacht“ erzählten, sie zu locken. Im Sommer 1934 legt ihr Schiff in Hamburg ab und vier Wochen später an der Westküste der Insel mit dem norwegischen Namen spitsbergen – diese Insel gehört zur nördlichen Landmasse des ausgedehnten Archipels Svalbard, das auf Deutsch insgesamt Spitzbergen genannt wird – an, wo die österreich-ungarische Malerin und Schriftstellerin jenseits aller Zivilisation genauer geschrieben im Norden von West-Spitzbergen, wie sie eindrucksvoll und packend beschreibt, die Polarnacht erlebt, phasenweise ganz allein, zumindest ohne menschliche Gesellschaft. Und dabei viele hundert Meilen von der nächsten Siedlung entfernt, sich selbst, der Tierwelt und auch dem, was größer ist, zeitweise gefährlich, zweitweise genüsslich sehr nahe kommt. Sie wurde gewarnt, gleich nach dem Ablegen in Hamburg. Ich lese Ritters Buch, das ja nun schon eine mehrwöchige Schiffsreise – auf der gleichen Route wie Ritter, wie sie vorbei an den typischen Nordlandfjorden, „gletschergrünes Wasser, daraus herauswachsende steile dunkle Felsen, Wasserfälle, die von den bergen wehen wie weiße Fahnen“ – und die Ruppigkeiten von fast 40 Jahren Umherziehen hinter sich hat, schon etwas zerknüllt und zerfallen ist, mit ganz anderer Aufmerksamkeit und mag sehr ihre Illustrationen.
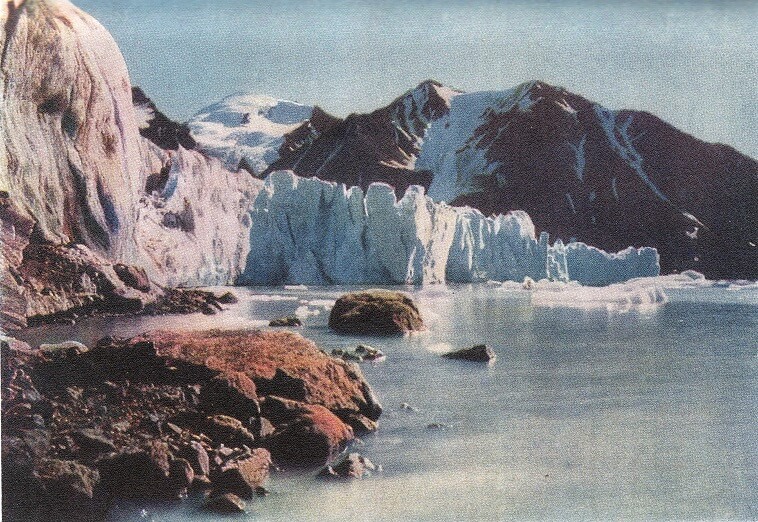
Gletscherfront des Mayerbreens, er gehört zu den in den Krossfjord im Nordwesten der Insel Spitzbergen kalbenden Gletschern, fotografiert und koloriert 1910 von Adolf Miethe
Sie zeichnet auch die Stiefel, die Helmer Hansen in Tromsø ihr verpasst: „Fruen soll sich Komaga kaufen, Wasserstiefel sind nicht notwendig, aber Filzsocken.“ Und ich bemühe wikipedia.no. Da heißt das Schuhwerk Kommager/ar und ich lerne, dass dies der norwegische Name für ein Paar rotbraunes traditionelles samisches Sommerstiefel ist, auf Samisch bieksu genannt.

Kommagar mit Band. Das Band wurde 1957 fürs Norsk Folkemuseum von Lempi Mikalsen aus Kautokeino gekauft, der es hergestellt hat. Av Anne-Lise Reinsfelt – Norsk Folkemuseum: image no. NFSA.3575FG, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 3.0
Helmer Hansen steht auch nur in der norwegischen Wikipedia, als Helmer Julius Hanssen, als „fangstmann, norsk polfarer og skipskontrollør“ (Fischer, Befahrer der Polarregionen und Schiffskontrolleur); und weiß Bescheid, hat er doch mit Amundsen als einer der Ersten überhaupt die Nordwest-Passage durchsegelt, jenen knapp 6000 Kilometer weiten Seeweg übers Nordpolarmeer, seine Randmeere und zugehörigen Meeresstraßen, auf dem einer schon mal kalte Füße kriegt. Empfohlen hat ihn Amundsen damals ein Apotheker namens Zapffe in Tromsø, wie no.wikipedia.org akribisch berichtet. Zapffe hat diese Expedition sicher mit Medikamenten ausgestattet.
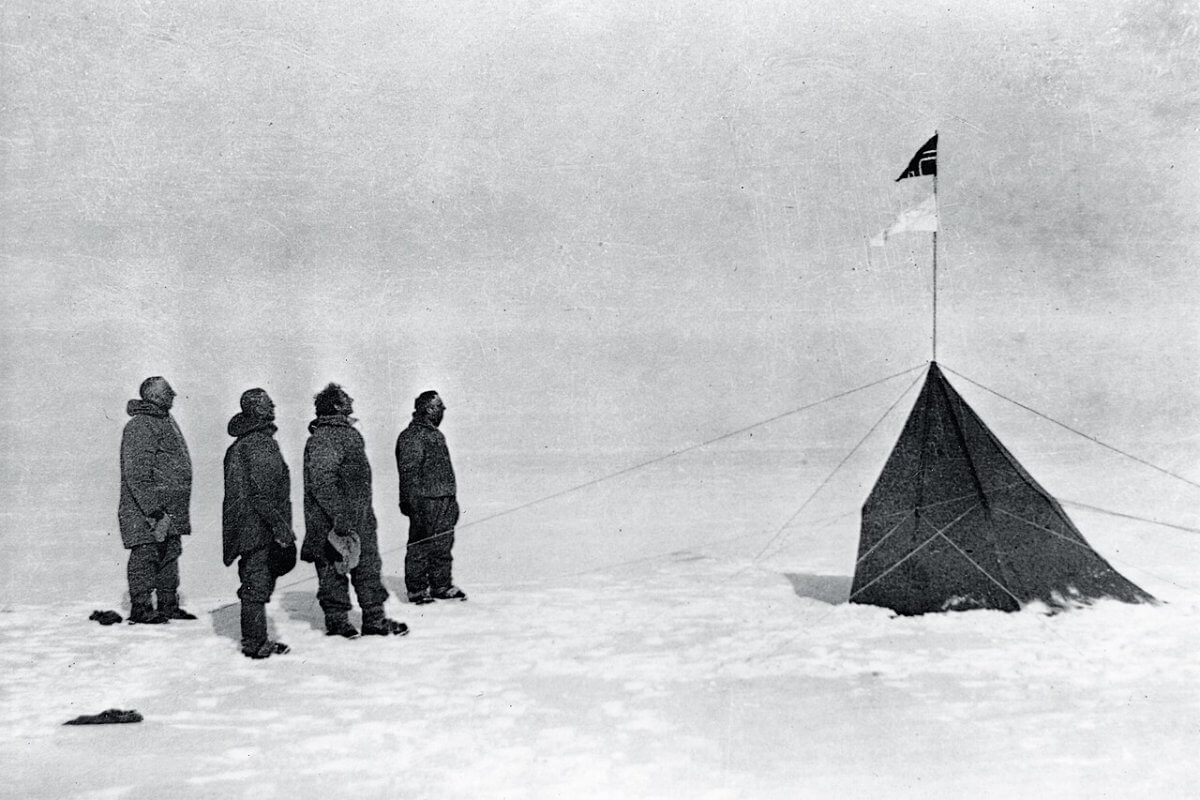
Dieses Foto von Roald Amundsens Fram-Expedition, die den geografischen Südpol am 14. Dezember 1911 erreichte, zeigt Helmer Hanssen als zweiten von links, Olav Bjaaland
Beziehungen und Erfahrungen sind auch vor Ritters Überwinterung fast alles. Helmer holt Fruen, Frau Ritter, nach deren Worten „Lappenschuhe, breit wie Kähne und handgearbeitet aus weichstem Leder“, deren Schuhspitzen in die Höhe stehen, die Stulpen bis zur halben Wade haben, aus der ganzen Stadt. Polfahrer Hansen rät zum allergrößten Paar. Es käme viel Gras in die Schuhe. Je größer sie seien, desto besser.
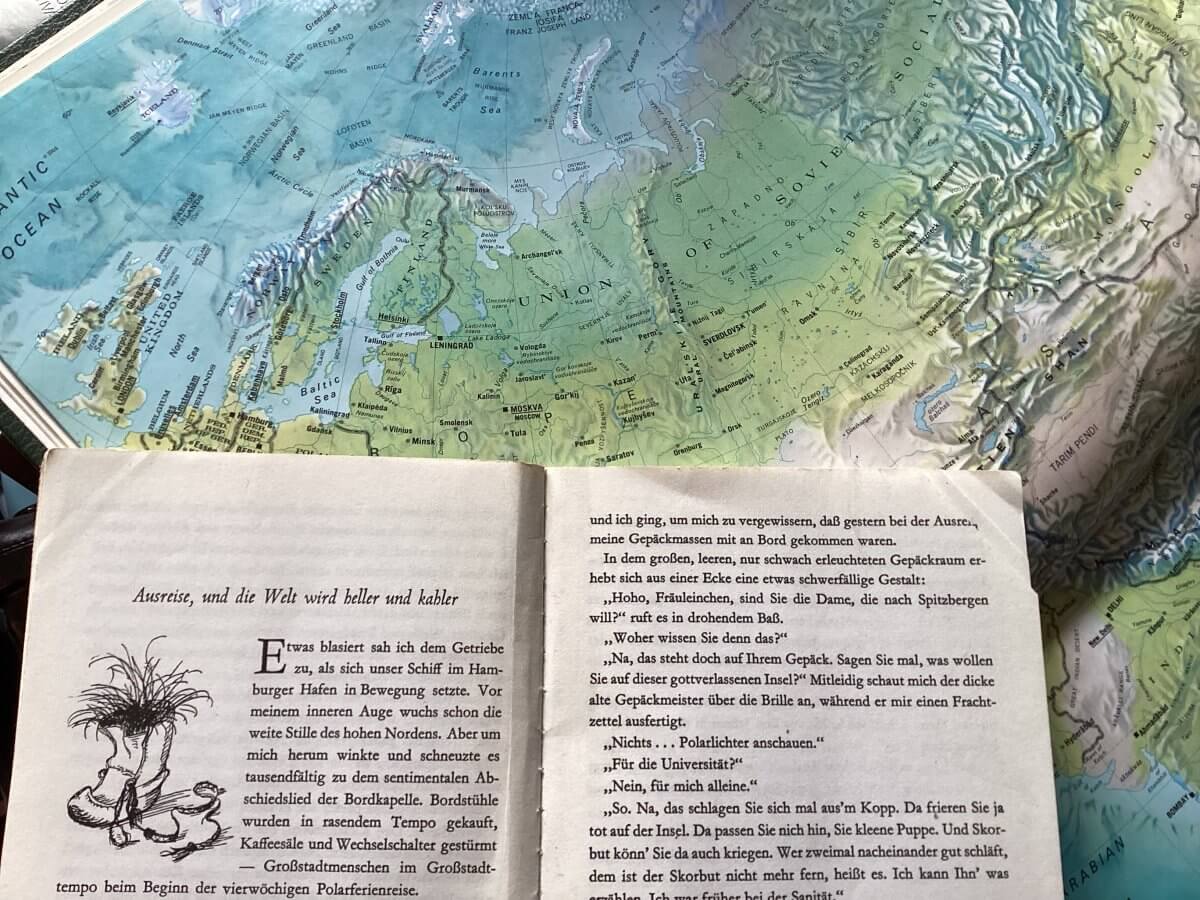
So ein für trockenen Schnee und das Innere von Kote oder Hütte geeigneter Winterstiefel wie er auf Ritters Skizze zu sehen ist, wird gállohat oder nuvttohat genannt. Und zur Isolation, damit die Füße trocken und warm bleiben, mit Gras gefüllt. Botanisch exakt mit Carex vesicaria, im Norden auf Norwegisch sennegras genannt, auf Deutsch Blasen-Segge. Sie besiedelt Verlandungsbereiche von Stehgewässern und langsam fließenden Flüssen oder Bächen und gedeiht auch auf zeitweise überschwemmten, stau- bis sickernassen, mäßig basen- und nährstoffreichen Torfschlammböden, entnehme ich mangels Gräserkenntnis der hiesigen Wikipedia.

Zwei Samen bei der Ernte von Schmalblättriger Blasensegge (Carex vesicaria), einem Riedgras, mit dem die Winterstiefel gefüttert werden, Ellisif Wessel, Preus museum – Ved 1ste K.vand. Senegres høstes.Uploaded by Arsenikk, CC BY 2.0
Und erinnere mich daran, dass die Selbstbezeichnungen der Samen, Sámi, Samit, Samek oder Sápmelaš von der Ursprungsform šämä stammen. Dieses Wort ist übrigens nah mit dem baltischen Wort žēme für Land verwandt, das auch meine väterlichen Vorfahr*innen, die „alten Pruß*innen“, ein baltischer, maßgeblich von den Kreuzrittern vollständig verdrängter Volksstamm, der sich selbst *Prūsai nannte, verwandten. Aus dem Samischen übersetzt bedeutet es: Sumpfleute.
Die von den Sámi und ihren Rentieren bewohnte Tundra ist das Ergebnis von eher lebensfeindlichen Bedingungen: das extreme Klima und in der Regel Permafrostboden bestimmt unter anderem die Pflanzen dort. Sie bleiben niedrig und zeichnen sich durch große Frostunempfindlichkeit aus. Bestandsbildende Pflanzen sind Moose und Flechten, Gräser wie die Schmalblättrige Blasensegge, Kräuter wie sie sonst nur in den Alpen vorkommen und sommergrüne Zwergsträucher. Mir kommt gerade in den Sinn, dass mir die Biologie-Kommiliton*innen bzw. -Kolleg*innen von der Uni Tromsø damals ein landwirtschaftlich-botanisches Forschungsprojekt zur Ansiedlung von Leguminosen, Hülsenfrüchtlern, in ihrer von extremen Umweltbedingungen geprägten Gegend nahegelegt hatten. Die könnten dort, wo Menschen einst nur in ihrer Eigenschaft als Gemischtköstler – also auch Fleischesser*innen – überleben konnten, zu regionaler pflanzlicher Versorgung beitragen.
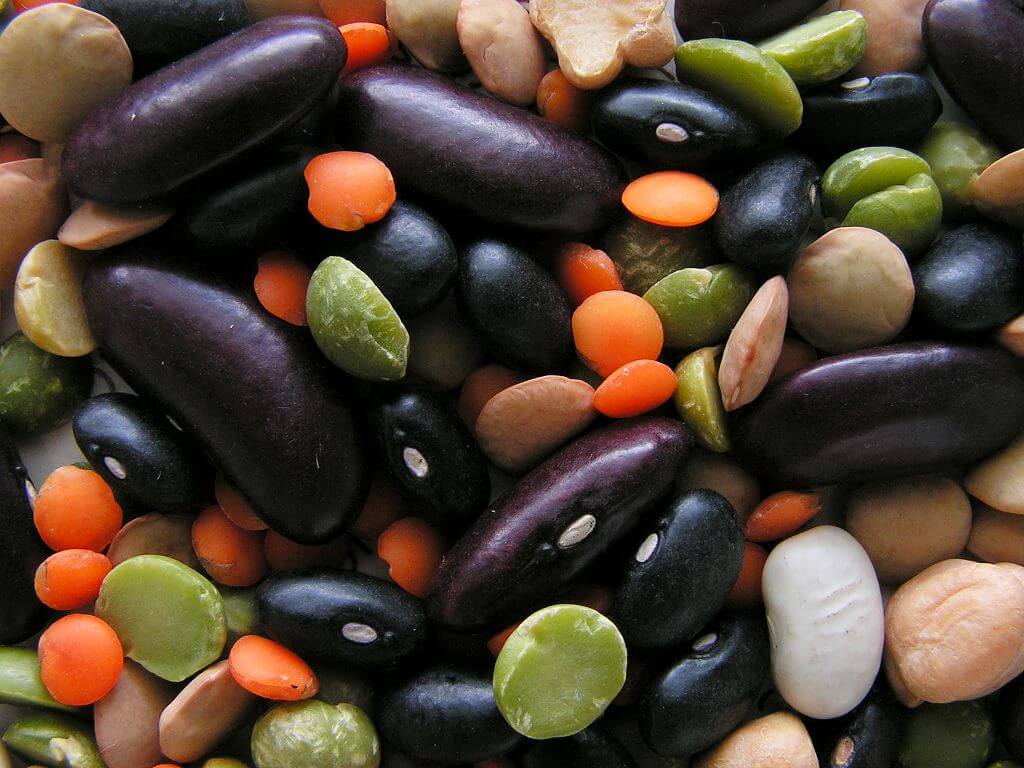
Samen von diversen Hülsenfrüchtlern, Von Bff – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Im Sommer entstehen durch die Staunässe über gefrorenem Untergrund sehr große temporäre (nicht ganzjährige) Feuchtgebiete. Dieses Wechselspiel aus Frost und Nässe, Ursache und Grundlage für die verschiedenartigen Moore und Bodenstrukturen in den Tundren dieser Welt ist, wie wir alle schon lange wissen, durch die Erderwärmung gefährdet.

Die Winterstiefel der Sámi aus Rentierfell heißen auf Nordsamisch gállohat oder nuvttohat. Dieses Foto von Elisabeth Meyer zeigt eine Gruppe samischer Kinder, die ihre Stiefel mit Riedgras füttern. Gelatin silver print, baryta NMFF.002541-8Av Preus museum
Und ich stoße schon wieder auf das Phänomen „female – young – brave – fantastic“, als ich ein Foto von ganz jungen Sámi finde, die Seggenhalme in ihre Fellstiefel stopfen. Es stammt von der 1899 in Norwegen geborenen Elisabeth Meyer. Die Fotografin und Journalistin erstellte 1920 – 1950 „rapporter fra verden“, Berichte von der Welt, wie niemand zuvor. Meyer war beispielsweise die erste westliche und weibliche Person, die den Iran bereiste. Dort war das Fotografieren absolut verboten und sie wurde arrestiert. Außerdem machte sie mit ihrer Kodak Faltkamera eine der ersten Aufnahmen von Mahatma Gandhi und so ganz anders beeindruckende Fotos vom Leben in Sápmi.

Die 1899 in Norwegen geborene Elisabeth Meyer bereiste und fotografierte auf eigene Faust die Türkei, Persien, Syrien, den Irak, Indien und Tibet, und auch den hohen Norden.
Von einem anderen erfahrenen Seemann erfährt Ritter über eine der größten Gefahren der vor ihr liegenden Überwinterung: „Wer zweimal nacheinander gut schläft, dem ist der Skorbut nicht mehr fern.“ Skorbut, früher auch Scharbock oder Mundfäule genannt, ist eine Mangelkrankheit, die bei mehrmonatigem Fehlen von Vitamin C in der Nahrung auftritt. Die Seeleute halfen sich historisch mit Zwiebeln, Sauerkraut u.a., die „Landleute“ im Frühjahr mit Scharbockskraut (Ficaria verna, nur essen, wenn eine/r es genau kennt und nur vor der Blüte!) und Brennnessel.

Scharbockskraut (Ficaria verna) zur Vorbeugung von Skorbut alias Scharbock hatten die Ritters auf Spitzbergen nicht zur Verfügung, Bilder ur Nordens Flora, C. A. M. Lindman
Den Überwinterern auf den Inseln von Svalbard hilft ausschließlich die Jagd.
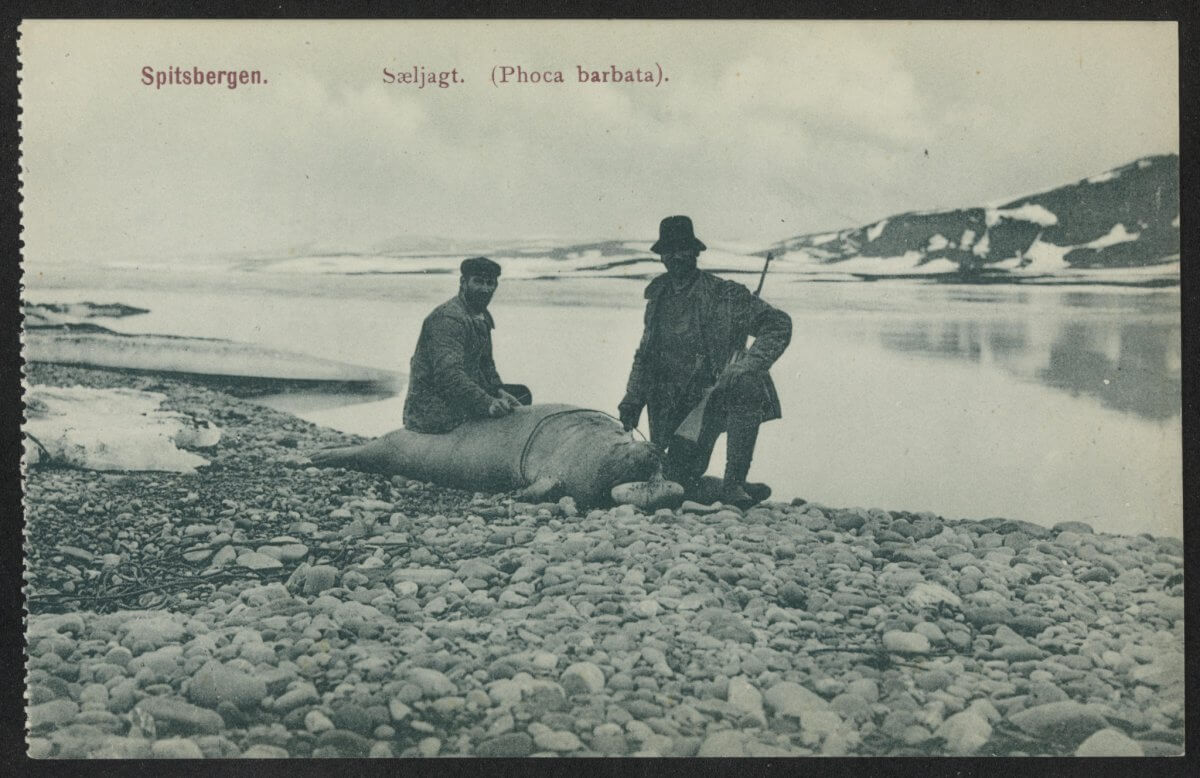
Robbenjagd – verglichen mit der Verminderung und Vernichtung arktischer Tierarten durch die Erderhitzung extrem nachhaltig. Erlegt wurde eine Bartrobbe (Erignathus barbatus oder Phoca Barbara). Sie ist die größte arktische Robbe und verdankt ihren Namen den auffallend langen weißen Barthaaren. Postkort fra Svalbard, utgitt av Nordisk kortforlag i 1910
Lange bevor sie auf Jagd geht, geht Ritter mit ihren grasgefütterten gállohat wieder an Bord. Und passiert auf halber Strecke zwischen Nordkap und der Insel mit dem norwegischen Namen Spitsbergen Bjørnøya, die Bäreninsel, wo der holländische Entdecker Willem Barents 1596 auf einen schwimmenden Eisbären stieß – daher der Name – der kreative norwegische Polarforscher Nansen zeichnete und der deutsche Journalist Theodor Lerner 1899 Kohle abbauen wollte.
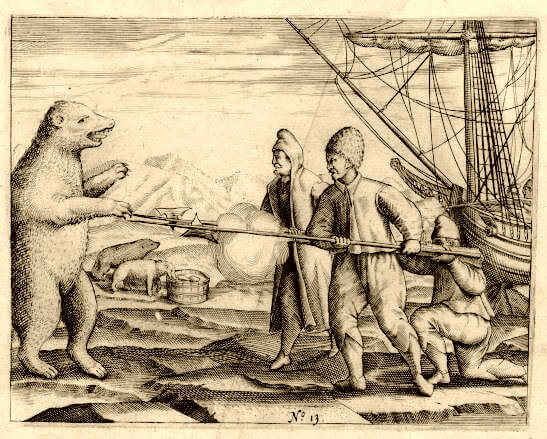
Nach dem Zusammentreffen mit einem schwimmenden Eisbär (Isbjørn) gab Inselentdecker Willem Barents 1596 der Bjørnøya ihren Namen. An anderer Stelle sahen sich seine Männer genötigt, Eisbären zu erstechen, die sich an ihren Proviant machten.
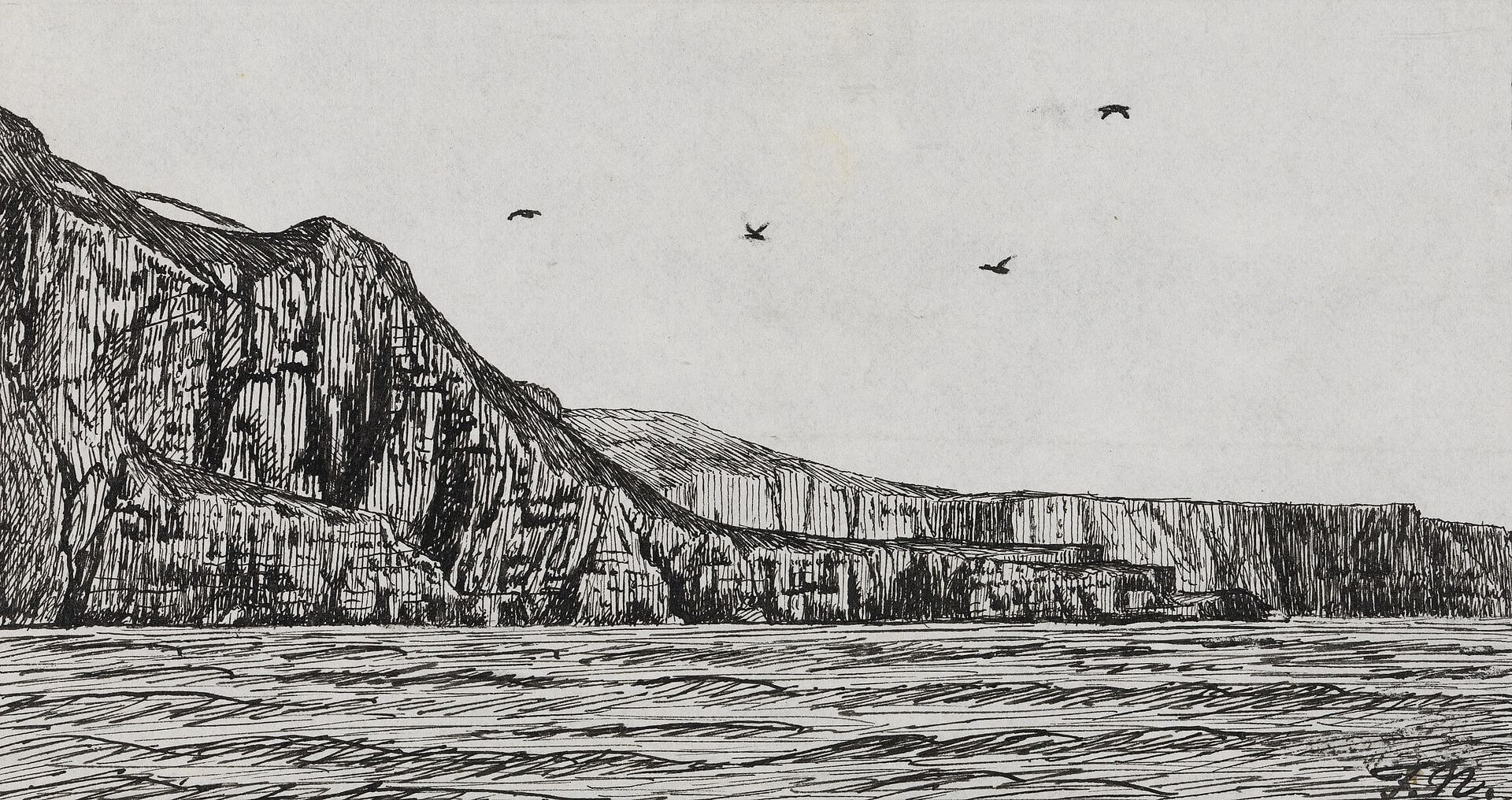
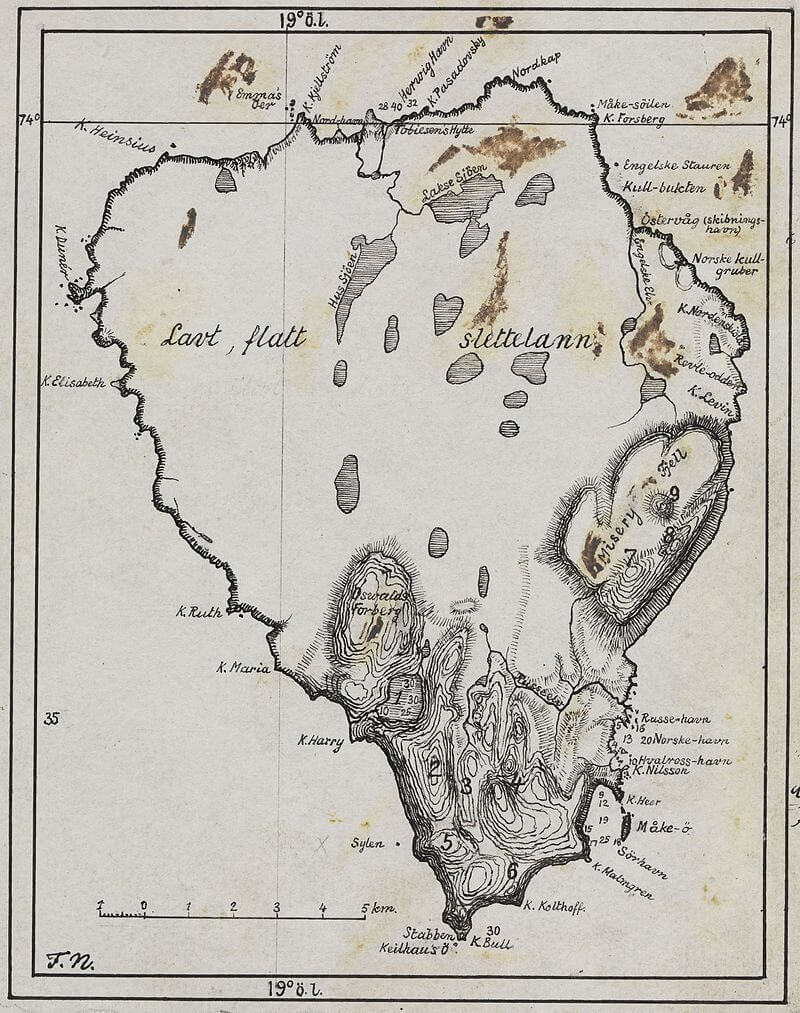
Diese Bilder machte sich Fridtjof Nansen von der Bäreninsel.
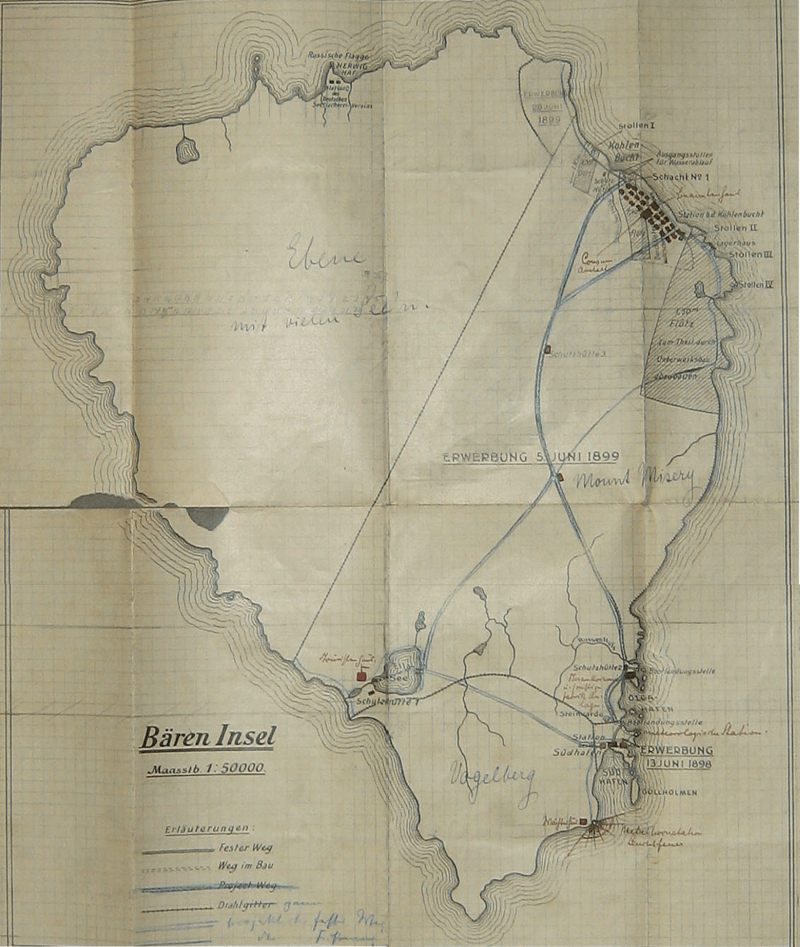
Der deutsche Journalist und Polarforscher Theodor Lerner wollte mit seiner 1899 gegründeten Deutschen Bäreninsel-Gesellschaft dort Kohle abbauen und erstellte dazu eine exakte Karte.
„Den nächsten Morgen haben wir das Südkap Spitzbergens passiert“, schreibt sie. Und gerät in aufmerksam-aufgeregtes Staunen wie ich fünfzig Sommer später: „Am östlichen Horizont … leuchtet ein Streifen merkwürdiges Land, ein Streifen blauer Berge, dazwischen sonnengleißende weiße Gletscherströme.“ Hinter Longyearbyen, dem letzten Vorposten der Zivilisation, damals vor allem Kohlebergwerk, kommt menschenleeres Land.
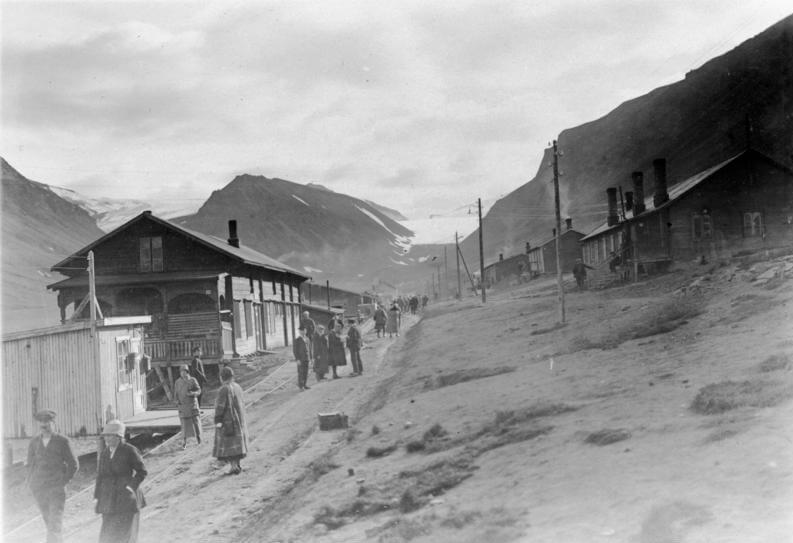
„Einen ganzen Tag lang Berge, Gletscher, blaue Felsen, weißes Eis“. Am nächsten Morgen erreicht Ritters Passagierschiff die Packeisgrenze. Das Erreichen der Packeisgrenze, dieser um kleinere Wasserflächen herum dicht „gepackten“ Eisschollen, hat mich bei unserer internationalen Expedition „Marginal Icezone Experiment“ ehrlichgeschrieben vor allem beeindruckt, weil wir sie in unseren Gin gekippt haben, die ganz kleinen Brocken. Das war dann einer der leckersten Drinks meines Lebens. Außerdem haben wir unsere auf langen Bordwachen in dicken Gummistiefeln strapazierten Füße in Eimer mit Packeis gestellt. Die Füße im Eismeerwasser, die Zunge im eiskalten Gin, ein polares Erlebnis für fast alle Sinne. Das ging aber nur in einer der besonders langen Pausen zwischen zwei Wachen, bei denen wir Student*innen so stocknüchtern erscheinen mussten wie die übrige Schiffsbesatzung unserer Valdivia. Wie wir sie liebten! Hab das ehemalige Forschungsschiff der Hamburger Uni, von dem ich ein Modell durchs Leben trage, mal auf dem Weg von Hamburg zur Packeisgrenze abgelichtet.

Aber so kann eine/r gar nicht sehen, was für ein besonders schönes Schiff sie war. 1961 in Bremerhaven als Trawler (dieser Name kommt vom englischen Verb to trawl, mit einem Schleppnetz fischen; die Valdivia ist im Gegensatz zu sogenannten Seitentrawlern ein Heckfänger) gebaut, gehörte sie ab 1982 der Stadt Hamburg und wurde für Meeres- und Klimaforschung eingesetzt.

Über die MIZ (marginal ice zone), unser damaliges Forschungsobjekt, den Eisrand, diese nicht wirklich feste Grenze zwischen Meereis und Wasser, schreibt Ritter: „Ein paar schüchterne, schmutziggelbe Schollen liegen träge zwischen Nebel und Wasser“ und kriecht wieder in die Koje. Ein paar Schlummerstündchen später – wo schläft eine so friedlich wie im Bauch eines Dampfers? – wird es interessant. Ein Radiogramm kommt an: „Erwarte dich in Kingsbai!“ kündigt dieses per Seefunk übermittelte Fernschreiben ihres Mannes an. Und wir unternehmen jetzt erstmal eine Peilung zur Lokalisierung. So eine Ortsbestimmung passt doch perfekt zum interozeanischen Projekt ORTSZEIT, zu dem ja dieses digitale arktische Logbuch gehört. Kingsbai ist der alte deutsche Name des Kongsfjorden, der auf Englisch Kings Bay heißt, und der norwegische Name der dort ansässigen Bergbaugesellschaft. Heute heißt der Ort anders und liegt weiterhin im Nordwesten der Insel Spitzbergen, gefühlt auf 79 Grad nördlicher Breite; eingefasst von schroffen vergletscherten Bergen.

Drei Kronen [Tre Kronor] (Mt. Dana, Mt. Nora, Mt. Svea) von Süden aus 1600 m Höhe, Spitzbergenflug 1923, ETH-Bibliothek_LBS_MH02-01-0043-A
Östlich des Kongsfjordes erheben sich drei Tausender, die Tre Kronor. In seinem Inneren brüten prachtvolle Vögel: Prachteiderente (Somateria spectabilis), Eisente (Clangula hyemalis), Thorshühnchen (Phalaropus fulicaria). Letzteres, das Thorshühnchen (Phalaropus fulicaria), ist etwas ganz Spezielles, „Ein sondere art der Wasßervögelin.“, wie Johann Leonard Frisch, Jahrgang 1666, sein Bild überschreibt. Es zeigt auf jeden Fall einen Angehörigen der Gattung Wassertreter aus der großen Familie der Schnepfenvögel. Diese arktische Vogelgattung besteht aus nur zwei Arten: Thorshühnchen (Phalaropus fulicaria) und Odinshühnchen (Phalaropus lobatus). Sie lassen sich nur im Brutkleid unterscheiden. Das ist beim Odinshühnchen an Unterseite und Kehle weiß, auf der Wange prangt ein orangefarbener Fleck, so wie auf dem Stich von Kupferstecher, Sprach- und Naturforscher Frisch in dessen 14-teiliger „Vorstellung der Vögel in Teutschland und beyläufig auch einiger Fremden“ gut zu erkennen – auf einer der mehr als 250 Farbtafeln. Wohingegen die Wassertreter*innen vom Kongsfjord sich durch überwiegend kupferrotes Gefieder auszeichnen. „Sondere“ Arten sind alle beide, sie gendern und vertauschen die Rollen. Die Hennchen geben eindeutig den Ton an und locken sich balzend die Hähnchen ins Nest. Das weibliche Thorshühnchen ist größer als ihr Saisongefährte und sein nimmt im Sommer einen deutlich leuchtenderen Farbton an als das des Männchens, das die Aufzucht der Jungvögel übernimmt, während das Weibchen 15 Meter Fjordufer gewaltbereit gegen Geschlechtsgenossinnen auf Brutplatzsuche verteidigen. Hernach trennen sich die Wege. In unscheinbar grauem Unisex-Gefieder machen sich die Thorshühnchen von Spitsbergen auf zu den Küsten von Afrika und Südamerika. Den Winter verbringen diese Langstreckenzieher und Hochseevögel auf dem offenen Ozean, dort wo das Meerwasser reich an Plankton (winzigen treibenden Tieren und Algen) ist. Sie brauchen keinen Kontakt zum Land.

Thorshühnchen (Phalaropus fulicaria), Svenska Fåglar Efter Naturen, Brüder Wright
Könnte als verknallte Vogelbewunderin noch zeilenlang weitererzählen, aber jetzt kommt erstmal die weniger prachtvolle Nachricht. An der Ufern der Insel Spitsbergen, im ausgedehnten arktischen Archipel, das auf Norwegisch Svalbard, auf Deutsch Spitzbergen heißt, sollen zu Beginn unseres Jahrhunderts 200 und 1.000 Thorshühnchen-Paare brüten. Diese Art gilt als eine der Arten, die von den menschgemachten Klimakatastrophen besonders betroffen sein werden. Ein britisches Forschungsteam, das die zukünftige Verbreitungsentwicklung von europäischen Brutvögeln auf Basis von Klimamodellen untersuchte, geht davon aus, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts das Verbreitungsgebiet des Thorshühnchen erheblich schrumpfen und sich nach Osten verschieben wird. „Der größte Teil der heutigen Brutareale auf Svalbard wird dann nicht länger geeignet sein“, heißt es im entsprechenden Wikipedia-Eintrag. Ich kann und mag nicht nachforschen. Aber was mache ich mit meinem Entsetzen? Weiterschreiben! Trotz fortgeschrittenen Alters nicht auf Kreuzfahrt gehen, denn Kreuzfahrten sind auch Klimakiller!
Wenn die Brutvögel ausbleiben, werden am Kongsfjord, in den feuchten Tundren an den Ufern, die bisher durch den Vogelkot reich gedüngt werden, auch ganz bestimmte Pflanzen nicht mehr das bekommen, was sie brauchen; die durch natürliche Düngung ermöglichte Pflanzendichte und -vielfalt wird abnehmen. Bedroht wäre dann über kurz oder lang zum Beispiel das Grönländische Löffelkraut (Cochlearia groenlandica), die Schmalblättrige Arnika (Arnica angustifolia), der Zwergenzian (Comastoma tenellum), die Zweiteilige Schuppensegge (Kobresia simpliciuscula), das Kleine Sandkraut (Arenaria humifusa). Fürs Letztere muss ich mich auf Internet-Expedition zu norwegischen Einträgen begeben und erfahre, dass dieses winzige Nelkengewächs möglicherweise die Eiszeit in seinen lokalen „Zufluchtsgebieten“ im Osten Grönlands und auf Svalbard überlebt hat, die Forscher schreiben von der sogenannten Überwinterungstheorie. Fragt sich nur, ob diese mehr als 12.000 Jahre alte Pflanzenart die heutigen Zeiten überleben wird.

Kleines Sandkraut (Arenaria humifusa), Av (c) Eric Lamb, some rights reserved (CC BY) – https://www.inaturalist.org/photos/143294830, CC BY 4.0,
Pelztierjäger Ritter „bestellt“ seine Frau – die ihm allerdings keinerlei autoritären Stil bescheinigt, sondern vielmehr eine geradezu fremdartige Freundlichkeit und „strahlenden Gleichmut“, die sie auf arktische Einflüsse zurückführt – nicht gleich auf die schroffen, vergletscherten Berge, sondern an einen Ort, wo ein Schiff anlegen kann. Sein Kingsbai wird wird wohl der damals gebräuchliche deutsche Name für eine der nördlichsten Siedlungen der Welt sein. Ausführliche Auskünfte von norwegischer Seite ergeben, dass dieser Ort am Fjord zuallererst Brandal City hieß. City vielleicht, weil der Gründer ein Unternehmer im weltweitesten Sinne war. Peter Andreas Severinsson Brandal wurde 1870 gefühlt geografisch auf der Schädeldecke des nordischen Landschaftstigers geboren zwischen Bergen und Trondheim, in Brandal, dem Heimathafen der Eismeerschiffe, von dem in den hundert Jahren von 1898 bis 1998 die norwegischen Robbenfänger in See stachen. Einige von ihnen betrachteten übrigens Grönland als „alten norwegischen Besitz“, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sie würde uns aber in die gleichen Gewässer führen, ins Polhavet oder Nordishavet, wie die Norweger*innen sagen, diesen immer weniger eisbedeckten Ozean, auf Deutsch kurz Artik, länger Nördliches Eismeer genannt. Dorthin brach Pionier Brandal 1898 mit entsprechend ausgerüstetem Fahrzeug auf. Neben Bergen von Fellen brachte der Robbenfänger neue Erkenntnisse mit. Sie machten ihn zum Geschäftsmann. Er kaufte ein großes Stück Land am Südufer des oben beschriebenen Fjordes, nannte es Brandal City, gründete dort die Kings Bay Kull Compani AS und errichtete für den Transport der Kohle die nördlichste Eisenbahnlinie der Welt. Seit 1919 heißt der Ort an der Bay auf Norwegisch Ny-Ålesund.

Grubenarbeiter der Kings Bay Kull Compani 1918

So etwas Gemütliches wie das 1936 errichtete Hotel gab es in der Ecke von Kingsbai alias Ny-Ålesund alias Brandal City zu den Zeiten von Ritters Überwinterung noch nicht. Foto: Andrew Shiva
Unternehmer Brandal war gut befreundet mit einem anderen unternehmerischen Norweger, mit Forscher Roald Amundsen. Der versuchte 1925 als Erster den Nordpol mit dem Flugzeug zu erreichen und startete in Ny-Ålesund. Auch zu Wasser ist dies ein Verkehrsknotenpunkt mit weltweiter Bedeutung: Ein kleiner Abzweiger des Golfstromes hält die Westküste von Sitsbergen im Archipel Svalbard im Sommer für die Schifffahrt offen und macht sie so zum nördlichsten Kreuzfahrtareal der Welt. Mit den Touristen – schon seit 1893 gab es eine Passagierschiff-Linie nach Spitzbergen! – kamen weitere Rekorde wie der Welt nördlichstes Postgebäude; sowie die Telegrafenstation, von der Jäger Ritter an seine Frau schrieb; das Nordpolhotellet. Letzteres hat geschlossen, man schläft an Bord. In den 2020ern gehen 20.000 Menschen an Land an einem Ort, der im Sommer 130 Einwohner*innen hat. Es ist nur noch zur eisigen Zeit beschaulich, im Winter leben dort heute nur rund 30 Menschen, hauptsächlich Forscher*innen, in Ny-Ålesund, das früher mal Brandal City und auf Deutsch auch Kingsbai hieß. Sauber angesteuert, würden norddeutsche Skipper*innen mit schärfstem S sagen.

Mit diesem Flugzeug startete Roald Amundsen 1925 von Ny-Ålesund gen Nordpol
Pomorische Fallensteller und Pelztierjäger aus. помо́ры, Pomoren, der Name dieses Volkes kommt von am (po) Meer (more). Im frühen 12. Jahrhundert kamen sie über die Се́верная Двина́ – Severnaja Dvina von Novgorod nach Белое море, Béloje móre (auf die Kolahalbinsel) und unternahmen von dort aus Beutezüge in den höheren Norden. Den hellhäutigen Säugetieren im dort vorgefundenen Fjord verpassten sie den Namen белуха (Beluga, vom russischen Wort белый bely = weiß; Delphinapterus leucas).

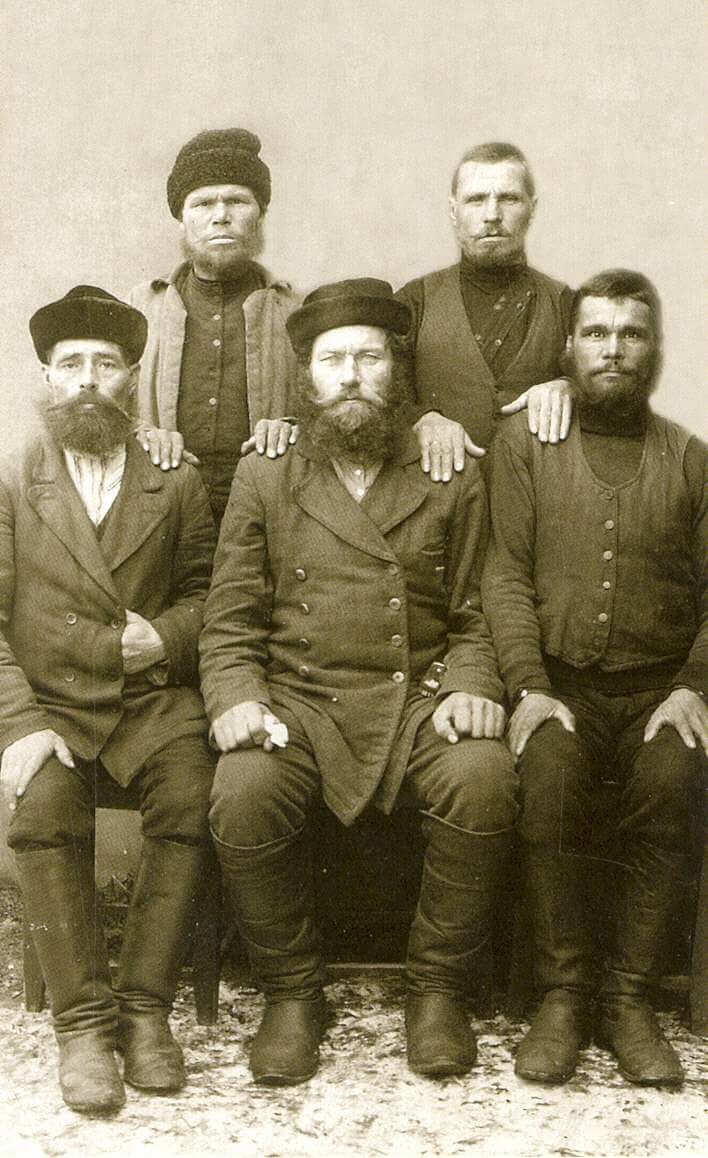
Pomoren, oben: Gemälde von Walentin Alexandrowitsch Serow
Im 17. Jahrhundert lтвуеу der englische Seefahrer Henry Hudson segelnd an der Mündung des heutigen Kongsfjordes. Er nannte sie nach der dort entdeckten Beute Whales Bay.

Der englische Seefahrer Henry Hudson gelangte Anfang des 17. Jahrhunderts segelnd an Spitzbergens Küste und verpasste dem heutigen Kongsfjord damals den Namen Wales Bay. Wenige Jahre später setzten Meuterer, die sich gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen an Bord wehrten, Hudson in einem eisigen, nach ihm benannten Randmeer im Nordosten von Kanada – der Hudson Bay – aus, John Collier
In den kommenden Jahrhunderten wurde der Walfang zu einer immer größeren Sache. Im Februar 1880 brach Arthur Conan Doyle, damals noch Medizinstudent und noch kein Krimischriftsteller, auf einem Walfänger zu den Gewässern vor Spitzbergen auf.
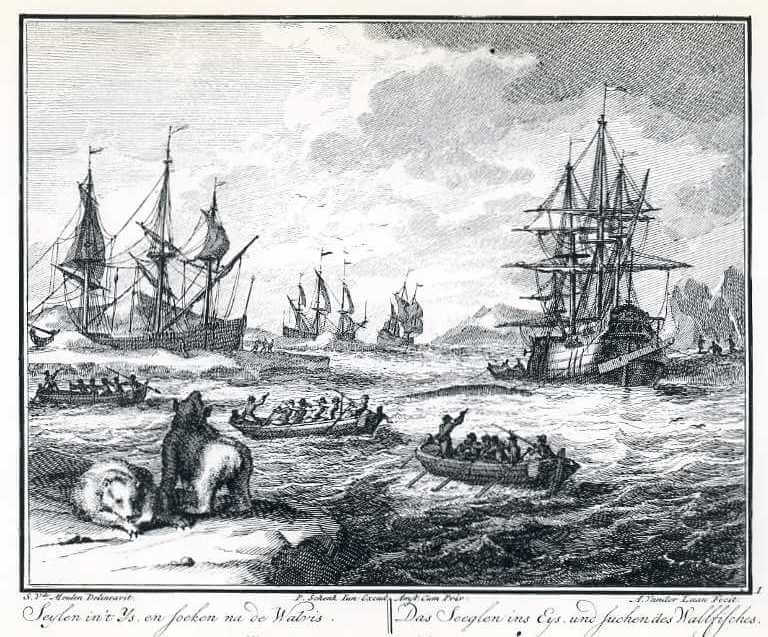
Von Peterhead (gälisch Ceann Phàdraig), dem östlichsten Punkt Schottlands. Die Stadt war im frühen 19. Jahrhundert eines der Zentrum für Robben- und Walfang. „Es ist eine seltsame Vorstellung, dass es in Großbritannien eine Gruppe von Männern gibt, von denen die meisten seit ihrer Kindheit nicht mehr das Korn auf den Feldern gesehen haben.“ Dies sei bei den Walfängern von Peterhead der Fall, schreibt Doyle 1892 in seinem Artikel „Der Zauber der Arktis“. Der Grönland-Walfang, so hieß der Fang zwischen Grönland und Spitzbergen, kam Ende des 19. Jahrhunderts zum Erliegen. „Wie viele können sich noch an die Tage erinnern, als der Hafen Anfang Februar und März von der Flotte der Grönlandwalfänger geziert wurde, viele von ihnen schmucke Schiffe -Briggs, Barken, Barkschoner, die meisten dreimastig“, zitieren die Einleitungsschreiber Jon Ellenberg und Daniel Stashower einen Historiker, in ihrem Vorwort zu „Heute dreimal ins Polarmeer gefallen“, dem Tagebuch von Doyles arktischer Reise. „Was mich an der Polarregion am meisten überrascht hat“, schreibt darin der Zwanzigjährige, „war, wie schnell man sie erreichte. Ich hatte mir nie vorgestellt, dass sie quasi direkt vor der Haustür lag…. Eines Morgens erwachte ich und hörte die Treibeisstücke gegen die Bordwand rumpeln, und als ich an Deck ging, sah ich, dass das ganze Meer bis zum Horizont von ihnen bedeckt war. Keines der Stücke war groß, doch sie lagen so dicht beieinander, dass jemand, würde er von einem zum anderen springen, weit gekommen wäre. Ihr blendendes Weiß ließ das Meer im Kontrast umso blauer erscheinen, und mit dem ebenso blauen Himmel über mir und der herrlichen Polarluft in der Nase war es ein denkwürdiger Morgen.“
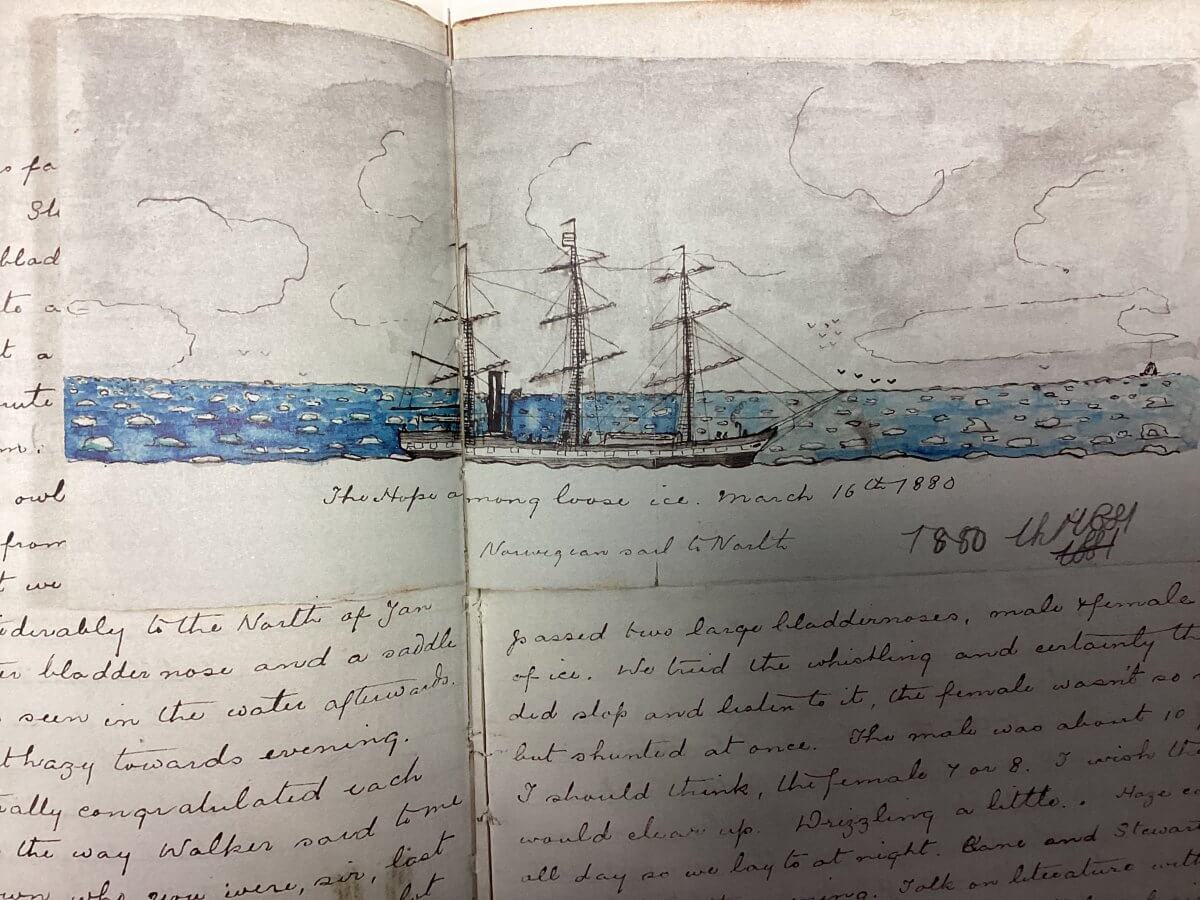
Am 16. März 1880 zeichnet der 20-jährige Arthur Conan Doyle sein Schiff, die Hope, im Treibeis
Gegen Ende der Reise schreibt Doyle: „Wie könnte man euch Kälte und mangelnde Gastfreundschaft vorwerfe, meine armen Eisfelder? Ich habe euch in Flaute und Sturm erlebt und nenne euch warmherzig und freundlich. Euren schaukelnden Eisbergen mit ihren fantastischen Formen wohnt ein drolliger, grimmiger Humor inne.“ Doyle, dem es an Erfahrung auf dem Eis mangelte, fiel bei der Robbenjagd mehrfach ins Polarmeer. Und er bekam Mitleid: „Der Wal hat ein kleines Auge, wenig größer als das eines Stieres; doch den stummen Protest, den ich in einem von ihnen las, als das Tier in Reichweite meiner Hand sein Leben aushauchte, kann ich nicht einfach vergessen.“
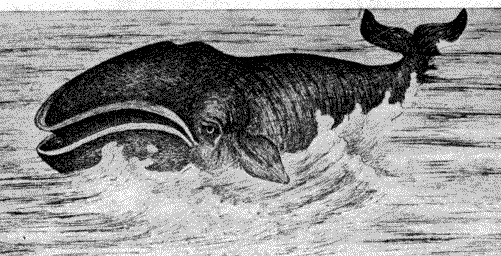
Der Grönlandwal (Balaena mysticetus) wurde 1931 als weltweit erste Wildtierart überhaupt unter Schutz gestellt.
Und er verfiel den Regionen des Polarkreises: „In meinem Herzen bin ich bei jenem alten, grauhaarigen Walfangkapitän, der, als man ihn auf dem Sterbebett kurz allein ließ, in seinem Nachtgewad davontaumelte und von seinen Krankenschwestern weit abseits seines Hauses gefunden wurde, wo er immer noch murmelte, er wolle „nach Norden vorstoßen“. Das merkwürdig jenseitige Gefühl der Polarregionen – das auch in uns, die wir mit der Valdivia von Hamburg bis zur Eiskante und zurück gefahren waren, so verankert war, dass wir tatsächlich in Hamburg nicht von Bord gehen mochten! – „ein so einzigartiges Gefühl, dass es einen ein Leben lang verfolgt, wenn man einmal dort gewesen ist“, schreibt Doyle, hänge größtenteils vom ständigen Tageslicht ab. „Die Nacht scheint einen stärkeren Anflug von Orange zu haben und weniger grell zu sein als der tag, doch sind die Unterschiede nicht groß.“ Einige Kapitäne wären damals für nächtliche Frühstücke und Abendessen um zehn Uhr früh bekannt gewesen, ich erinnere mich an einen kräftigen Braten in brauner Soße morgens um sechs. „Das ständige Licht, der Glanz des weißen Eises, das Dunkelblau des Wassers“, dies seien die Dinge, an die man sich am deutlichsten erinnere, „und die trockene, frische, belebende Luft, die das bloße Dasein zu einer der größte Freude werden lässt.“
Im März 1880 stoßen die Männer von Doyles „Hope“ auf eine Robbenkolonie, eine Herde mit Millionen von Tieren. „Es ist gewiss die zurzeit größte Ansammlung großer Tiere auf Erden“. Die Jungtiere, die nicht fliehen könnten, würden mit Keulenschlägen auf den Kopf getötet. „Es ist ein blutiges Handwerk, den armen kleinen Schelmen die Schädel einzuschlagen, während sie aufblicken und einen mit ihren großen, dunklen Augen ansehen.“ Doyle fällt wieder ins Wasser und wird mit einem Bootshaken herausgefischt. Der Kapitän nennt ihn den „großen Eistaucher“. Und der schreibt an seine Mutter, sie solle sich keine Sorgen machen: „Wenn einer je zur rechten Zeit am rechten Platz war, dann ich.“
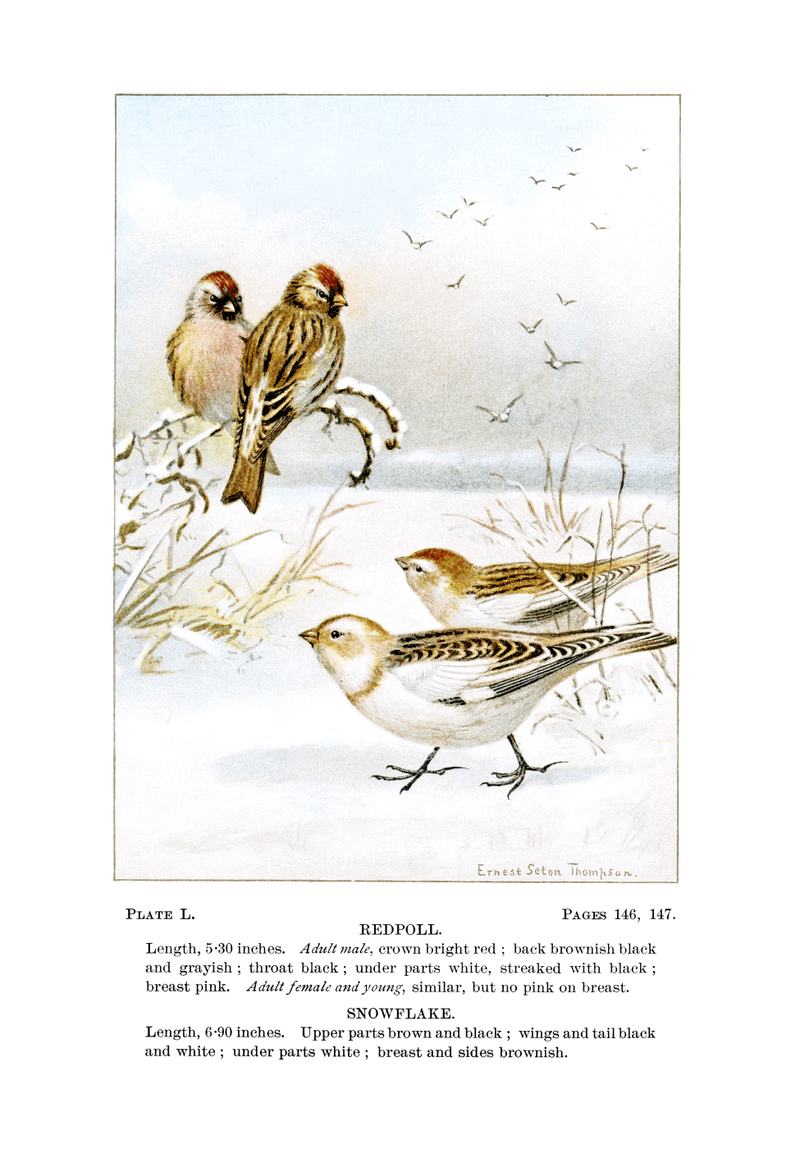
Untere Vögel: Schneeammern (Plectrophenax nivalis), auf Englisch tatsächlich SNOWFLAKE genannt.
Im April sichtet Doyle einen hübschen kleinen Vogel „mit einem roten Federbusch auf dem Kopf, etwas größer als ein Spatz …. Ziemlich langer Schnabel, kein Schwimmfuß, unten weiß, mit einem „pie-wiet-pie-wiet“. Eine Art Schneeflocke.“ War wohl eine Schneeammer (Plectrophenax nivalis). Auf Englisch tatsächlich snowflake genannt.
Und wer je auf hoher See war, weiß, wie sehr alle das Erscheinen eines Vogels entzückt und entrückt. Die Eismöwen (Larus hyperboreus) nennt er Bürgermeister. Und tatsächlich finde ich ein Foto mit russischem Titel, unterschreiben mit „burgomaster“. Es sind winzige Meisterchen darauf. Andernorts schießt die Mannschaft Sterntaucher (Arca alle) und Königseiderenten. Auf seiner Vogelliste tauchen zudem der Eissturmvogel oder „Maulie“ (Procellaria glacialis), das „dumme“ Taucherhuhn oder der Eistaucher (Colymbus troile), die tauchertaube (Colymbus grylle), der „Schneevogel“ oder die Elfenbeinmöwe (larus eburneus), der Birkenzeisig (Fringilla linaria) auf 75 N., der Papageientaucher oder „tammy norie“ (Alca arctica) auf 78 N., die Felsen-Raubmöwe (Larus crepidatus) auf 78,12 N., der Isländishe falke (Falco islandicus) auf auf 73,40 N., die Große Schnee-Eule (Stryx scandiaca) auf 71 N., die Seeschwalbe (Sterna hirundo) auf 78,18 N., die Bernierente (Anas bernicla) auf 78 N., der Arktische Star auf 78,6 N., der Flussuferläufer auf 75,30 N. und die Arktische Möwe auf 69 N. auf. Über die Raubmöwen schreibt er, sie seien sehr schlechte Fischer, die „die armen alten Dreizehenmöwen jagten, bis diese schließlich ihr letztes Mahl herauswürgten, das die Räuber halb verschlangen.

Eismöwen (Larus hyperboreus), von Doyle Bürgermeister, in dieser Bildunterschrift burgomaster genannt, am Beginn der Karriere. Der Vogelkundler hält die Jungen, während sein Kollege eine Fotofalle einsetzt, die ihr Wachstum und ihre Entwicklung verfolgen soll. Ученый_и_объект_его_изучения, Von Ehehey – Eigenes Werk, CC BY 4.0
Doyles Begegnung mit dem Eisbären ist merkwürdig. Er beobachtet, dass dieser sich auf dem Gipfel eines Eishügels wie ein Tanzbär auf die Hinterbeine stellt, um einen guten Blick auf uns zu erhaschen“.
Und er fängt eine „schöne Meereszitrone“, eine Meeresschnecke. Was mich daran erinnert, dass ich beim meeresbiologischen Praktikum im Felswatt vor Helgoland, das zu den von den meisten Wissenschaftler*innen durchkämmten Meeresgebieten weltweit gehört, eine dort noch nicht gesichtete Nacktschnecke entdeckte. War von ihrer Schönheit so angetan, dass ich doch glatt den Namen vergessen habe. Aber eine Zitrone war es nicht. Die hat einen ovalen Körper mit zwei Kopffühlern und zurückziehbarem Kiemenkranz. Die Farbe ist variabel, aber meist gelb, unterbrochen von unregelmäßigen braunen und roten Zeichnungen, der Kiemenkranz dagegen ist einfarbig, gelb rot, blau oder auch grau. Sie wird bis zu 12 Zentimetern lang und ernährt sich von Schwämmen, eine besondere Vorliebe hat sie dabei für den Brotkrumenschwamm. Die Meerzitrone ist gut gegen Feinde geschützt. Erstens sorgt ihre Färbung für perfekte Tarnung, zweitens drückt sie, sobald sie doch gegriffen und verschluckt wurde, ein Sekret aus der Haut, das den Feind zum Ausspeien bringt. Meine Meeresnacktschnecke war spiegelglatt und mehrfarbig.

Die Meerzitrone namens Doris odhneri. Das mit der Tarnung will nicht so recht einleuchten, ist vielleicht noch in Arbeit.
Im April erstellt Doyle seine Liste der Wale des nördlichen Polarkreises: der Nordkaper, korrekt Grönlandwal (Balaena mysticetus), bringe 10 – 20 Tonnen Öl, sein Fischbein koste 1000 Pfund pro Tonne, ein Exemplar sei 1500 – 2000 Pfund wert, er lebe weit im Norden zwischen den Eisfeldern. Ergänze, dass Balaena mysticatus zu seiner Zeit so häufig war, dass britische Walfänger ihn als Common Whale (gewöhnlicher Wal) bezeichneten, dass er bis zu 18 Meter lang und bis zu 200 Jahre alt werden kann. Doyle schreibt von einem Grönlandwal mit einer Warze von der Größe eines Bienenstocks. „Ich bin schon dreimal hinter dem Burschen her gewesen“, habe ein Kapitän erzählt, „´61 ist er uns entwischt. ´67 hatten wir ihn an der leine, aber die Harpune löste sich. 1876 rettete ihn der Nebel.“

Kultwal mit Kultkiosk
Das riesige Tier ernährt sich ausschließlich von Plankton, beispielsweise Krill und wurde damals auf Grund seiner bis zu 70 Zentimeter dicken Fettschicht, die ihn vor der arktischen Kälte schützt, und der Barten kommerziell immer wertvoller. Barten sind die vom Oberkiefer der Wale herabhängenden fein gefiederten Hornplatten, mit denen die Tiere Plankton aus dem Meerwasser seihen, filtern. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden sie unter der Bezeichnung Fischbein unter anderem als Formgeber für Korsetts verwendet. Man treffe nur selten jemanden, der um den Wert eines Grönlandwals wisse, schreibt Doyle 1879. „Ein großer mit guten Barten ist heutzutage zwischen zwei- und dreitausend Pfund wert. Dieser enorme Preis kommt aufgrund des Werts von Fischbein zustande, eine sehr seltene Ware, die dennoch für einige Branchen unverzichtbar ist. Der Preis steigt ständig, da die Zahl der Tiere abnimmt.“ Und Anfang Juni sichten sie auf seiner Fangfahrt den ersten Wal: „Wir können die nördliche Eisbarriere entlang des ganzen Horizonts sehen…. Wasser ist voller Krebstierchen und olivgrün. Balaena mystractus! Balaena mysticetus! Wenn wir alle Krebstierchen wären, dann wär´s bald aus mit uns.“
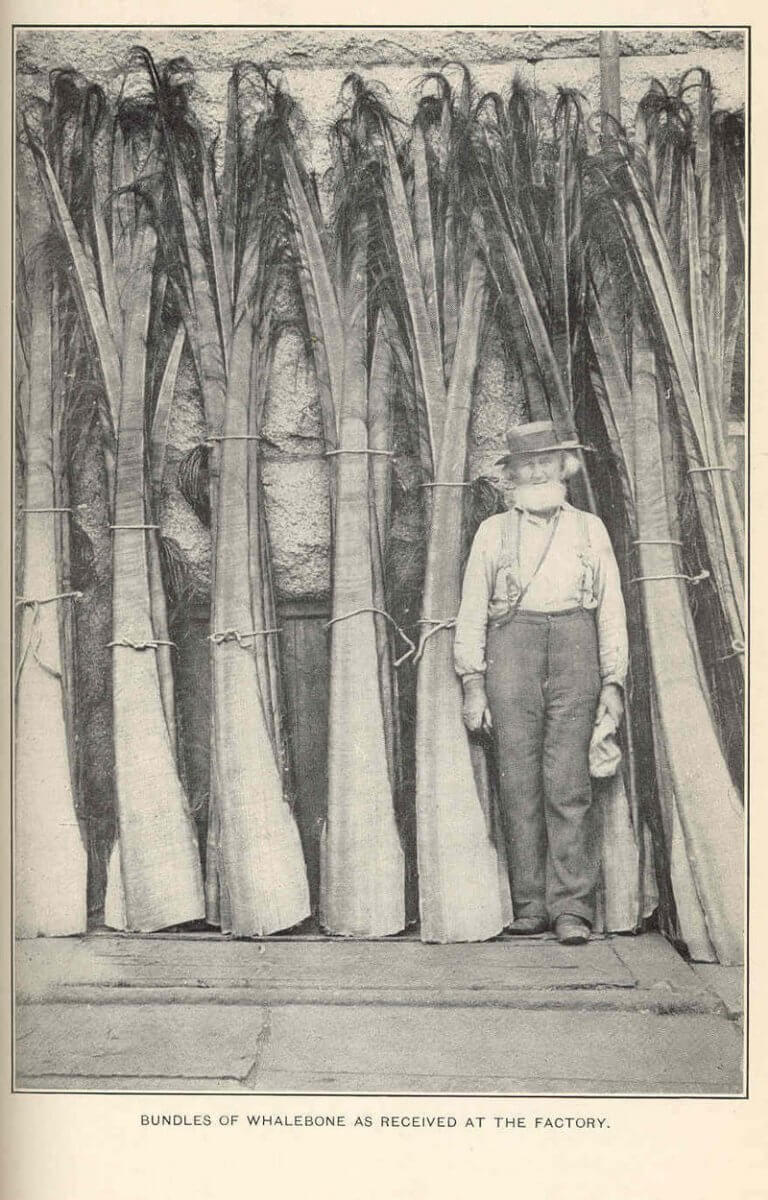
In Bündeln kommen die begehrten Barten damals in der Fabrik an.
Doyle führt auf seiner Liste als Nächstes den Finnwal (Balaena physalis) auf, den, wie er schreibt, schnellsten, stärksten, größten und wertlosesten unter den Walen, erwähnt, dass der Entenwal (Entenwale, Hyperoodon, sind eine Gattung der Schnabelwale), der südlich des Eises und rund um Grönland lebe, nur eine Tonne Öl bringe, aber eine wertvolle Haut habe, dass der Weißwal, Beluga, zu seiner Zeit überall zu finden sei, auch im Aquarium von Westminster, und dass der Schwarzwal (auch die Schwarzwale, Berardius, sind eine Gattung der Schnabelwale) eine seltene Variante sei. Bei Balaena buntscheckigum (Hultons Wal) und eisenhautum (Kapitän Grays Wal), mit denen Doyle seine Liste abschließt, steige ich aus. Nie gehört. Aber Doyle kann ja nicht nur Krimi, auch Komik rauf und runter.
Nicht erwähnen tut er an dieser Stelle den Narwal (Monodon monoceros). Ein solches Meereseinhorn, rund vier Meter lang,mit 60 Zentimeter langem Horn erlegen die Männer von der Hope später. Sein Magen sei „mit sehr großen Garnelen, die ich für „Quacksalbergarnelen“ (arktische Flohkrebse) halte, und jeder Menge von Tintenfischen gefüllt gewesen. Auch den Buckelwal (Megaptera novaeangliae) lässt er in seiner eher kommerziell geprägten Liste („Sie liefern ungefähr 3 Tonnen sehr minderwertigen Öls und sind sehr schwer zu fangen, weswegen die Jagd auf sie nicht lohnt“) unerwähnt. Diese Tiere verschaffen ihm dann einen wundervollen Anblick. „Werde dergleichen wohl nie wieder zu sehen bekommen. Das Meer wimmelte schier von großen Buckelwalen, eine ziemlich seltene Art, … und so weit das Auge reichte, sah man nichts als Walfontänen und Schwanzflossen in der Luft.“
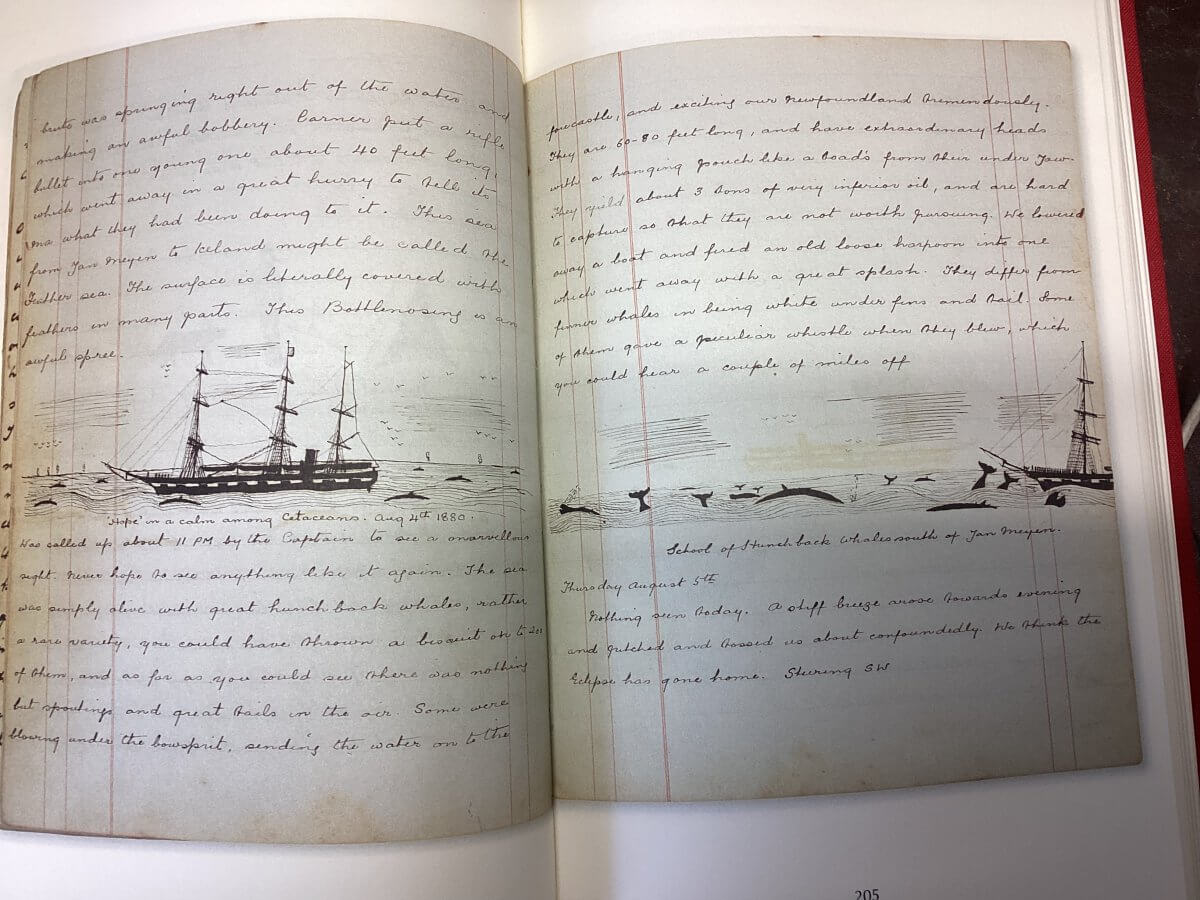
Das Meer habe schier von großen Buckelwalen gewimmelt, schreibt der junge Doyle im Tagebuch seiner arktischen Reise 1880, „und so weit das Auge reichte, sah man nichts als Walfontänen und Schwanzflossen in der Luft.“
Spitzbergen kommt bei Doyle als „ein fürchterlich aussehender Ort … geradezu das Wahrzeichen finsterer Erhabenheit“ gar nicht gut weg. Im Mai sah er „die wilde, kahle Küste Spitzbergens durch Lücken in den Sturmwolken brechen. Eine lange Reihe riesiger schwarzer lotrechter Felsen, die bis zu ein paar Tausend Fuß hoch aufragten, kohlrabenschwarz, aber von Schneeflächen gesäumt. … Wir überlegten, in die King´s Bay einzulaufen, doch die Seekarte war verlegt worden.“
Und lange nach meinen Fahrten entdecke ich auf den Seiten der norwegischen Nationalbibliothek (https://www.nb.no/historier-fra-samlingen) einen feinen Artikel der norwegischen Journalistin Live Vedeler Nilsen darüber, wie es kam, dass die entlegene Inselgruppe mit ihren eiskalten Küsten ein Teil von Norwegen wurde. Er beginnt mit einer Postkarte von 1910, die Walkocherei unter norwegischem Wimpel zeigt.
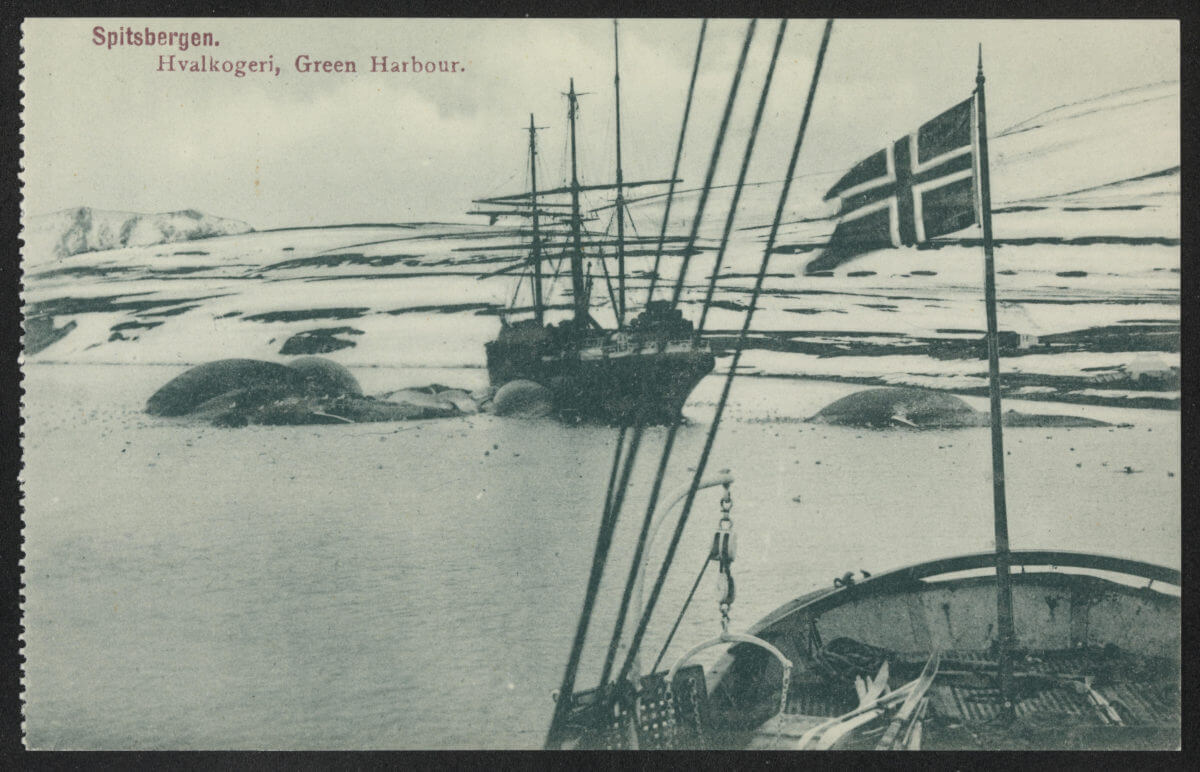
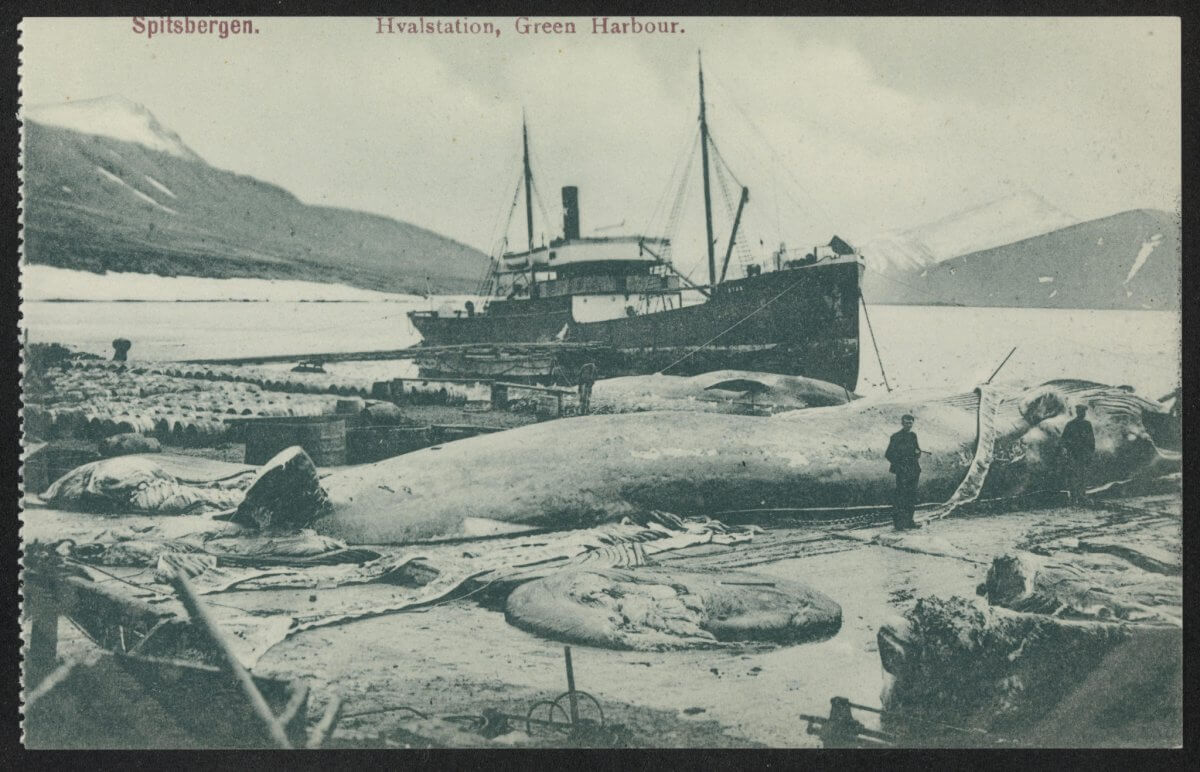
Zu sehen ist die sogenannte Walkocherei vor der Ort bei Longyearbyen/Colesbukta/Grønfjord (auch Colesbay und Green Harbour genannt). Die Norweger entwickelten damals immer effektivere Methoden für Walfang und Walölproduktion (Walkocherei), setzten statt offener Pfannen Dampfkessel ein. Zu sehen ist auf dieser Postkarte von 1910 auch die norwegische Flagge, aber die Insel im Hintergrund war weiterhin Niemandsland, Nordisk Kortforlag

Coles Bay, heute Kulturdenkmal, Av Bjoertvedt – Eget verk, CC BY-SA 3.0 no
Ab dem 19. Jahrhundert kamen norwegische Jäger und auch Trapper aus der österreichisch-ungarischen Monarchie wie Hermann Ritter, womit wir wieder bei den Feinheiten der Pirsch und der Peilung gelandet sind. In den 1920ern haben zunächst nur Fallensteller*innen und Pelztierjäger*innen Spuren menschlicher Aktivität auf Spitzbergen hinterlassen. Allen voran Hilmar Nøis und seine Familie.

Von links: Jäger und Eismeer-Skipper Daniel Nøis, die Jäger Johan Nilsen Nøis und Hilmar Nøis, vorne Polarforscher Arve Staxrud
Sie haben ihre „Überwinterungsvillen“ in Mushamna (in Ufernähe), Vårfluesjøen („Fiskebay“), Grohuken, Worsleyneset (Villa Oxford) gebaut. Mushamna oder Muyshaven ist eine Bucht am Woodfjord, als Jagdgrund bekannt seit 1662. Zuerst kamen die russischen Pomoren, dann ab dem 19. Jahrhundert die norwegischen fangstmenn, Fänger.
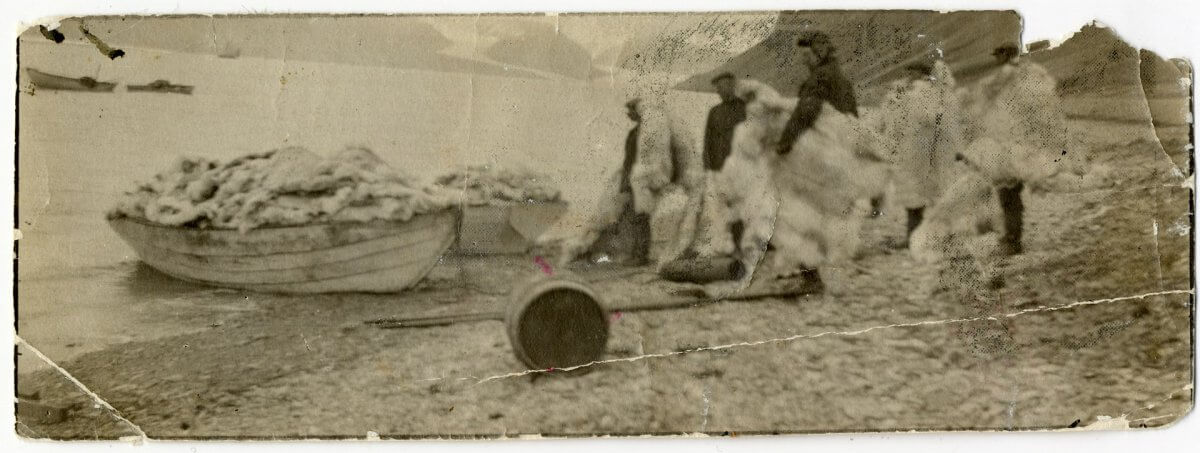
Familie Nøis lädt zu Beginn des 20. Jahrhunderts Felle von Eisbären, Svalbard-Rentieren und Polarfüchsen für den Transport zum norwegischen Festland auf Boote. Von Odd Ivar Olsen, Urenkel des Jägers Johan Nilsen Nøis – Eget verk, CC BY-SA 4.0
Wo wir schon bei den weißen Fellen sind. Die oben abgebildeten fangstmenn bedrohten das Überleben der oben genannten Arten Ursus maritimus (isbjørn), Rangifer tarandus platyrhynchus (norwegisch svalbardrein oder spitsbergenrein) und Vulpes lagopus (Polarfuchs, Schneefuchs oder Eisfuchs) in keiner Weise. Dafür kamen deutsche Adelige und norwegische Forscher. Mit ihren jeweiligen Nutzungsansprüchen.
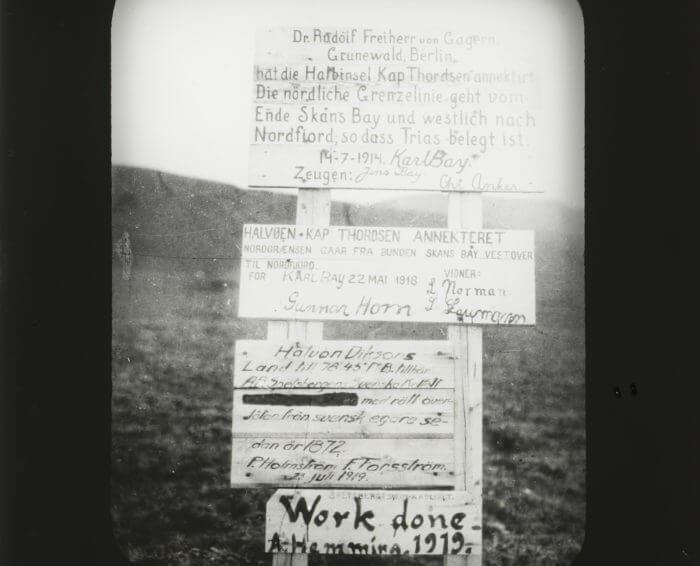
Dr. Rudolf Freiherr von Gagern aus Berlin-Grunewald annektierte 1914 die Halbinsel Kap Thordsen, einer Landzunge, die in den Isfjord ragt. Dasselbe tat der Geologe Gunnar Horn vier Jahre später. Ein Schild tiefer weist darauf hin, dass die schwedische Bergbaugesellschaft AB Spetsbergens Svenska Kolfält die Halbinsel Dickson-Land im Norden der Insel Spitzbergen beansprucht. J. L. Nerlien A/S.
Apropos Gunnar Horn. Er wurde 1894 in Norwegens Hauptstadt geboren, als sie noch Kristiania oder Christiania genannt wurde, als von dort vielleicht schon erste königliche Expeditions-, Expansions- und Okkupationsbestrebungen aufkamen.
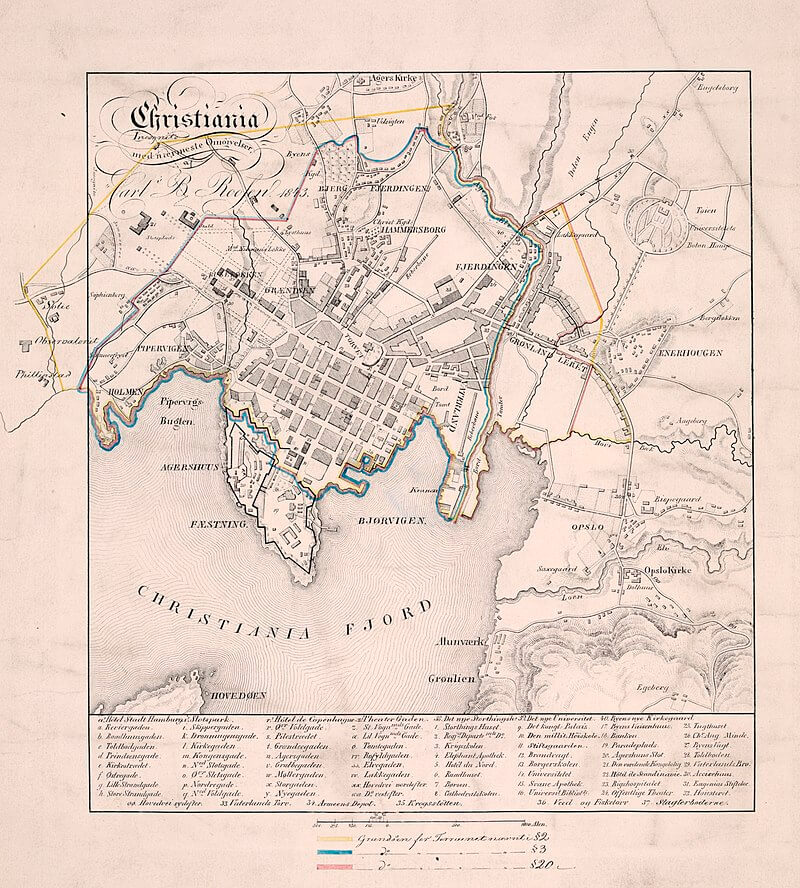
Norwegens Hauptstadt auf einer Karte von 1843
Berühmt gemacht hat den Entdeckungs- und Eroberungsreisenden, unter anderem an der TU Berlin ausgebildeten Ingenieur und Geologen Horn die Bratvaag-Expedition im Jahr 1930. Offiziell für „fangst og forskning“, Jagd und Wissenschaft, wie sie häufig kombiniert wurden/werden (siehe unten), lieh die Forschergruppe unter Horns Leitung von Harald M. Leite seinen Robbenfänger MS Bratvaag. Damals inoffiziell, wie erst zwei Jahre später öffentlich wurde, diente die Leihgabe zur Annexion von Остров Виктория; Ostrow Wiktorija, der Victoria-Insel zwischen den Archipelen Spitzbergen und Земля Франца-Иосифа, Semlja Franza-Iossifa, Franz-Josef-Land. Diese Insel im Nordpolarmeer, größtenteils lebensfeindliche Eiswüste, gehörte nämlich damals noch niemandem. Die Sowjetunion und Norwegen stritten sich seit einem Jahr drum. Am 8. August 1930 nahm Expeditionsleiter Horn die gesamte Victoria-Insel für den Eigner des Robbenfängers MS Bratvaag, und damit für die norwegische Krone, in Besitz.

Der schwedische Ingenieur und Entdeckungsreisende Knut Hjalmar Ferdinand Frænkel Frænkel und sein Landsmann, der Fotograf Nils Strindberg mit dem ersten erlegten Eisbären der später gescheiterten Expedition des Schweden Salomon August Andrée.

Fünf Crewmitglieder des norwegischen Schiffes Bratvaag posieren neben einem Schild, das besagt, das diese Insel zwischen Spitzbergen und Franz-Josef-Land dem Schiffseigner Harald M. Leite und damit dem norwegischen Königshaus gehört. Diese Landnahme wurde nie wirklich offiziell durchgesetzt. Wenig später schlugen die umliegenden Mächte die Victoria-Insel und das Franz-Josef-Land der Sowjetunion zu.
Soviel zum fangst, dem Erbeuten. Was Horns Crew später zufällig fand, schlug weit höhere Wellen. Sie stießen auf Überbleibsel der Expedition des Schweden Salomon August Andrée. Der war 1897 mit ganz großem Bahnhof aufgebrochen, um mit einem Gasballon den Nordpol zu erreichen.
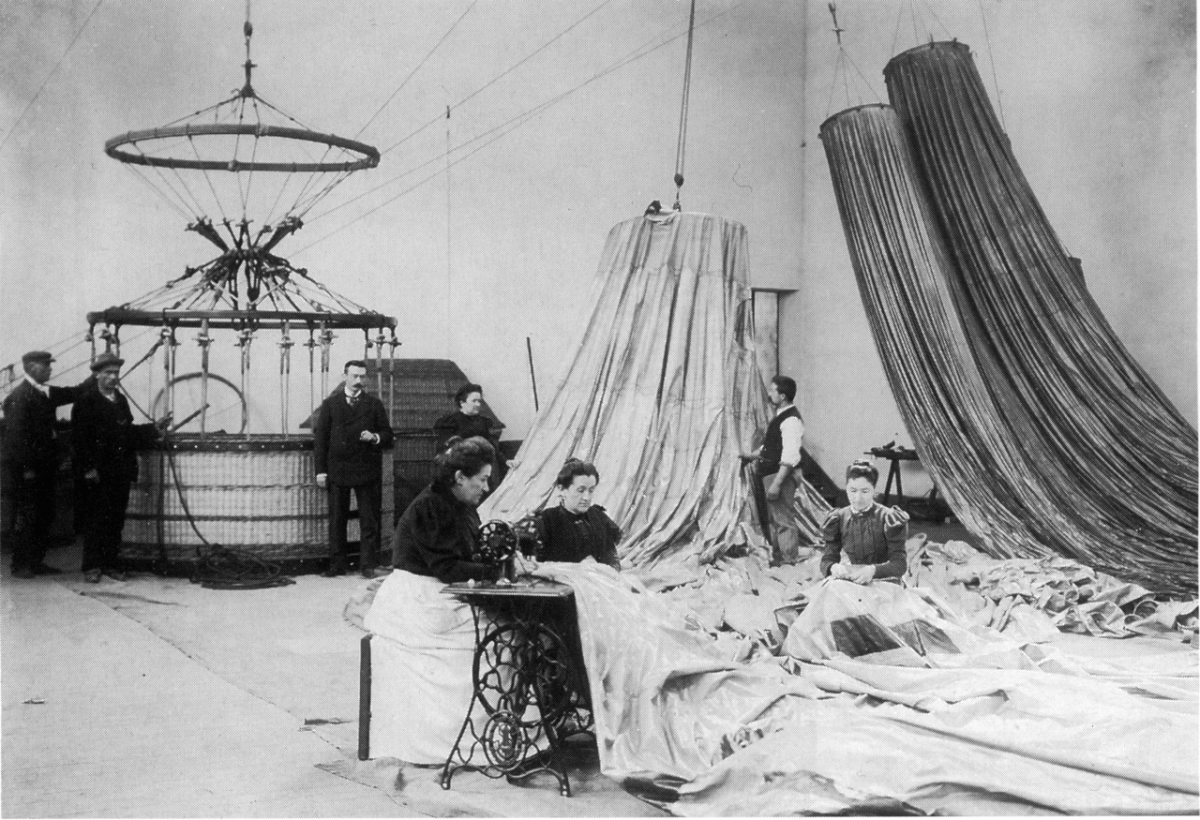
In Paris wurden die Ballons für Andrée gefertigt.
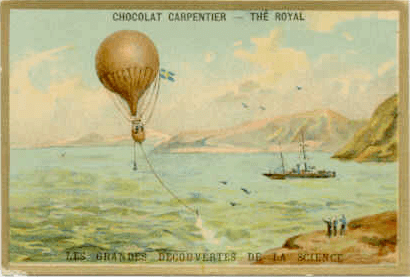
In aller Welt träumte man vom Ballonflug zum Nordpol. hier die Vision eines französischen Künstlers über die Abreise Andrées von Svalbard
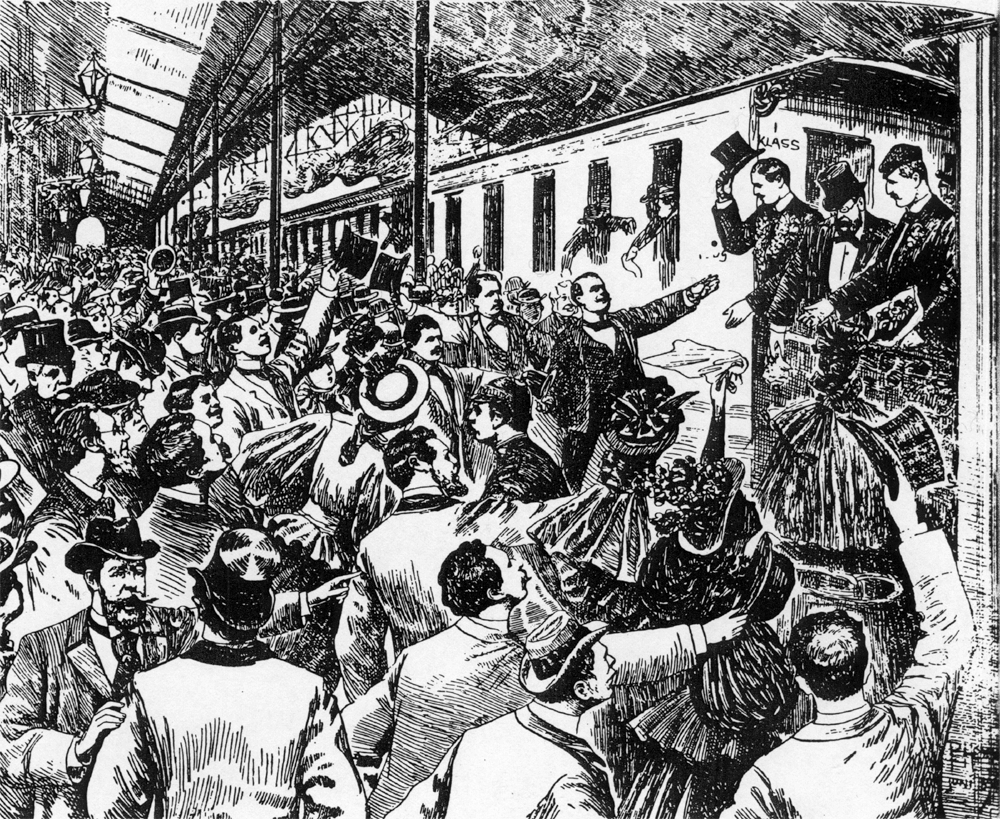
Das schwedische Aftonblatet bildete die „festliche Abfahrt der drei Auftragsreisenden“ Salomon August Andrée, Knut Hjalmar Ferdinand Frænkel und Nils Strindberg im Frühjahr 1896 ab.
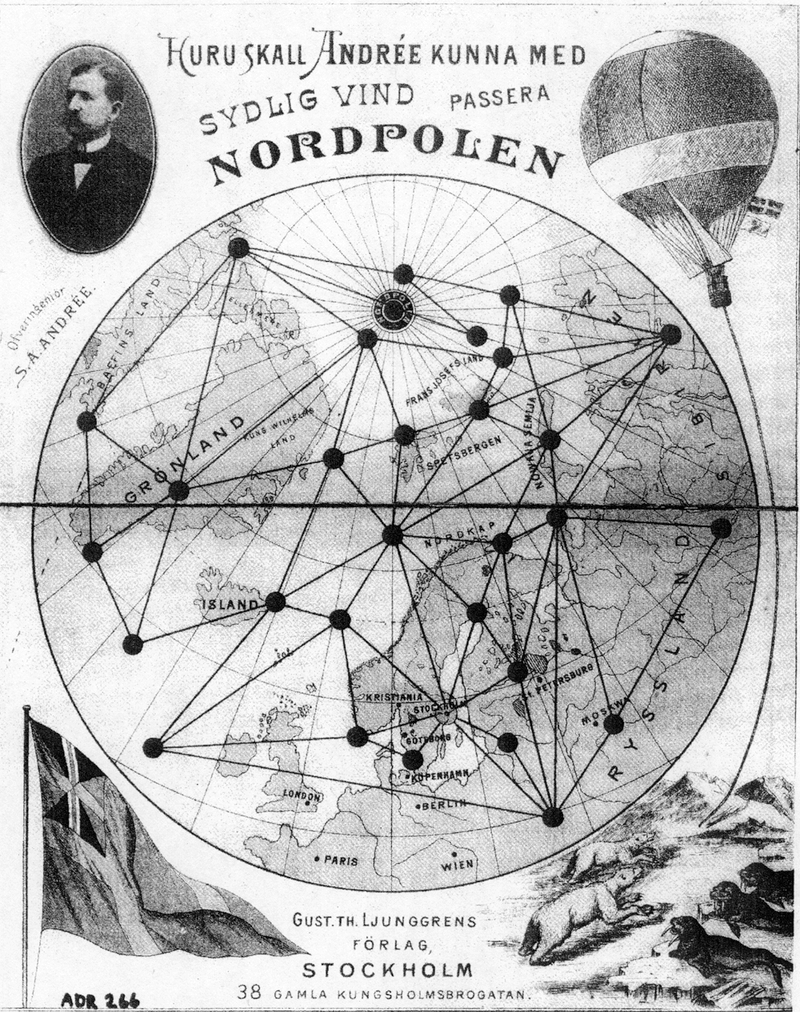
Man spielte diesbezügliche Brettspiele, mit Eisbären, die den Leinen des Ballons nachjagen
So begann die Vorgeschichte der archäologischen Entdeckung des Geologen Horn. Die Teilnehmer von Andrées Polarexpedition stürzten ab, landeten unfreiwillig auf dem Packeis und kamen nach zur östlichsten Insel des Spitzbergen-Archipels, Kvitøya (schwedisch Vitö, deutsch Weiße Insel), wo sie nach wenigen Tagen oder Wochen starben. Erst 1930, im Zuge der norwegischen Bratvaag-Expedition wurde ihr Lager dort entdeckt. Horn und seine Crew fanden auf Kvitøya auch Fotos:
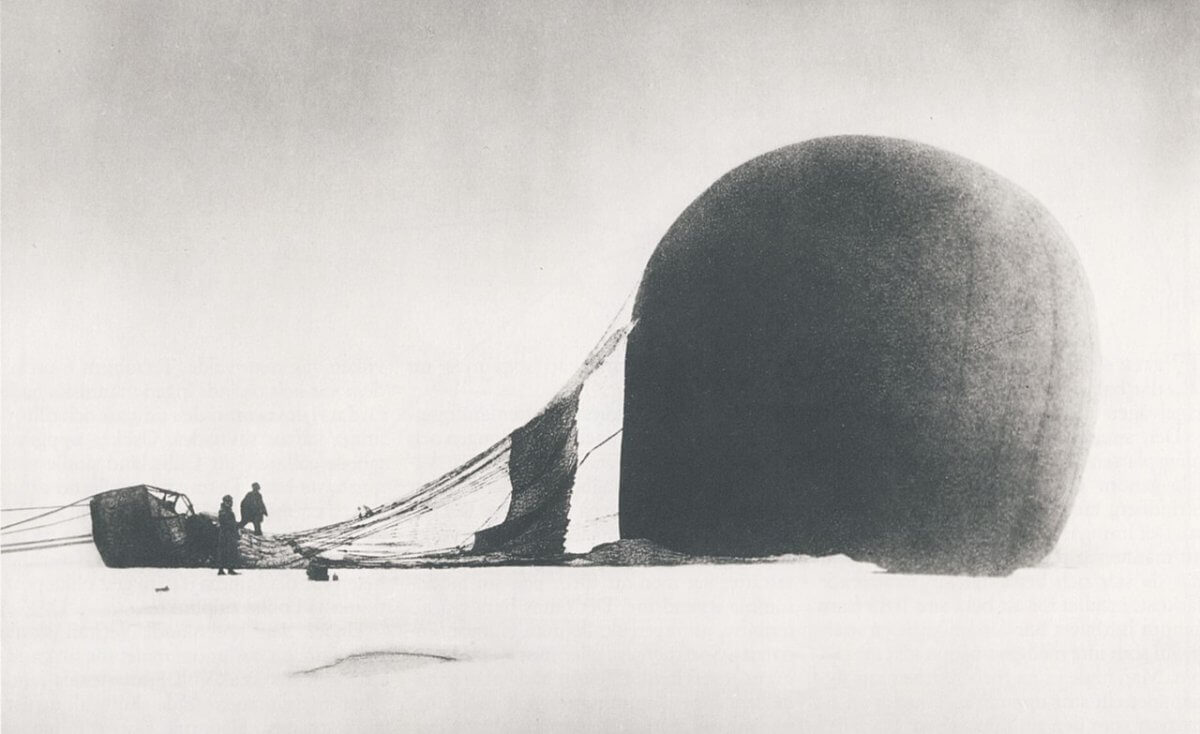
Andrée und Frænkel mit dem abgestürzten Ballon auf dem Packeis, Nils Strindberg
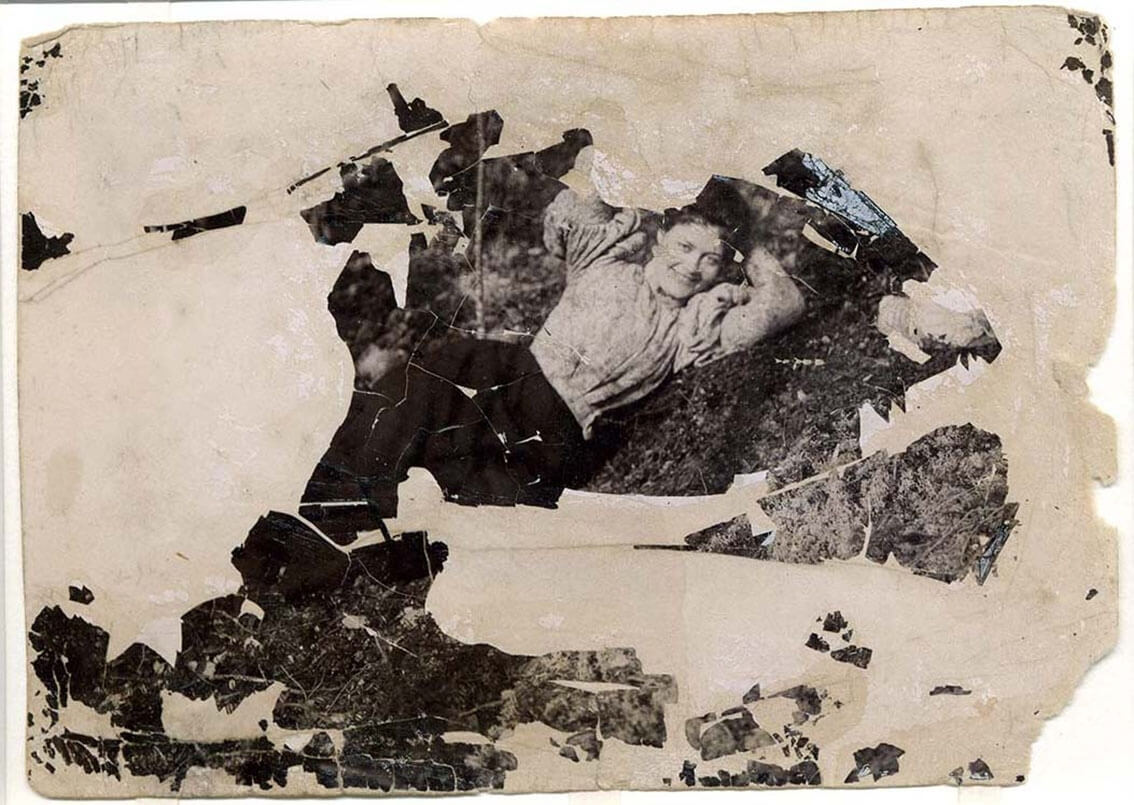
Das auf Kvitøya gefundene Foto zeigt Anna Charlier, die Verlobte des Fotografen Nils Strindberg, Nils Strindberg/Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter
Auch um die Inselgruppe Spitzbergen wurde wild gerungen. Die Bolschewiken protestierten dagegen, dass sie norwegisch werden sollte. Das und den unten abgebildeten Zeitungsausschnitt entnehme ich den Seiten der norwegischen Nationalbibliothek (https://www.nb.no/historier-fra-samlingen), dem Artikel der norwegischen Journalistin Live Vedeler Nilsen.
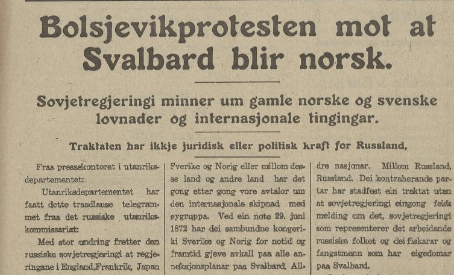
Bolschewiken protestieren dagegen, dass Svalbard norwegisch werden sollte.
Einberufen wird eine Konferenz, denn neben den Russen, die sich auf alte Traditionen der Pomoren, der russischen Jäger auf Spitzbergen, berufen konnten, und den vor allem am Bergbau interessierten Schweden meldete Norwegen Besitzansprüche an.

Spitzbergenkonferenz 1910, Narve Skarpmoen.
Auf Spitzbergen kommt es derweil laut Vedeler Nilsen zum „kulturkræsj“, Kultur-Crash. Aufeinander schlugen in den Bergwerken deren kapitalistische Betreiber unter anderem aus Nordamerika und England und Mitglieder der gerade erstarkenden skandinavischen Arbeiterbewegung.

Auf Spitzbergens zunächst von Schweden, dann auch von Russen okkupierten Niemandsland namens Dickson-Land entstanden im 20. Jahrhundert schwedische und russische Kohlengruben und die Siedlung Pyramiden (Пирамида), der Ort unter dem gleichnamigen oben abgebildeten Berg. Das alles wurde 1988 stillgelegt. Von Zitronenpresse – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Suchbild: die Reste der bis 1946 bestehenden Grubenanlage Ragnarhytta, sind ein Kulturdenkmal. Av Bjoertvedt – Eget verk
Schiffsreisende Ritter macht sich im Sommer 1934 große Sorgen: „Gepäckmeister, wird das Schiff die Kingsbai anlaufen?“ Und dann erkennt sie imNebel auf der Holzbrücke ihren großen und hageren Mann. Er zeigt ihr die kühle Küste (Svalbard, der norwegische Name des Gesamtarchipels, das auf Deutsch Spitzbergen heißt wie seine Hauptinsel, bedeutet „kühle Küste“). Sie findet diese Landmasse im Nordpolarmeer und auch die Informationen über die verkrachte norwegische Kohlemine (die Kings Bay Kull Compani aus Ålesund stellte den Bergbau in Ny-Ålesund 1929 ein) und die verunglückte Nobile-Expedition (das Luftschiff Italia des italienischen Konstrukteurs Umberto Nobile ging 1928 im Eismeer verloren, nur die riesige Flugzeughalle blieb übrig) „beim besten Willen weder schön noch fesselnd“.
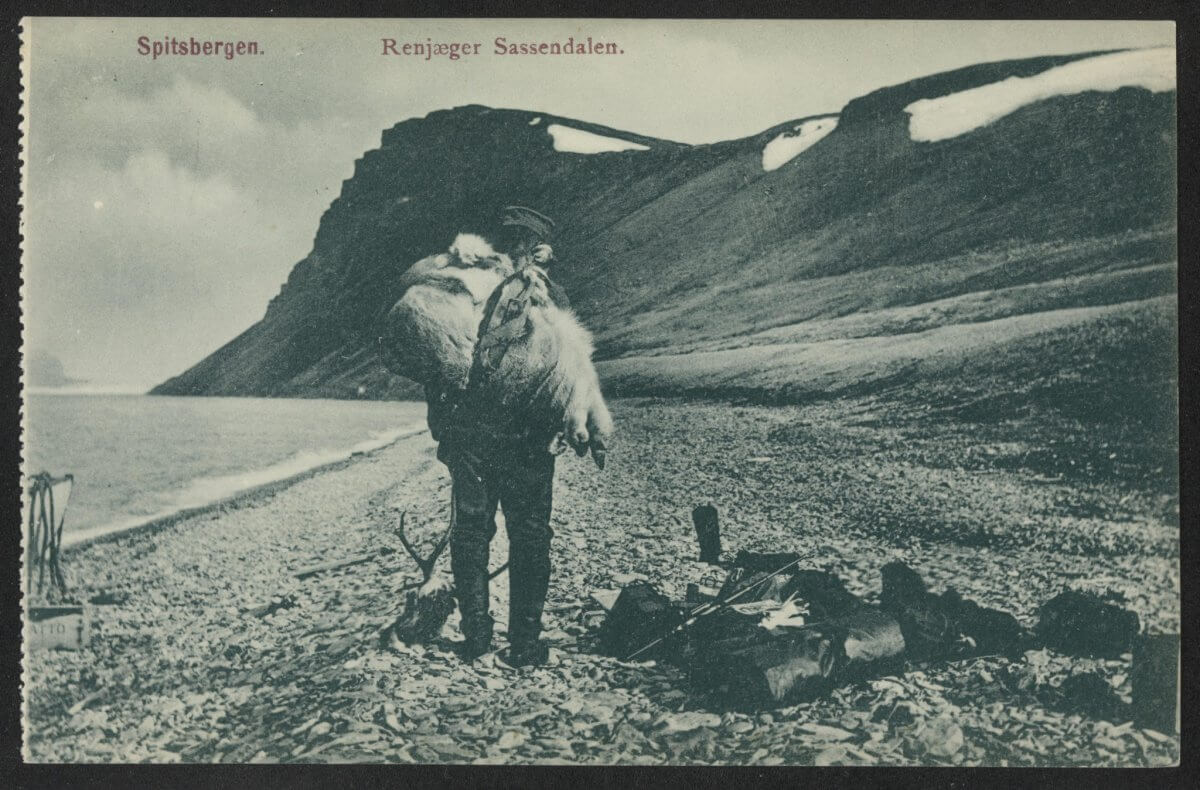
Rentierjäger in Sassendalen. Die Gegend mitten auf der Insel Spitzbergen, heute Sassen-Bünsow-Land-Nationalpark, zeichnet sich durch Gletscher und glazial geprägte Täler aus.
Ein befreundeter Jäger, typischer „Arktiker“, versteckt sich bei der Ankunft des Ehepaares vor der „europäischen Invasion“ – wobei die nach ἄρκτος árktos (griechisch für Bär) benannte Region um den Nordpol zwar bei den meisten Menschen starke Gefühle auslöst, aber geografisch betrachtet nur ein gefühlter Kontinent ist. Die Passagiere verschwinden schnell wieder im geheizten und beleuchteten Salon ihres kleinen Kreuzfahrtschiffes. Für die Ritters geht es mangels jeder Art ausgebauter Wege oder gar Straßen per Dampfer weiter, auf dem die reisende Künstlerin „in einer wunderbar freimütigen Art von Kameradschaftlichkeit“ in die große und verstreute Crew der Seeleute und Überwinterer aufgenommen wird. Gegendert wird nicht, wir haben 1934, aber man und frau bleibt fair.

Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus)
„Gefleckte graue Möwen fliegen ganz niedrig mit dem Schiff. Es sind ganz andere Möwen als die, die ich bis jetzt gesehen habe. Sie fliegen mit knappen, derben Flügelschlägen. Ihre stumpfen, verbissenen Gesichter sehen nach Kampf und Zähigkeit aus.“ Auf der Insel Spitsbergen brüten die Schmarotzer- (Stercorarius parasiticus) und die Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus). Angehörige von Stercorarius, der Gattung der Raubmöwen, sind von möwenartiger Gestalt und mit den Möwen verwandt, allerdings deutlich schneller. Mit kräftigen, gekrümmten Schnäbeln und scharfen Krallen jagen sie anderen Seevögeln die Beute ab.

Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius parasiticus (auf Norwegisch kurz der/die Diebische (tyvjo) genannt, am Rystraumen (nordsamisch Rávdnji, norwegisch auch Storstraumen), einem Sund – einer engen Meeresstraße – südöstlich der Stadt Tromsø, Von Arnstein Rønning – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Ausgesprochene Seevögel sind die Raubmöwen nur außerhalb der Brutzeit. Da kommen sie auch mal in der Stadt vorbei. Der oben abgebildete Charakterkopf wurde nicht weit von Tromsø gesichtet, am Rystraumen, einem Sund zwischen der großen Kvaløya (Walinsel) und der kleinen Ryøya. Auf dem Bild unten ist ein Boot der Küstenwache auf diesem Straumen/Strom zu erkennen, der eine Gezeitenströmung von bis zu sechs Knoten (knapp 12 km/h) entwickelt. Und weil es so wunderschön ist, lasse ich noch ein Bild von Bjoertvedt einfließen, in Sachen Ortszeiten und Gezeiten. Und ein Bild von Bjoertvedt, das in auf Fototour auf Spitzbergen zeigt. Auch wenn ich seinen Vornamen noch nicht herausgefunden habe…

Zwischen der kleinen Insel Ryøya und der Landmasse der Kvaløya (samisch Sállir, Walinsel) ist auf der nördlichen, der größeren Abzweigung (stor heißt groß, daher Storstraumen, wird auch auf Nordsamisch Rávdnji und auf Norwegisch Rystraumen genannt) des Straumsfjordes ein Schiff der Küstenwache zu sehen. Av Bjoertvedt – Eget verk, CC BY-SA 3.0

Blick von Osten auf den Straumsfjord; links das norwegische Festland, rechts die Insel Kvaløy, in der Sundmitte die Insel Ryøy, Von Bjoertvedt – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Erlend Bjørtvedt ist ein norwegischer Amateurfotograf, er lebt in Oslo und fotografiert vor allem im hohen Norden. Dieses Foto zeigt ihn auf dem Spitzbergen-Archipel, auf dem Weg von Longyearbyen nach Todalen, auf dem Nordenskiöld–Land.
Ihre Nester bauen die Raubmöwen auf der тундра – Tundra ist ein Lehnwort aus dem Russischen und bezeichnet Kältesteppen, offene, baumfreie Landschaften, die mit Flechten, Moosen, Gräsern und sommergrünen Zwergsträuchern bewachsen sind. Forscher*innen haben im Auftrag der Royal Society for the Protection of Birds und der britischen Umweltbehörde die Zukunft dieser Brutgebiete untersucht und herausgefunden, dass sie aufgrund der vom Menschen ausgelösten Klimakatastrophen bis zum Ende unseres Jahrhunderts erheblich und unwiederbringlich schrumpfen werden und dann weite Teile ihres heutigen Brutareals keine geeigneten Lebensräume mehr bieten. How do we dare? Bei globalen Themen kreischt mich meine innere Stimme oft auf Britisch an. Und den Brit*innen fühle ich mich unter anderem wegen ihres Einsatzes für all die Tiere mit Schnäbeln, Federn und Flügeln – egal ob „charming“ oder „amusing“ oder „robbing“ – enorm zugetan. Da gibt es keinen Bruch (Brexit). Für Birdwatcher und ihre Lustobjekte gibt´s eh keine Grenzen.

Fjälltundra. Das oder der Fjäll (schwedisch), Fjell (norwegisch) – der Name stammt aus der altnordischen Sprache, wurde als fell nach Eng- und Schottland exportiert (wahrscheinlich von Wikingern), wo er baumlose Höhen bezeichnet, und gelangte auch in die baumlosen Gebirge von Neuseeland. Das Fjäll auf dem Bild liegt in Nordschweden. Wissenschaftler*innen sprechen hier von der alpinen Vegetationshöhenstufe fennoskandinavischer Gebirge. Es ist eine Fjälltundra. Tundra – russisch тундра – hatten wir schon. Dieser Name stammt aus dem Kildinsamischen, wo Tūndar eine baumlose Hochfläche bezeichnet. Für solche Offenlandgebiete der polaren und subpolaren Klimazone sind Permafrostböden typisch, auf denen entweder Flechten, Moose und Gräser oder sommergrüne Ziersträucher gedeihen, wie auf der Fjälltundra auf dem Bild oben, sie ist eine Zwergstrauchtundra. Das nehmen wir Ökologiefans wie auch der/die unbekannte Fotograf*in Ökologix – alias Fährtenleser – alles sehr genau – zum Wohle aller Wesen. Von Ökologix – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
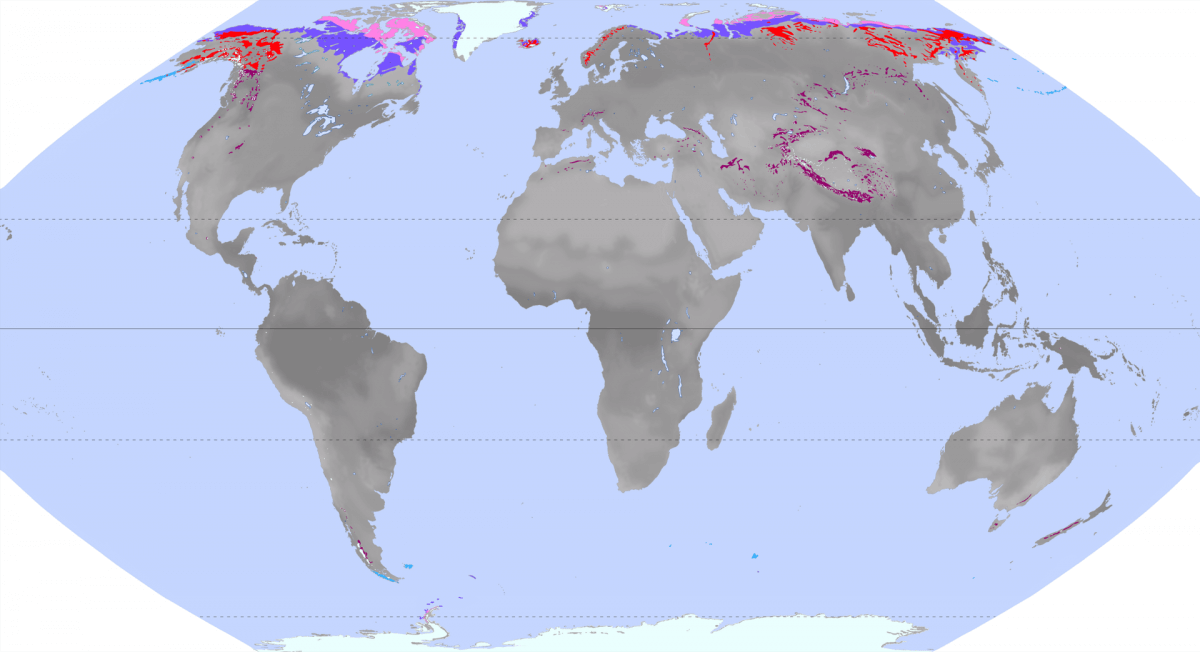
Tundra: Von Norden: Flechten- u. Moostundra, Zwergstrauch- u. Wiesentundra, Subpolare Bergtundra, Bergtundren der gemäßigten Breiten sowie alpine Matten u. Heiden, Subpolare Wiesen, Heiden und Moore, Von Ökologix – Eigenes Werk, CC BY 3.0
Ritter könnte vom norwegischen Dampfer auf Nordkurs auch Eismöwen gesehen haben. Larus hyperboreus ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 160 Zentimetern ein ziemlich großer Vogel, schon die Küken wirken riesig, wie auf dem Foto der Vogelforschern, die auf der Insel Колгуев (Kolgujew, gehört zum Autonomen Kreis der Nenzen und liegt weit nörlich des sibirischen Tieflandes in der Barentssee) Wandervögel mit Sendern ausstatten. Oder ihr Dampfer wird von Dreizehenmöwen umschwirrt? Rissa tridactyla brütet ebenfalls auf der Insel, die sie gerade umrunden. Und zwar an ihren Felsen und Klippen, meist in großer Höhe auf kleinen Simsen und Vorsprüngen. Als ich auf das Bild des Dreizehenmöweneiersammlers stoße, erinnere ich mich daran, dass mein Vater von der Insel Helgoland Möweneier mitzubringen pflegte – neben Hummer… – die ganz vortrefflich schmeckten. Aber das ist verdammt lange her. Und mittlerweile aus gutem Grund verboten. Wenn es Raubmöwen waren, müsstet ihr weiter hinten nachlesen. Die sind noch nicht dran.
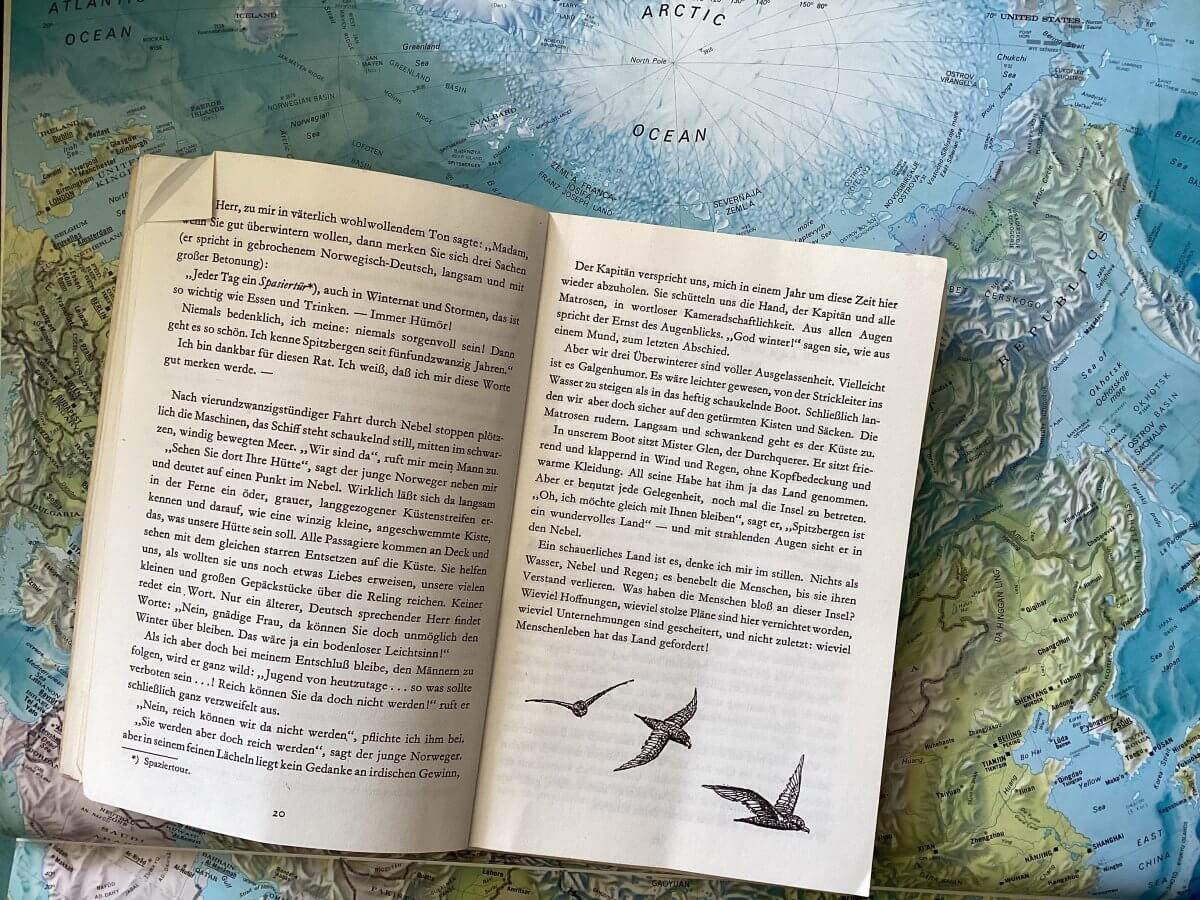
Ritter schreibt von derben und zähen Vögeln. So sieht die Elfenbeinmöwe (Pagophila eburnea), ebenfalls Brutvogel auf der Insel Spitsbergen nicht gerade aus. Eher licht und leicht. Sie ist die einzige Überlebende der Vogelgattung Pagophila. Das griechische Wort pagos bedeutet Meereis, und philos heißt: liebend. Diese Vorliebe, die Pagophilie ist auch unter anderen Tierarten verbreitet, zum Beispiel bei Ursus maritimus, dem Eisbären. Die sonstigen Vorlieben der elfenbeinfarbigen Eismeerliebhaberin: sie legt ihre Nester auf Kies- und Geröllstränden direkt an der Küste an und führt eine monogame Saisonehe.

Elfenbeinmöwe (Pagophila eburnea), Spitzbergen, Norway, Von Samuel Etienne – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Seltener sind auf und um Svalbard samt Spitsbergen herum die Schwalbenmöwe (Xema sabini) und die Rosenmöwe (Rhodostethia rosea). Letztere hat im Prachtkleid eine rosafarbene Brust, Erstere ist am gegabelten Schwanz zu erkennen. Beide benötigen die arktischen Brutgebiete.
Ritters Skizze hat Raubmöwen gesichtet auf ihrer vierundzwanzigstündigen Dampferfahrt mit dem Ziel Grohuk. Das norwegische Wort Gråhuken bedeutet graue Landspitze. Und hier, auf dem nördlichsten Punkt der langgestreckten Halbinsel zwischen Wood- und Widefjord befindet sich die Haupthütte der drei Überwinterer – ein norwegischer Jäger hat sich mittlerweile zu ihnen gesellt.
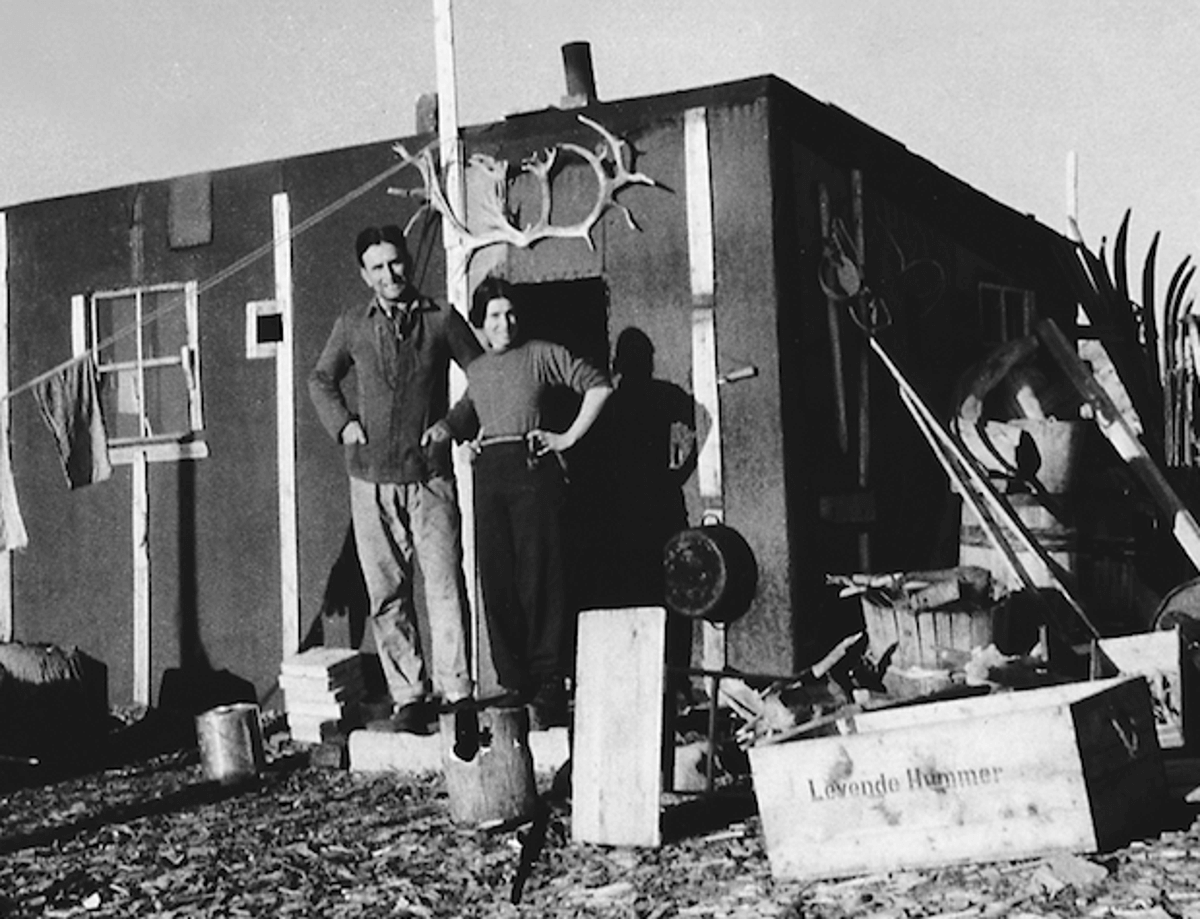
Dieses Bild verdanke ich Lucy Jones, der Kunstkolumnistin des THE INDEPENDENT, einer britischen Internetzeitung, und bin total einig mit ihr, dass „this forgotten feminist nature writer deserves to be celebrated“, diese vergessene Naturewriterin unbedingt gefeiert werden muss. Es zeigt Christiane Ritter und ihren Ehemann Hermann vor der Hütte in Grohuk im Sommer. Und es zeigt, dass sie es sich auch gut gingen ließen – oder war die Holzkiste mit der Aufschrift „Levende Hummer“ nur ein Transportmittel? Bjørn Klauer/Huskyfarm/Karin Ritter
Die Insel Spitsbergen ist zur Hälfte von Gletschern bedeckt. Insofern ist Grohuk (Gråhuken) auf dem Landwege nur über Altschnee zu erreichen. Hier im Inselinneren von West-Spitzbergen wird durch Auftauen und Gefrieren regelmäßig aus dem Schnee der vergangenen Jahre Firn, das Wort stammt vom althochdeutschen Wort firni fürvorjährig. Aus neu mach alt, so wird aus acht Metern Neuschnee ein Meter Altschnee, ein Firnfeld wie auf dem Holtedahl-Plateau. Benannt ist es nach dem geologischen Pionier Olaf Holtedahl, geboren 1885 in Christiania (heute Oslo), der hat diese Firnfelder, die sich zwischen Kings-Bay (Kongsfjorden) und Wood-Bay (Woodfjorden) im nordwestlichen Teil der Insel West-Spitzbergen erstrecken, 1911 bei einer Expedition überquert.
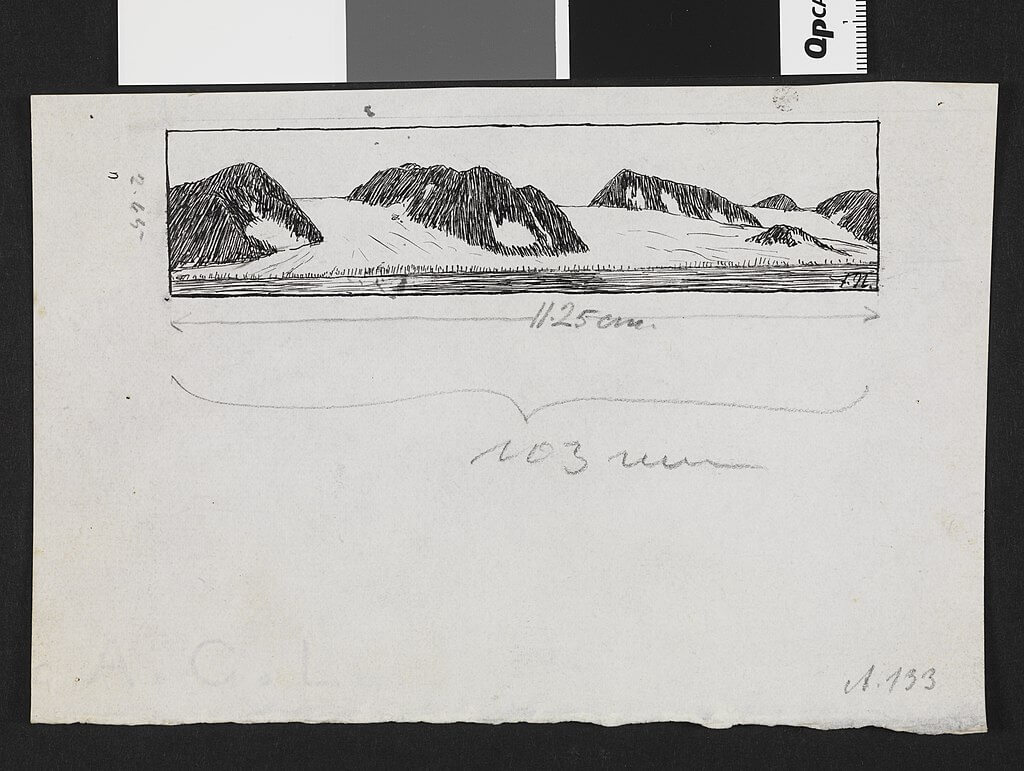
Fridtjof Nansen kam 1896 im Zuge der Fram-Expedition auch an der Insel Spitsbergen (für Norweger*innen nur eine der Inseln von Svalbard) vorbei und zeichnete mit Bleistift und Feder die Gletscher am Krossfjord, stellte sich vor, wie die Gletscher sich ihren Weg über die Berge gebahnt haben.
Als die Überwinterer im Sommer 1934 ihre Landspitze erreichen, werden sie samt vieler Säcke und Kisten ausgebootet, begeleitet von Anmerkungen. Ein deutschsprachiger Passagier betont: „Reich können Sie da nicht werden!“ Der junge Norweger, in dessen Lächeln, wie Ritter schreibt, kein Gedanke an irdischen Gewinn liegt, sagt: „Sie werden sehr reich werden“. Was für ein Reichtum! Im Westen der Woodfjord: Im Frühjahr explodiert dort unterm schmelzenden Meereis das marine Leben. Die Eisalgen sind die ersten.

Die Mikrobiologin Stefanie Lutz nimmt auf einem Gletscher auf Spitzbergen eine Probe mit Eisalgen. FOTO VON GFZ, LIANE G. BENNING
Wir vertrauen uns da mal einer Expertin an, der Mikrobiologin Stefanie Lutz vom Deutschen GeoForschungszentrum, sie forscht auch auf Svalbard und erklärt: „Das sind Mikroorganismen, die auf Gletschern vorkommen, also auf Schnee und Eis. Ihre aktive Wachstumsperiode haben sie im Frühjahr und Sommer, wenn Schnee und Eis schmelzen – denn die Algen benötigen flüssiges Wasser, um zu überleben und zu wachsen. Wenn im Sommer die Sonne viel scheint, produzieren die Algen Pigmente als Schutzmechanismus. Bei den Schneealgen ist es ein rotes, bei den Eisalgen ein braunes Pigment. Es wirkt wie Sonnencreme, schützt die Algen also vor Sonneneinstrahlung.“ Im Fjord vermehren sich also im Frühjahr Algen, deren brauner Farbstoff sie vor der gleißenden Sonne schützt. Und die schreibende Biologin kann das Nachforschen nicht lassen. So lernt sie nun, dass Algen, die im und unter dem Meereis leben, eine viel größere Rolle für das arktische Nahrungsnetz spielen, als bislang angenommen. Biolog*innen des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, haben gerade erstmals nachgewiesen, dass sich nicht nur direkt unter dem Eis lebende Tiere von den sogenannten Eisalgen ernähren. Auch Arten, die vorwiegend in größeren Wassertiefen vorkommen, beziehen demnach einen Großteil ihres Energiebedarfs ursprünglich aus diesen Algen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, erläutern Erstautorin Doreen Kohlbach und ihre Kolleg*innen, deren Ergebnisse online im Fachjournal Limnology & Oceanography erschienen sind, dass der Rückgang des arktischen Meereises weitreichende Folgen für das gesamte Nahrungsnetz des Arktischen Ozeans haben kann.
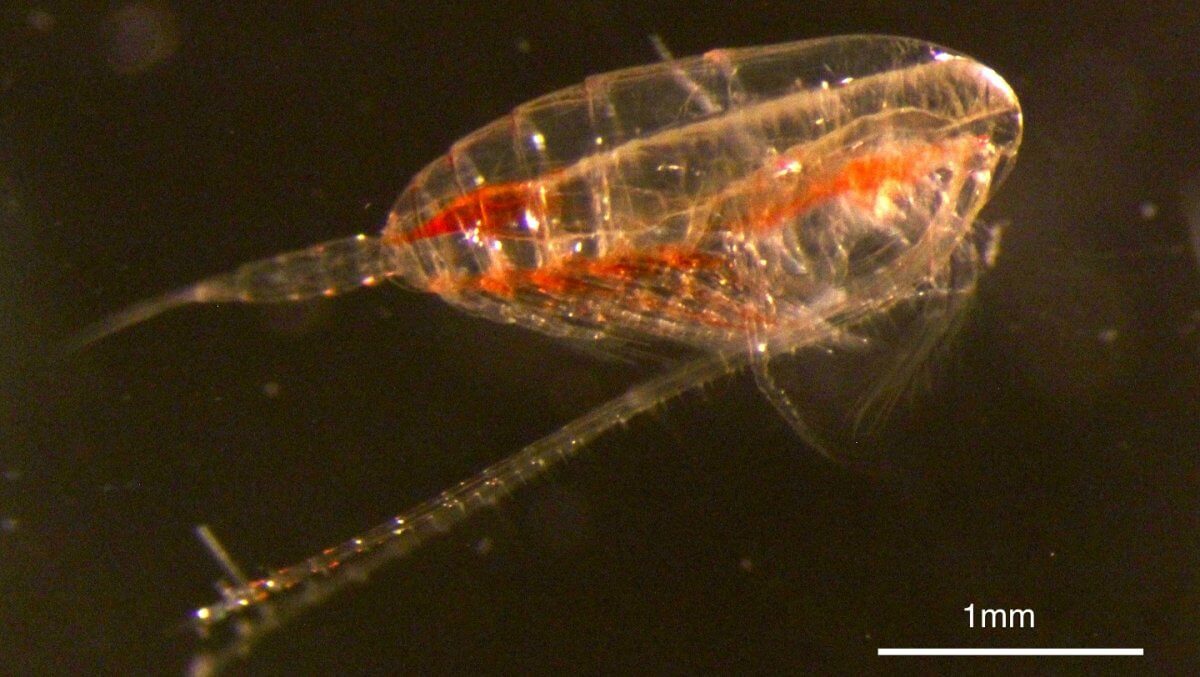
Calanus finmarchicus, Lukas Hüppe
Wer futtert im Woodfjord und anderswo solche Eisalgen? Ruderfußkrebse, Flohkrebse und Flügelschnecken. Sie gehören zum Zooplankton, tierischen Meeresbewohnern, die sich nicht wie beispielsweise Fische aktiv gegen die Strömung bewegen können, sondern treiben. Das griechische Wort πλαγκτόν bedeutet das Umherirrende, Umhergetriebene und bezeichnet Organismen, die im freien Wasser schweben, wie die Ruderfußkrebse (Copepoden). Mir wird bei all diesen schwebenden Schönheiten ganz warm ums Herz, habe ich doch als wissenschaftliche Hilfskraft nach den Meeresforschungsfahrten wochenlang Wasserproben mikroskopiert. Da wäre zum schönen Beispiel die zauberhafte Gattung Calanus. Ihre nördlichen Vertreter tragen die Region im Artnamen. Calanus finmarchicus und treibt sich auch vor der kühlen, steinigen Küste herum, wo wir ja gerade geistig an Land gegangen sind, im Nordpolarmeer nordwestlich der Inselgruppe Svalbard, außerdem in der Nordsee und im-Nordmeer vor den Küsten von Finnmárku, wie die Landschaft in der Sprache ihres Urvolks, auf Nordsamisch, heißt (die deutsche Übersetzung ergibt: Feld der Samen). In der Sprache der dort ab dem 18. Jahrhundert eingewanderten Finnen, der kvääni (Kvenen), heißt sie Finmarku. Und die Russen waren auch nie weit weg – beispielsweise bis 1917 in Gestalt des Russischen Großfürstentums Finnland – sie schreiben Финнмарк. Für die Norweger*innen ist es eine Ex-Provinz, die 2024 wieder eigenständig werden soll.
Untergehende Untereiswälder oder Blauleuchtendes Weißmeer
Aber wir sind ja gerade bei der Ökologie und nicht bei der Politik. Für Ruderfußkrebs Calanus finnmarchicus ist es ein Artname. Er lebt in oben genannten Meeren bis zu 4000 Meter Tiefe, wird maximal 0,02 Zentimeter lang (ist also nur mit dem Mikroskop zu „entziffern“) und gehört damit zum Mikro-Zooplankton. Und da ist jetzt Schluss mit winzig. Die Menge machts. Und für die Riesen der Meere, dazu gehören hier allen voran die weiblichen Nordkaper (Eubalaena glacialis), seien diese Krebse unverzichtbares Kraftfutter, reich an Eiweiß und wertvollen Omega-3-Fettsäuren ist und darüber hinaus an Antioxidantien (Radikalfänger). So steht es im von Aquarianern erstellten meerwasser-lexikon.de . „Diesem Ruderfußkrebs kommt eine extreme Bedeutung innerhalb der marinen Nahrungskette zu, er dient Fischlarven, Korallen, Heringen, Makrelen, Kabeljau, Schellfischen, Garnelen, Wasservögeln.“ Calanus finmarchicus sei ein unverzichtbarer aber auch empfindlicher Bestandteil der Nahrungskette, „ohne Copepoden kann es keine adulten Fische geben und damit würde auch dem Menschen am Ende der Nahrungskette ein extremer Ernährungsnachteil entstehen.“ Adulte Fische sind ausgewachsene Tiere und der extreme Ernährungsnachteil bedeutet schlicht und schrecklich: kein Fisch auf dem Tisch, zumindest kein Hering, keine Makrelen, kein Kabeljau, keine Schellfische. Resümee der Aquarien- und Meerestierfachleute: der Mensch stelle auch hier die größte Gefahr dar.

Zooplankton-Forscherinnen Jennifer Questel und Caitlin Smoot von den Universitäten von Connecticut und Alaska Fairbanks bei der Arbeit
Und wir nehmen uns jetzt als aufmerksame und achtsame Vertreter*innen dieser räuberischen Art den kälteerprobten Gattungsgenossen Calanus glacialis vor: Da machen wir es wie die beiden Zooplankton-Expertinnen Jennifer Questel und Caitlin Smoot, packen ihn auf Grund großer Ähnlichkeiten mit Calanus hyperboreus zusammen und stellen die Frage, wie diese Tierchen unterm Packeis die Polarnacht mit ihrem Nahrungsmangel – auf Grund von fehlendem Licht fehlt auch das pflanzliche Plankton, die winzigen Meeresalgen, von den die Ruderfußkrebse leben – überstehen. Das Mikroskopbild der Wissenschaftlerinnen von den Universitäten von Conneticut und Fairbanks/Alaska zeigt es, sie lagern Fett (lipids) als Energiereserve ein. Und sie können noch mehr, die arktischen Copepoden; Metridia longa zum Beispiel sorgt für blaues Leuchten am Weißen Meer (russisch Бе́лое мо́ре, karelisch und finnisch Vienanmeri, nenzisch Serako yam). Wie eine Art Weihnachtsbeleuchtung erschien es der russischen Mikrobiologin im Dezember 2021 beim Spaziergang an der Küste. Mit dem Stoff Luciferin, der blaues Licht freisetzt (Biolumineszenz) schreckt dieser Ruderfußkrebs, der auch in norwegischen Gewässern bis auf 5000 Meter Tiefe abtaucht, manchen Fraßfeind ab.
Und 2023 schlägt eine Wissenschaftlerin Alarm. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, hat in diesem Sommer die Expedition des Forschungsschiffes Polarstern von der Eiskante bis zum Nordpol geleitet und warnt vor allem vor den durch die zunehmende Erwärmung verursachten Unberechenbarkeiten: „Wir merken, dass das Meereis des arktischen Ozeans immer mehr zum Spielball von Wind und Wetter wird. Und das ist eine Warnung. Das ist das, weswegen wir Alarm schlagen.“ Die ungewöhnlichen Eisbedingungen hätten große Auswirkungen auf das Ökosystem, erklärte sie weiter. Unter dem Eis in der Arktis sei normalerweise viel Leben. Als Beispiel führte die Meeresbiologin sogenannte Algenwälder an, die darunter hängen. Dieses Jahr sei das anders gewesen. „Es war erschreckend, weil das Eis von unten tot war. Das, was wir da kennen, diese Untereis-Wälder, die waren einfach weg, auf einer riesigen Fläche.“ Eine Fläche größer als Europa, so Boetius.
Um uns die Folgen des Unterganges der Untereis-Wälder vor Augen zu führen fehlen uns in Sachen marines Kleinstvieh noch Krill und eisassoziierte Amphipoden. Krill war das Wort der norwegischen Walfänger für die Massen von Kleinkrebsen, die sie in den Mägen der erlegten und zerlegten Meeressäuger fanden. Wir vergrößern jetzt mal Meganyctiphanes norvegica, den sie zum storkrill zählten. Obwohl: zählen? Die Leuchtgarnelen zählt auch niemand, auch wenn die Angehörigen dieser zoologischen Ordnung knapp einen halben Zentimeter groß werden. Sie treten in ungeheueren Massen auf. Im Gegensatz zu den Ruderfußkrebsen, die ja als Zooplankton im freien Wasser schweben, ohne oder mit sehr geringer Eigenbewegung, schwimmt Krill – sozuschreiben vorm Verzehr durch Wale und andere Meerestiere – aktiv.

Krill, Meganyctiphanes norvegica, Øystein Paulsen
Die Sache mit den eisassoziierten Amphipoden, die auch im Woodfjord vorkommen sollen, zerlegen wir mal. Es lohnt sich, denn diese mit den Asseln verwandte Ordnung der Krebstiere, die Flohkrebse (Amphipoden), meist kleiner als zwei Zentimeter, sorgen an beiden Polen für Sensationen. Fangen wir mal in der Antarktis an. Dort bohrte sich ein neuseeländisches Forscherteam durchs Ross-Schelf, eine fast 500.000 Quadratkilometer große Eisplatte die dort weit über den Meeresspiegel ragt. Sie suchten etwas ganz anderes und entdeckten Massen von Flohkrebsen, die kopfüber von der Eisunterseite herabhingen.

Flohkrebs, Amphipode
Und wir arbeiten uns jetzt von unten hinauf in der Nahrungskette der nordpolaren Eisfauna: Im Woodfjord wird im Zuge des massenhaften Auftretens von diversen Meerestierchen im Frühjahr der Polardorsch tätig. Boreogadus saida ernährt sich von Amphipoden und Krill und stellt ein höchst wichtiges Bindeglied dar, zwischen den im freien Wasser lebenden Tieren und den Wirbeltieren – Seevögeln und Meeressäugern – auf dem Eis. Bis zum Alter von etwa zwei Jahren halten sich die jungen Polardorsche zum Schutz vor ihren räuberischen Eltern und anderen Raubtieren direkt unter der Wasseroberfläche in Höhlen und Spalten des Meereises und zwischen Eisschollen versteckt. Später tauchen sie ab und gehen zum Leben knapp über dem Meeresgrund über. In jedem Fall braucht dieser Angehörtige der Dorschfamilie Temperaturen unter Null und ist gefährdet, wenn Dorschfresser Homo sapiens sein 1,5-Grad-Ziel nicht einhält. Fehlt ein Glied, reißt die Kette. Technik wird uns nicht retten, wenn wir zirkumpolar die Lebensgrundlagen vernichten. Bits und Bytes kann eine/r nicht beißen. Bitte bildet euch auch biologisch!

svalbardrøye, Salvelinus alpinus, Rotforelle, Rötel, Schwarzreiter, Röding, See- oder Wandersaibling
Frostliebende Überbleibsel oder Wandernder Schwarzreiter
Wir fügen jetzt den einzigen Süßwasserfisch ins Woodfjord-Ökosystem: svalbardrøye, Salvelinus alpinus, Rotforelle, Rötel, Schwarzreiter, Röding, See- oder Wandersaibling genannt, hat er ein durch Eiszeiten geprägtes weitverstreutes Verbreitungsgebiet von Alpensee bis Eismeerfjord. Angler*innen wissen Bescheid, das weiß ich von meinem Rumtreiben an allerlei Ufern, konsultiere vertrauensvoll luckylures.eu. und erfahre mehr über dieses zoologische „Überbleibsel aus der Eiszeit“, das weder vor großen Höhen (Gebirgen weit über 2000 Metern Höhe), noch vor großen Tiefen zurückscheut und kalte Wasser liebt. Die arktische Form von Salvelinus alpinus, in Norwegen Svalbardrøye genannt, wächst im Inneren des Woodfjordes auf und zieht dann in nährstoffreiche Gebiete des Nordpolarmeeres. Die oben zitierte Namensfülle hat einerseits kulinarische Ursachen andererseits entwicklungsgeschichtliche. Rot werden nur die Männchen und nur zur Laichzeit, daher die Namen Rotforelle, Rötel, Röding. Mindestens seit dem Mittelalter schätzen Österreicher und Bayern die kleinen Schwarzreiter, dunkle Kümmerformen, die sich durch erzwungene sehr langfristige Standorttreue in abgelegenen Bergseen entwickelt haben – seit der letzten Eiszeit ungefähr. Die Schweizer lassen sich Zuger Rötel schmecken und der auf dem einschlägigen Portal abgebildete Angler ein armlanges Exemplar aus dem schwedischen Vättern-See. Die dort lebenden standorttreuen Seesaiblinge, bei den Schweden kommen sie als röding auf den Tisch, findet er elegant und schnittig.
Kennt ihr Köcherfliegen? Sie heißen auch Trichoptera und sind zoologisch betrachtet eine aquatische Ordnung der Insekten mit weltweit 13.000 Arten – und das sind nur die bekannten. Aquatisch deutet aufs Leben im Wasser, Insekten deutet auf Flügel. Wir bewegen uns also zwischen den Elementen. Auf Norwegisch heißen sie vårfluer, vår ist der Frühling und fluer sind „fliegendes Ungeziefer“. Von Ungeziefer schreibt Hallvard Elven vom Naturhistorischen Museum der Universität Oslo nichts, aber „hardfør“, also hartleibig, nennt er Apatania zonella, die einzige im Inselreich von Svalbard und Bjørnøya vorkommende Köcherfliegen-Art. Dabei sieht seine „Hunn av“ Apatania zonella, dieses elfenflügelige Weibchen mit den feinen Fühlern so unendlich zart aus, wie es da auf einem flauschigen Blatt Platz genommen hat wie auf einer Chaiselongue. Wir wollen da jetzt nichts weiter vermensch- oder verfeelichen und stoßen zur Hartleibigkeit vor. Die Larven dieser arktischen „Frühlingsfliegerinnen“ wachsen auf vegetationsfreiem Stein- oder Kiesgrund eiskalter Gebirgsgewässer wie dem Woodfjord heran. Dafür brauchen sie eine tragbare Höhle. Dieser Köcher besteht bei Apatania zonella, die nur diesen lateinischen Namen hat, aus winzigen Steinchen. Und wenn der Frühling endlich Gråhuken erreicht, dann schlüpft aus dem steinernen Köcher weitgehend unbemerkt elfengleiches Ungeziefer.

Nein, in der schneefreien Zeit, am schneefreien Ort ist die auf Spitzbergen vorkommende Unterart des Schneehuhns (Lagopus muta hyperborea) nicht weiß.
no.wikipedia bevölkert die wärmer werdende Luft auf der grauen Landspitze zwischen den beiden Fjorden am Nordende von West-Spitzbergen zusätzlich mit svalbardrype, rødnebbterne, tyvjo, storjo, krykkje und polarmåke. Die svalbardrype (Lagopus muta hyperborea) ist eine Unterart des Alpenschneehuhns (Lagopus muta). Sie trägt Mythen in ihrem griechisch-lateinischen Namen: das altgriechische Wort Ὑπερβορέα (Hyperborea) steht für ein sagenhaftes Land. Mythographen, das sind Zeitgenoss*innen, die sich wissenschaftlich mit Mythen befassen, und die Geographen des antiken Griechenland verorten es weit im Norden, gar laut altgriechischer Vorsilbe hyper über, oberhalb beziehungsweise jenseits des Nördlichen (der griechische Gott Boreas ist für den winterlichen Nordwind zuständig). Auf einer Karte des flämischen Geo- und Kartographen ist der OCEANUS HYPERBOREUS nördlich von Island zu entdecken. Das passt. Denn Lagopus muta hyperborea kommt nur auf zwei Inselgruppen des Nordpolarmeeres vor: auf Svalbard und einem Archipel auf gleicher Breite rund 20 Grad westlich davon. Das benannte die österreichische Polarexpeditions-Crew – über die der österreichische Autor Christoph Ranzmeyer in „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ so hinreißend geschrieben hat – in den 1870er Jahren nach ihrem Kaiser Земля Франца-Иосифа (Semlja Franza-Iossifa, Franz-Josef-Land). Zurück zu Henne und Ei. npolar.no, der Seite des Norwegischen Polarinstitutes entnehme ich Fotos, dass diese Art als einzige Art ihrer Klasse (Aves) – die in enormer Schönheit und Vielfalt Wasser, Luftraum und Landmasse dort bereichert – , ganzjährig auf den Inseln von Svalbard bleibt. Ende September haben Henne und Hahn ihr Gefieder, dass an englische Tweed-Jackets erinnert, gegen ein weißes Federkleid ausgetauscht, dass sie für Räuber wie den fjellräven, den Polarfuchs auf dem Schnee praktisch unsichtbar macht. Doch halt, der Hahn trägt eine schwarze Linie, die von Auge bis Schnabel reicht und einen fleischigen roten Kamm. Sein Tweedjacket legt er – im Gegensatz zur Henne, die schon im April aus dem Winterkleid steigt – erst Mitte August ab. Wenn ich mir das alles richtig aus dem Norwegischen übersetzt habe.
rødnebbterne (Sterna paradisaea) gibt es auch in Hamburg. Ansonsten brütet die Küstenseeschwalbe auch in der Hocharktis. Und da sie in der Antarktis überwintert, toppt dieser Überflieger in Sachen Langstrecke alle anderen Zugvögel.
Liebenswürdige Lemmingdiebe oder Zauberhafte Dreizeher
tyvjo und storjo – tyv ist das norwegische Wort für Dieb, stor heißt groß – sind Raubmöwen. Das ist eine ziemlich eigenartige Vogelgattung, ein wenig mit den Watvögeln, ein wenig mit den Möwen verwandt, haben sie sich auf Lemminge, Fische spezialisiert und darauf, anderen Seevögeln die Beute abzujagen. Der diebische tyvjo (Stercorarius parasiticus) heißt auf Deutsch Schmarotzerraubmöwe – und Malerin und Autorin Christiane Ritter beobachtet diesen satanischen Vogel „milde und verliebt gestimmt“ im auf West-Spitzbergen, als er dort im Frühjahr den Großteil des Tages verträumt im Schnee sitzt, „mit seiner schwarzen, ebenso räuberisch veranlagten Braut“ – und der größere storjo (Stercorarius skua) einfach Skua oder Große Raubmöwe.

Tyvjo, nordlig type, Arctic skua (Stercorarius_parasiticus), Schmarotzerraubmöwe auf einer Eisscholle, Av AWeith – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Long tailed Skua, Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus) auf Spitzbergen, 2003, Von Jerzy Strzelecki – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Fehlen uns im Frühsommerhimmel überm Woodfjord noch krykkje und polarmåke. krykkje haben wir schon flüchtig kennengelernt, das ist die zauberhafte Dreizehenmöwe. Die polarmåke trägt das übernördliche, das sagenhafte Hyperborea im Artnamen: Larus hyperboreus, auf Deutsch Eismöwe. Wie alle anderen, auf Svalbard brütenden Vogelarten, alle außer Lagopus muta hyperborea (svalbardrype) hat sie in etwas südlicheren Gefilden überwintert, an eisfreien Gewässern im Süden ihres Verbreitungsgebiets, in der subpolaren Zone. Und ist im Frühjahr gen Woodfjord geflogen.
Dorthin, wo im Sommer 1934 auch das Ehepaar Ritter landet. Der Inseldurchquerer, der mit ihnen im heftig schaukelnden Boot saß, dem dieses Land alle Habe geraubt hat, findet es weiterhin wundervoll. Vor der werdenden Überwinterin steht „ein kleiner, kahler, viereckiger Kasten, ganz mit schwarzer Dachpappe bezogen“, aus dem ein einsames Ofenrohr ragt, inmitten einer Halbinsel, grau, nackt, steinig, deren Ufer steil zum Meer abfallen. Es ist das ansonsten unbewohnte Andrée-Land. Dort leben eigentlich nur wilde Tiere wie das Spitzbergen-Ren (Rangifer tarandus platyrhynchus), eine endemische Unterart unter den Rentieren. Endemisch bedeutet, dass diese Art nur hier vorkommt. Auf einer Insel ohne Fressfeinde und ohne menschliche Eingriffe – die Tiere durften bis 1925 gar nicht bejagt werden – kann die Körpergröße einer Tierart über Generationen merklich abnehmen. Es handelt sich hier um einen Anpassungsmechanismus bei Überbevölkerung, den Biolog*innen Inselverzwergung nennen. Die kurzbeinigen Tiere finden auf dem hocharktischen Archipel nicht wie die „Kollegen“ auf den Tundren weiter südlich keine Flechten und müssen mit Moosen vorlieb nehmen. Inzwischen nehmen sie überhand, aber davon war noch nicht die Rede als das Paar auf der nördlichen Spitze der Halbinsel zwischen Wood- und Wide-Bay bei seiner Haupthütte ankommt. Sie steht inmitten einer kleinen Halbinsel, deren Ufer steil zum Meer abfallen, und ist „ein kleiner, kahler, viereckiger Kasten, ganz mit schwarzer Dachpappe bezogen“. Auch die Umgebung, „das steinige Land, die ganze gigantische Unfruchtbarkeit“ und die erschütternde Kahlheit der schwarzen Berge erscheinen der angehenden Überwinterin zunächst wie ein böser Traum. Aber dann macht sie sich auf, um Trunkwasser zu holen und plötzlich atmen die „gewaltigen primitiven Formen im klarsten Schwarz-Weiß gegen ein Stück tiefblauen Himmels“ Größe und ungeheure Frische.

Spitzbergen-Ren (Rangifer tarandus platyrhynchus), Spitsbergen, By Krzysztof Maria Różański, (Upior polnocy) – Own work, CC BY-SA 3.0
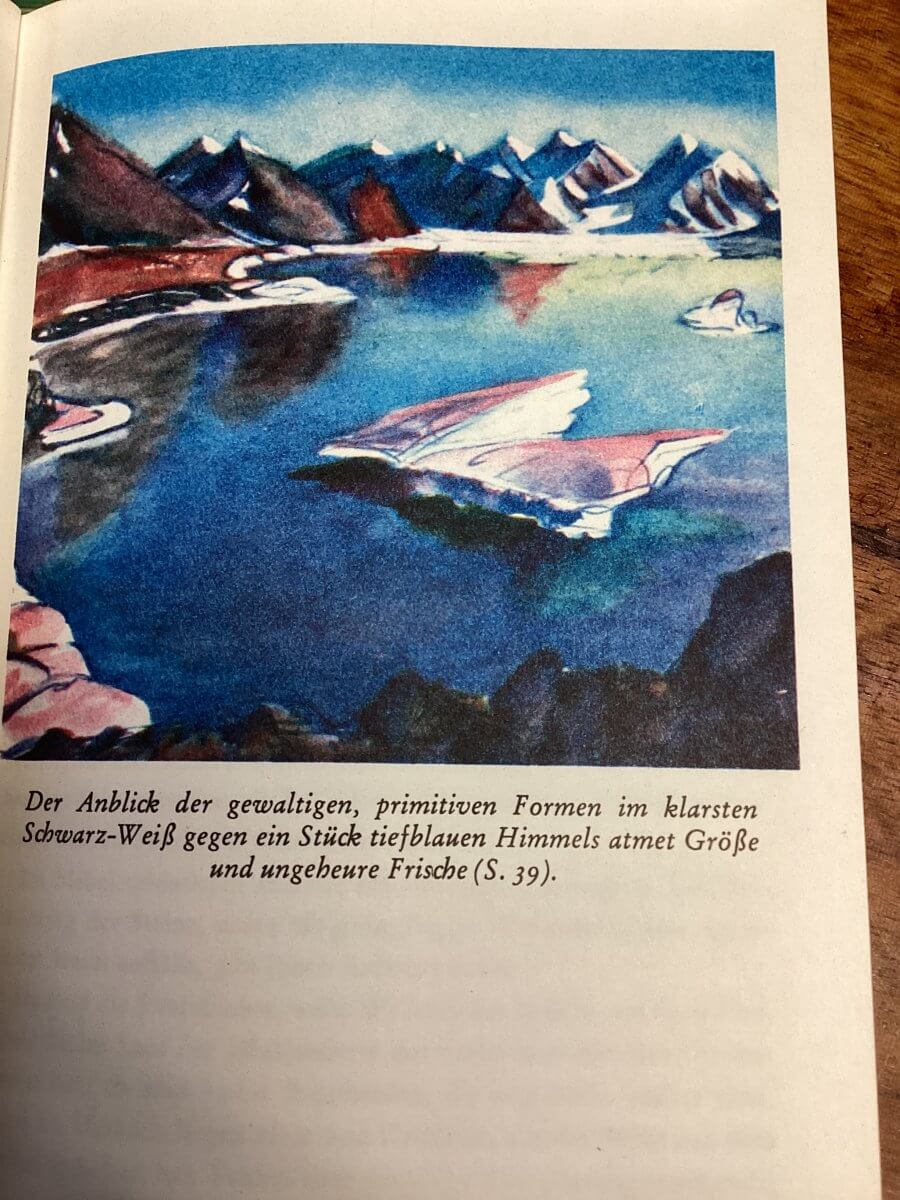
So erging es mir auch, als wir damals mit der Valdivia das arktische Archipel erreichten. Hatte dort nicht soviel Schönheit erwartet. Dieser erste Eindruck von Spitzbergen ist unauslöschlich auf meiner inneren Festplatte gespeichert.
Die Dreier-Crew vom Gråhuken macht sich per Boot auf ins Innere des Fjords, auf Ritters Karte als Wijde-Bay eingetragen. Auf Norwegisch heißt er Wijdefjorden (ausgesprochen: veidefjorden) und ist der längste in der Inselgruppe Svalbard. Hier haben schon im 18. Jahrhundert russische Jäger Hütten errichtet, aus mächtigen Treibholzstämmen, die die Strömung von sibirischen Strömen wie … herüberträgt und anschwemmt. Ritter beschreibt diese Russenhütten, deren Holz durch die jahrelange Drift im Meer, durch Wind, Sonne und Eis schneeweiß geblichen wa, die durch ihr Gewicht tief in den Boden gesunken waren. Unter dem Gras auf den flachen Dächern liege eine blaue Tonschicht, sie solle auch heute noch gegen Regen und Schnee durchaus dichthalten. Der sogenannte blaue Ton enthält Mineralien (Alumosilikate), die ihn besonders wetterbeständig machen. „Diesen Ton brachten die Jäger aus ihrer Heimat mit.“ Sie kamen unter anderem von einer Inselgruppe in einem Nebenmeer des Arktischen Ozeans, dem Бе́лое мо́ре, Weißen Meer, von Соловецкие острова, den Solowezki-Inseln, noch genauer, von einem dort im 13. Jahrhundert errichteten Kloster. Einer der Mönche, die auf Spitsbergen hohe Holzkreuze errichteten und im Freien Gottesdienste abhielten, lebte dort mehr als 30 Jahre. Das Innere dieser Hütten ist manchmal gruselig, aber wenn die Abendröte einen Streifen pastellblaue Nacht mit sich empor zieht, gebe das blaue Licht der seltsamen Landschaft „die verklärte Weichheit und Weihe, die alle Dinge hier oben in der hellen Nacht annehmen.“
Zweiteilige Segge oder Zarter Haarschlund
Das Innere des Wijdefjorden ist heute norwegischer Nationalpark. An seinen trockenen, steinigen, salzigen Ufern wächst, wie ich der norwegischen Wikipedia entnehme, eine einzigartige Flora. Die dort genannten Vertreterinnen von Europas wahrscheinlich einziger hocharktischer Steppenvegetation finde ich bis auf Småsøte (Comastoma tenellum, heißt auf Deutsch Zart-Haarschlund oder Zarter Enzian) und Myrtust (Kobresia simpliciuscula, die Zweiteilige Schuppensegge) nirgendwo im weltweiten Netz und vertraue mich daher als neugierige Botanikerin den Expert*innen vom Norwegischen Polarinstitut in Tromsø an. Die bringen sie mir sehr nah, die Pflanzenwelt dieser nördlichsten arktischen Tundra, die dort trotz „challenging conditions“, herausfordernder Überlebensbedingungen, eine große Vielfalt „in Form und Funktion“ aufweise. Der Norden der Insel Spitsbergen sticht im Archipel Svalbard durch seltene Pflanzen hervor, aber auch der Rest der Inselwelt bietet botanische Besonderheiten. Zwar gibt es in unserem südlicheren Sinne keine Bäume – obwohl Polarweide (Salix polaris) und Zwergbirke (Betula nana) offiziell trotz ihrer mangelnden Höhe zu den Baumarten gehören – aber allerlei immergrüne oder sommergrüne, verholzte oder krautige Pflanzen, solche mit Wurzeln und, wie Moose und Flechten ohne Wurzeln, allesamt arktisch angepasst, nur auf ganz verschiedene Weise.
Gewaltiger Mittaglefflergletscher oder Grellrote Steilkante
Wir wenden uns nun wieder Ritter und ihrer sommerlichen Bootsfahrt auf dem Wijdefjord zu. Sie staunt im Inneren des Meeresarmes über die „grandiose Landschaft von steilragenden, grellroten Felsen, …, in die der gewaltige Mittaglefflergletscher (norwegisch Mittag-Lefflerbreen) herabströmt.“ Und über „das Bergland Neufriesland (Ny-Friesland), das sich hier in unzählige markante Zacken und Grate löse, die aus den Gletschern herausragen.
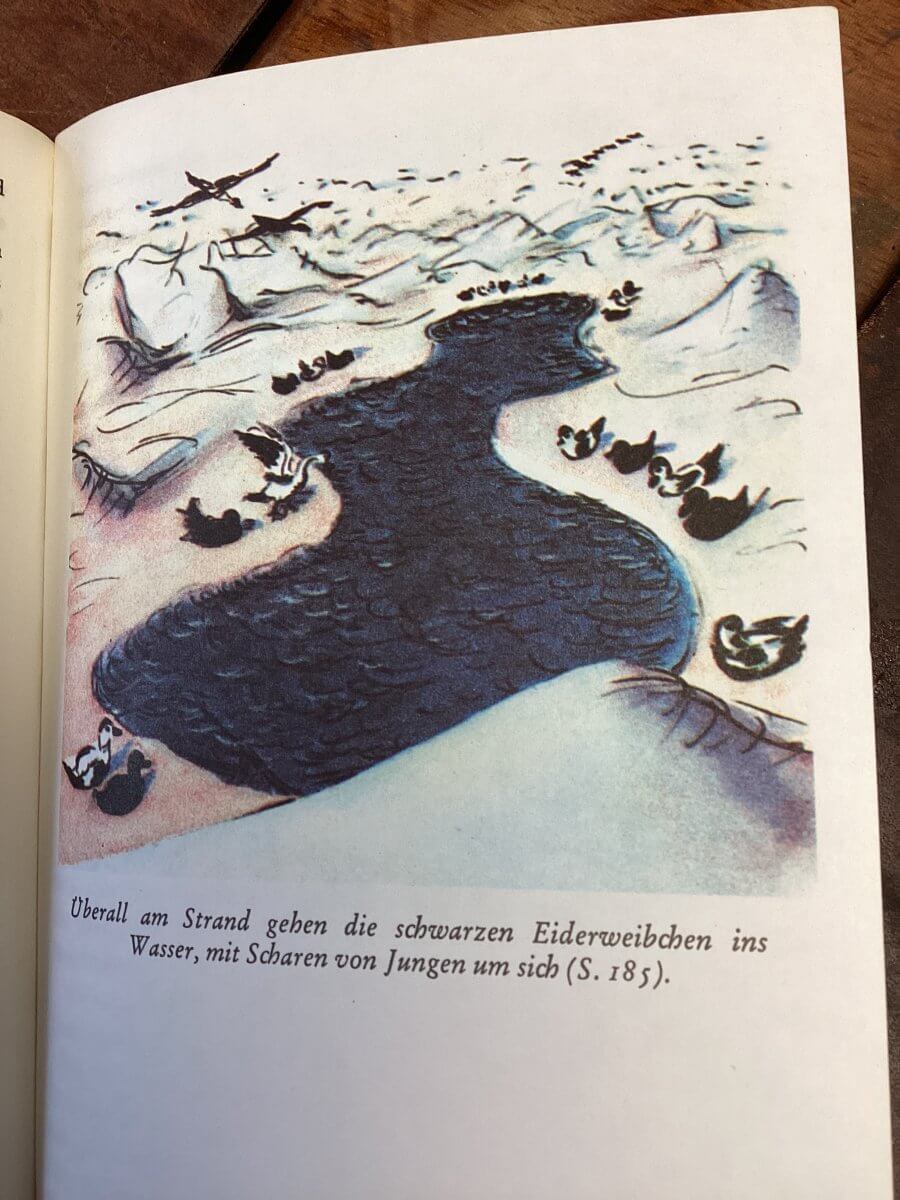
Und immer wieder zeichnet und beschreibt die Malerin die sie umgebende Tierwelt: „Um diese Jahreszeit sammeln sich die Vögel für ihren Flug südwärts.“ Schon sammeln sich die Eiderentenweibchen für ihren Flug gen Süden. Die Männchen dieser Meerenten-Art (Somateria mollissima) verlassen die Arktis schon kurz nach dem Schlüpfen der Jungen. Bald bestehen die Tage der drei Überwinterer nur noch aus Morgen- und Abendröte. „Die Sonne rollt wie eine feurige Kugel über die Gebirge … Die Schneehühner kommen von den Bergen ins Tal.“ Man würde sie aufgrund ihrer Schutzfarben kaum finden.
Pfiffige Fasanenartige oder Leichtbeschwingte Sitzenbleiber
Das erinnert mich ruckartig an meinen Sommer im Schärengarten von Helgelaante, wie es auf Südsamisch, Helgeland, wie es auf Norwegisch heißt – der Name kommt vom sagenumwobenen Hålogaland. Die Fahrt auf eine winzige Insel dieser Küstenregion im Süden der norwegischen Provinz Nordland war meine erste „Nordlandreise“, 1971. Wir mieteten die Hütte, das einzige Gebäude auf dieser Schäre mitsamt Gewehr. Und ich war 17 und ging auf Schneehuhnjagd, unerschrocken und unerfahren. Dachte ich doch, die weißen Tiere wären sicher prima zu spotten. Damit erntete ich jede Menge Spott, aber auch Naturerfahrung pur. Schneehühner, die Gattung Lagopus aus der Familie der Fasanenartigen, sind zwar plump, aber nicht blöd. Ihr im Winter eher helles, im Sommer eher dunkel-geflecktes, Gefieder gleicht sie farblich derartig dem Untergrund an, dass eine sie erst auf ein paar Schritte Entfernung entdeckt. Zudem sind diese Hühner so schlau, einfach still sitzen zu bleiben, wenn sich so eine blöde Jägerin naht. Nur wenn die allzu aufdringlich wird, erheben sie sich, wie Ritter schreibt, „leichtbeschwingt wie eine Möwe“. Nachdem die beiden Männer in einem sehr feierlichen Moment das erste Mal die Petroleumlampe angezündet haben und den Fuchsfang planen, warnt Tierfreundin Ritter ihren Polarfuchs Mikkl: „Dein schönes Fell ziehen sie dir über den Kopf und verschicken dich weit dorthin, wo die vielen Menschen beieinander wohnen. Dort bekommst du glitzernde Augen aus Glas und hängst dann in einer der tausend glitzernden Auslagen in einer der tausend glitzernden Straßen, neben anderen tausend glitzernden toten Dingen. Weißt du, Mikkl, dort wissen die Menschen vor lauter künstlichem Geglitzer gar nichts mehr vom Licht, seinem Kommen und Gehen und der Magie der Dämmerung.“

Nochmal Spitzbergen von oben, mit ursprünglicher Vergletscherung. Dieses 1923 vom Schweizer Luftfahrtpionier, Reiseschriftsteller und Fotografen Walter Mittelholzer aufgenommene Luftbild zeigt die Mündung des Lomfjords in die Hinlopenstraße. Der Lomfjord befindet sich im Nordosten der Insel Spitzbergen, die Hinlopenstraße trennt sie von der Nachbarinsel Nordaustlandet.
Später ist Ritter allein mit all der Magie und beginnt ihren Mann zu verstehen: „Man muss allein sein in der Arktis, um sie wirklich zu erleben!“. Sie unternimmt, wie sie sich selbst versprochen hat, in Phasen des Alleinseins, „en spaseretur hver dag“, auch wenn ihre tägliche Spaziertour sie nur in Finsternis und Sturm einmal um die Hütte führt, auf Knieen. Und betritt immer wieder „die stumme, gewaltige Eisbühne, auf der das grandiose Schauspiel der Polarnacht spielt.“ Helle Strahlenbündel entspringen über ihr, in ungeheurer Höhe. „Sie scheinen senkrecht auf mich herabzufallen, werden immer heller und greller, erstrahlen in Rosa, Lila und Grün, tanzen und drehen sich um ihre eigene Achse in wildem Tanz, quer über den Himmel hinweg; wehen wie wallende Schleier, werden blass und vergehen.“ Das versetzt mich schlagartig zurück in einen frühen März in den etwas späteren 1970ern in ein Tal am Rande der größten Hochebene Europas. Dort, im Jønndalen, durch das wir tagsüber auf hölzernen Langlaufskiern hinauf auf die überwiegend menschenleere Hardangervidda rutschten, schmissen wir uns eines Nachts gegenseitig aus den Stockbetten. Und hatten dann die Lightshow unseres Lebens, stundenlang.
Hellhörige Überwinterin oder Arktisches Bewusstseinsstadium
Die Überwinterin wir immer hellhöriger. Sie vernimmt das Rauschen von Skischritten über riesige Entfernungen. „Vielleicht hört man hier Dinge, die man in anderen Breiten, in einem anderen Bewusstseinsstadium nicht zu hören vermag!“. Die Männer, die sie morgens gehört hat, kommen viele Stunden später an. Und wundern sich nicht über ihre Hellhörigkeit; „sie haben Ähnliches oft genug selbst erlebt.“ Viele Wochen später, die Grenze des Packeises, es wird definiert als dicht angeordnete Eisschollen, die das Meer mindestens zu 80 Prozent bedecken, ist jetzt im Frühjahr nach Süden vorgerückt, die von den Überwinterern so dringend benötigten „Fleischvitamine“ sind in Gestalt ihrer Jagdbeute Richtung Westspitzbergen gewandert, und die „gewaltige Fläche des Meereises gab die Himmelsfarben opalisierend wieder“, leuchtete um die schweren Eisstücke herum in tiefem Lila und weichem Kobaltblau, hört Ritter wieder ganz laut eine Stimme. Die Rede ist von frischen Schneehühnern. Sie erkennt den Tonfall des Norwegers Karl, der weit entfernt von der Hütte jagt, und begreift, dass dies wieder ein Phänomen der Schallübertragung auf weite Strecken ist, die in der klaren Luft des hohen Nordens vorkommen.
Sie sinniert über diese Jäger, ihre Leistungen, die fast unmenschlich sind. „Sehr selten erzählen sie von ihren Erlebnissen. Sie gehen nicht auf Ruhm aus, diese Menschen…. Eine unbändige Liebe fesselt sie an dieses Land. Sie leben berauscht von dem Lebensatem dieser wilden Natur“. Auch bei ihr stellt sich jene „unvergleichliche Seelenruhe“ ein, die sie darauf zurückführt, dassihr Tagwerk nur auf das Lebensnotwendigste eingestellt ist und ihr so Tag und Nacht Zeit bleibt, „der Natur zu leben.“ Ein Schlittenhund sieht sie an „mit großen, ernsten Augen, nicht fragend, nicht sprechend, welt- und wirklichkeitsfern und doch so voll von träumendem, tiefem Leben, dem gleichen geheimen Leben, das im ganzen stillen Land verborgen zu sein scheint.“ Sie will nicht weg. „Nu blir fruen rar!“, diagnostiziert Karl. Nun werde seine Überwinterungsgefährtin verrückt, zum Spitzbergennarr. Sie hingegen ahnt „das letzte Geborgensein“. Sogar ihre Furcht vorm Eisbären verschwindet. Über „dieses kraftvolle Tier, das geschaffen ist, den größten Naturgewalten zu trotzen, den peitschenden Stürmen in langer Nacht auf treibendem Eis“, dem es gegeben sei, „zu wandern, unentwegt zu wandern über Meere, vereiste Inseln und Länder, rastlos durch das weiteste, ungestörteste Reich der Erde“.
Erste Eisbärenjägerin auf Spitzbergen war übrigens Wanny Woldstad, offiziell Ivanna Margrethe Ingvardsen (fetale-brave-fantastic…). Sie war auch in den 1930er-Jahren Tromsøs erste Taxifahrerin und chauffierte die erfolgreichen Jäger in die Ølhallen, holte sie dort wieder ab und hörte ihnen zu. 1932 nahm sie an ihrer ersten Spitzbergen-Expedition teil, der Überwinterungen und Jagderfolge folgten.
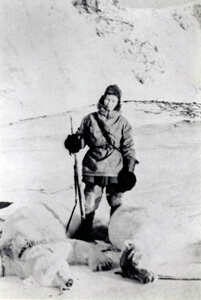
Wanny Woldstad, 157 Zentimeter groß, Tromsøs erste Taxifahrerin, Spitzbergens erste Eisbärenjägerin
Nein, die Handvoll Jäger der 1930er-Jahre konnten der Art Ursus maritimus nichts anhaben, selbst wenn ihnen einzelne Exemplare in die Fallen gingen. Die kraftvollen Tiere haben bislang den Gewalten von Mensch und Natur getrotzt, aber nun warnen die IUCN (International Union for Conservation of Nature; deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur) und andere davor, dass die globale Erwärmung ihre Lebensräume der Eisbären drastisch verringern werde, dass durch den von Teilen der Menschheit verursachten Rückgang des arktischen Eises bis Mitte unseres Jahrhunderts zwei Drittel der gegenwärtigen Eisbärenpopulation verloren gehe, dass es, wenn das Meereis komplett verschwindet, unwahrscheinlich, sei dass die Art überlebe. In jedem Fall sei der Bestand von rund 26.000 Tieren gefährdet.

Veronika Lišková, die Regisseurin von The Visitors
Von solchen Gefahren und Bedrohungen im hohen Norden handelt mein Samstagmorgenfilm The Visitors. Veronika Lišková, die Regisseurin, reihe ich ein in „Mostly young – mostly female – mostly brave“. Sie studierte in Prag: Kulturwissenschaften an der Karls-Universität; Drehbuchschreiben und Dramaturgie an der Akademie der Darstellenden Künste. Ihre Hauptdarstellerin Zdenka wandert aus der Tschechischen Republik samt Familie ein in der Welt nördlichste Stadt.
Nachhaltige Gründer oder Imperialistische Gründe
Einwandern, so sagt seit langer Zeit das norwegische Gesetz, darf dort jede/r die oder der ein Auskommen und eine Unterkunft hat. Diese Offenheit hat Gründe. „Wir sind hier aus politischen Gründen“, sagt die von Soziologin Zdenka interviewte örtliche Pfarrerin. Nein, sie spricht nicht von imperialistischen, nationalistischen, auch nicht von kapitalistischen Gründen.

Die Spitzbergen-Besucher*innen von heute zeigt The Visitors von Veronika Lišková, die wie Christiane Ritter, die die Insel vor hundert Jahren aufgesucht hat, aus Tschechien stammt.
Davon spricht Longyearbyens Geschichte. Die Stadt liegt am Isfjord und endlich entdecke ich auf no.wikipedia ein Bild, das ein ganz klein wenig von dem Zauber zeigt, der uns empfing, als wir mit dem Hamburger Forschungsschiff Valdivia zur Mittsommerzeit in diesen Fjord der Insel Spitsbergen einliefen:

Longyearbyen liegt dort, wo das Tal des Adventfjordes in den Isfjord mündet. Dieses Foto zeigt den Berg Adventtoppen am gleichnamigen Fjord von der Stadt aus gesehen. Von Bjoertvedt – eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Erkundung und Nutzung dieses einzigartigen arktischen Standortes haben recht nachhaltig angefangen, mit einer Handvoll Männer wie Søren Zachariassen, geboren 1838 in Gáranasvuotna (Ramfjord) rund 20 Kilometer südlich der Stadt Romsa/Tromsø in einer abgelegenen Ecke der gleichnamigen Kommune, von Berufen auf Norwegisch skipsfører (Kapitän), fangstmann (Fischer), islos (gehört zu den vielen nicht aus dem Norwegischen übersetzbaren Wörtern und hat etwas mit dem Eis zu tun, vielleicht bedeutet es Eismeerskipper) und gründer (dieses Wort werden die Norweger wohl aus dem Deutschen importiert haben). Zachariassen entdeckte dort, wo der Adventfjord in den Isfjord mündet – dort wo, als die Insel Spitsbergen noch nicht norwegisch war, eine Touristenunterkunft errichtet wurde – auf der Hotellneset, Jägerhütten von Pomoren.

Das erste Hotel auf Spitsbergen, der größten Insel des auf Norwegisch Svalbard genannten Archipels, wurde 1908 errichtet, zwölf Jahre bevor es norwegisch wurde, Hanna Resvoll-Holmsen
Eigenwillige Seenschützerin oder Selbständige Svalbard-Forscherin
Und ich entdecke jetzt beim Aufstöbern alter Fotografien ein weiteres Vorbild unter unseren „Vormüttern“: Hanna Resvoll-Holmsen, female – brave – fantastic. Sie wurde 1873 in Vågå geboren, wo die Vågåbøndene, die Bauern von Vågå – nicht verwechseln mit dem internationalen friedlich fahrenden Volk der Vagabunden – ihre Schlachten schlugen.
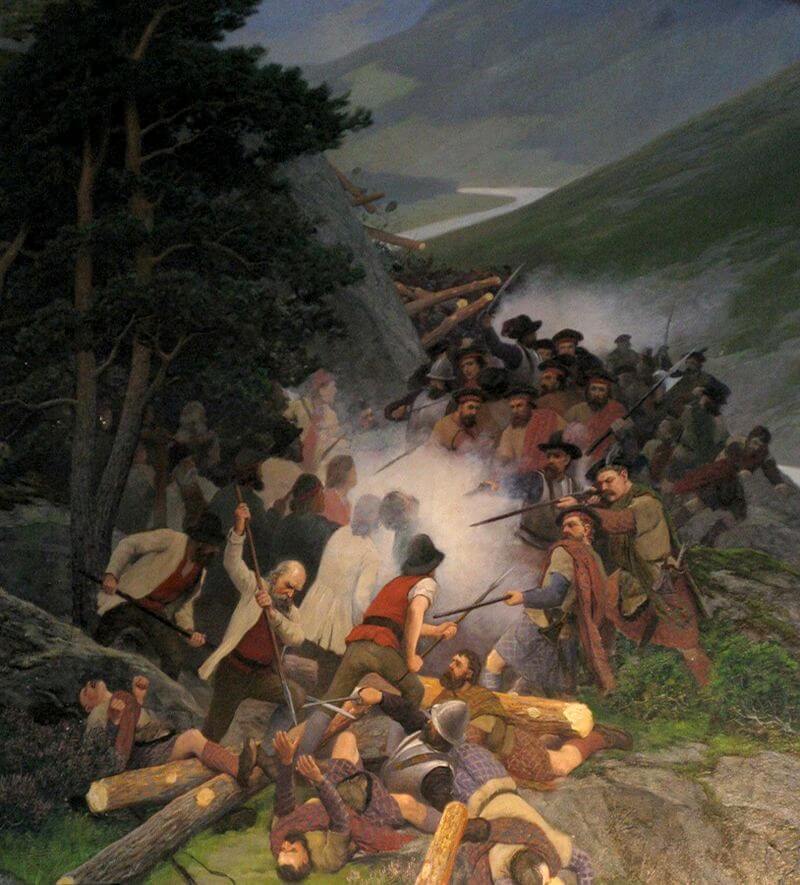
Die Bauern von Resvoll-Holmsens Geburtsort Vågå (Vågåbøndene) – nicht verwechseln mit dem friedlich fahrenden freien Volk der Vagabunden – kämpften Ende des 19. Jahrhunderts gegen schottische Söldner. Und schon damals blickte bei all der Waffengewalt niemand mehr durch, Georg Nielsen Strømdal

Botanikerin, Fotografin, Polarforscherin, Naturschützerin Hanna Resvoll-Holmsen
Die Botanikerin erkundete als erste weibliche Forscher*in das Archipel Svalbard, vor allem dessen Flora. Sie ging mit Albert I von Monaco 1907 auf Expedition, finanzierte im darauffolgenden Jahr ihre Svalbard-Expedition selbst, wurde in den 1920er-Jahren, als sie sich für den Schutz der Seen Gjende und Bygdin im Gebirgsmassiv Jotunheimen und des Flusses Sjo in ihrer Heimtkommune einsetzte, als erste Naturschützerin überhaupt bezeichnet.

Der See Gjende im Gebirge Jotunheimen, Von Manuel Werner, Nürtingen, Deutschland

Der See Bygdin im Gebirge Jotunheimen, Von Juppi66 – Eget verk, CC BY-SA 3.0

Jotunheimen, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=590955
Und mir wird ganz schwindelig, habe ich doch Anfang der 2000er-Jahre bei einer Allein-Skitour auf der Hardangervidda, zu der auch der unten abgebildete Gletscher Hardangerjökulen gehört, zu Tränen gerührt über soviel Aussicht auf nicht vom Menschen Gemachtes, geschworen, mich für die Natur einzusetzen. Habe es schreiend versucht, jetzt probiere ich es schreibend.
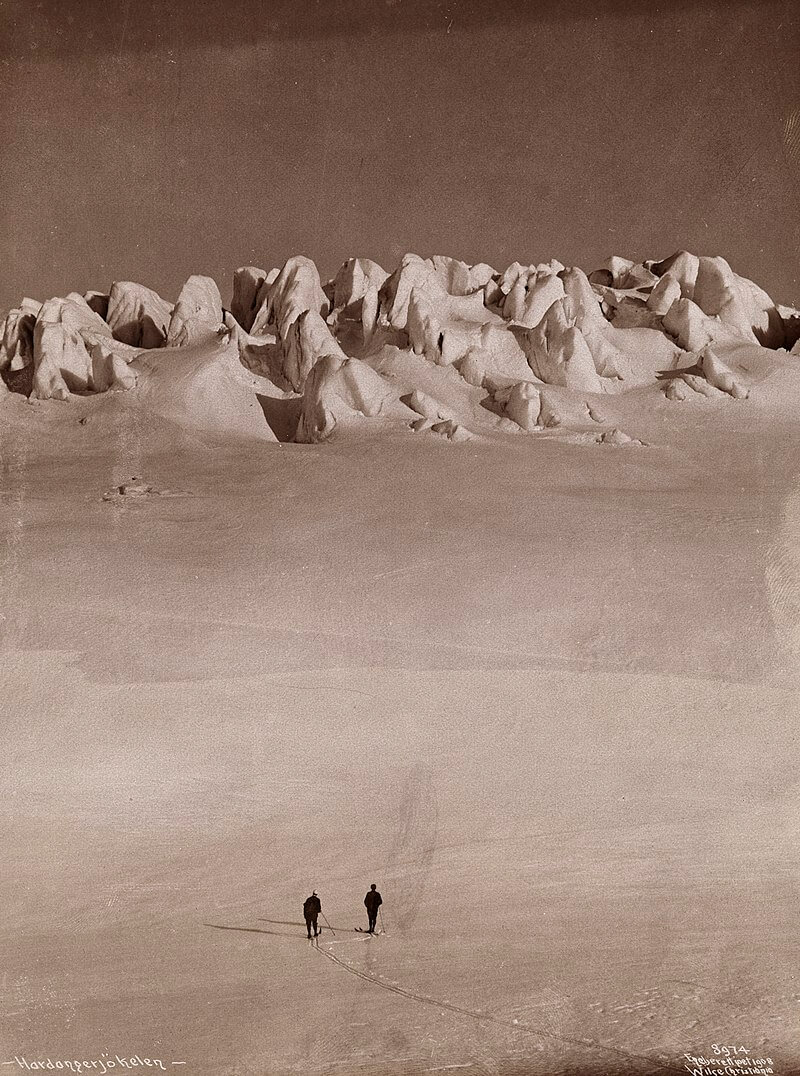
Hardangerjökulen/Hardangerjøkelen, Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Bildesignatur / Image Number:bldsa_FA0768
Alberts Yacht-Treibstoff oder Tiefschürfender Tourist
Der oben vorgestellte Zachariassen entdeckte am Isfjord Kohle, entnahm 600 Hektoliter, verkaufte zwei Tonnen an Albert I von Monaco – der einen großen Teil seiner Zeit als Forschungsreisender auf See verbrachte und damit seine Yacht betrieb – und weiteres Heizmaterial an die Brauerei Macks und das Elektrizitätswerk in Tromsø.
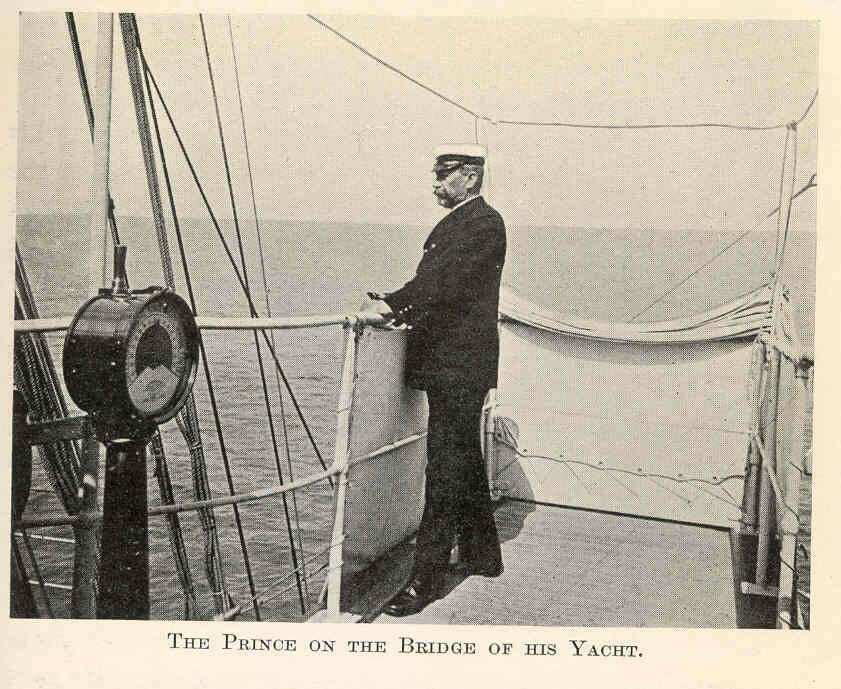
Albert I von Monaco auf der Brücke seiner Forschungsyacht
Aber wir waren ja eigentlich am Adventfjord stehen geblieben. Wie 1910 das unten abgebildete Expeditionsschiff Mainz.
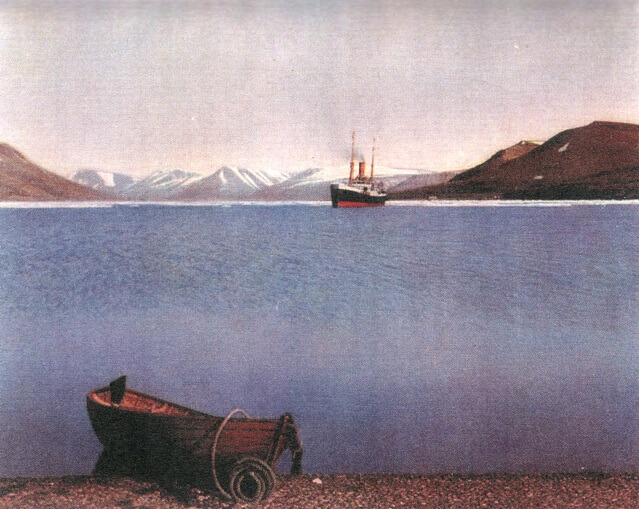
Das Expeditionsschiff Mainz im Adventfjord. Das Foto machte 1910 Adolf Christian Heinrich Emil Miethe aus Potsdam, ein Pionier der Fototechnik; Adolf Miethe, Hugo Hergesell: Mit Zeppelin nach Spitzbergen. Bong, Berlin 1911, Gemeinfrei
So fings an und ging mit der Grube in Calipsobyen am Bellsund weiter, der ich wiederum ein Foto der Mitternachtssonne über jenem Fjord im Westen der Insel verdanke, das ziemlich nah an die Anmutung im Sommer 1984 rankommt, auch wenn es von 1900 stammt, aus der Zeit, als der amerikanische Tourist John Munro Longyear die Grube am Bellsund entdeckte. Er gab der Stadt, die im Film The Visitors die Hauptrolle spielt, ihren Namen und stieg ein ins Geschäft, aus dem schließendlich Norwegens einziges Kohlekraftwerk hervorging, die Nutzung von fossilem Brennstoff machte aus einer Gegend mit weltberühmt klarer Luft die umweltverschmutzteste weltweit, lange vor Vattenfall. Die Norwegische Zentralbank und andere Aktionäre beendeten die amerikanische Phase und kauften Longyear seinen Besitz ab. Wenig später hatte Norwegen seine territorialen Ansprüche durchgesetzt: dank Spitzbergenvertrag bekam das Land die Hoheit über alle Inseln und Felsen zwischen 74 und 81 Grad nördlicher Breite und 10 und 35 Grad östlicher Länge, inclusive Bjørnøya (Bäreninsel) und der in der Barentssee gelegenen Insel Kvitøya (Weiße Insel). 1920 wurde der Vertrag geschlossen, der die Gebietsansprüche formell geregelt hat, 1925 erlangte Norwegen aufgrund die Souveränität über Spitzbergen, muss aber allen Bürgern der unterzeichnenden Länder, die sich auf Spitzbergen niederlassen wollen, die gleichen Rechte einräumen.
Politische Erdrutsche oder Skeptischer Einwanderer
Als das Ehepaar Ritter in den 1920ern auf der Insel Spitsbergen überwinterte, lebten dort 2000 Russ*innen und 900 Norweger*innen. Das spezielle und sehr offene Einwandungsgesetz sollte dafür sorgen, dass die Verhältnisse sich ändern. Damals begann, was heute noch gilt: Um auf der arktischen Inselgruppe zu leben, braucht niemand ein Visum. Filmheldin Zdenka trifft bei ihren soziologischen Untersuchungen in Longyearbyen auf Menschen aus mehr als 50 Nationen.

Forscher*innen aus aller Welt finden sich ein. Diese Forschungshütte der Adam-Mickiewicz-Universität im polnischen Poznań wird Skottehytta genannt und befindet sich an der Petuniabucht auf dem Dickson-Land, Von Krzysztof Maria Różański, (Upior polnocy) – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Das große Schmelzen reißt der internationalen Community den Boden unter den Häusern weg und gesellschaftliche Erdrutsche lassen die Solidarität und den Zusammenhalt, für beides wurde Norwegens nördlichster Außenposten einst gerühmt, im Eismeer versinken. Diejenigen die nicht Norwegisch sprechen, werden gedrängt, es zu lernen, bekommen aber keinen Raum dafür, in jedem Sinne.

Die russische Siedlung Грумант, auf Norwegisch Grumantbyen wurde 1910 errichtet und zu Beginn der 1960er-Jahre verlassen, Av Bjoertvedt – Eget verk, CC BY-SA 3.0 no
Die Bilder von Liškovás aufregendem Film schleudern mich immer wieder zurück ins internationale Marginal Icezone Experiment (MIZEX) die Forschungen am arktischen Eisrand vor 40 Jahren. Dort treibe ich mich 1984 per Schiff rum, als das große Schmelzen, von dem Liškovás Protagonisten reden, noch nicht eingesetzt hatte, als wir verbotenerweise in einer hellen Sommernacht Steine klopfen. Es gab mehr Meereis damals, soviel steht fest. Und die katastrophalen Folgen der von nachweislich einer relativ kleinen Gruppe von Weltbürgern maßgeblich bewirkten Erderwärmung haben sich auch in der Verwaltung von Longyearbyen rumgesprochen. Der Bürgermeister erzählt der tschechischen Forscherin, man strebe „Zero-Emission“ an. Wie soll das gehen auf einer Insel, die mit nahezu allem per Flugzeug oder Schiff beliefert wird? Das fragt sich in The Visitors auch Zdenkas Partner und weist wütend darauf hin, dass Svalbards Häuptlinge, wenn das Kohle-Kraftwerk dort, Norwegens einziges, schließt, diese Null kaufen würden, und die Emissionen anderswo in die Luft gehen, dort, wo Kohle weitaus brutaler entnommen werden. Der junge Tscheche hält so etwas für einen ziemlich miesen Deal.

Schräge Glasaugen oder Perfekter Panoramablick
Ich trete gegen 11 Uhr aus dem FOKUS 4 wieder in die Romsa-Realität. Und blicke Canis lupis lupis in die leicht schräg gestellten und nach vorne ausgerichteten Glasaugen. Diesem Wolf im Schaufenster ist es ergangen, wie Ritter schrieb: „Dein schönes Fell ziehen sie dir über den Kopf und verschicken dich weit dorthin, wo die vielen Menschen beieinander wohnen. Dort bekommst du glitzernde Augen aus Glas“. Apropos Augen, unter anderem in diesem Sinne sind uns viele Angehörige der zoologischen Familie der Canidae – wenn auch vielleicht nicht die haustiergewordenen Verwandten haushoch überlegen. Canis lupus lupus (auf dem Bild unten, unten links, CANIS OCCIDENTALIS) , eine Unterart der Wölfe, genannt Eurasischer Wolf oder Grauwolf hat wie seine Artgenoss*innen weltweit einen Panoramablick von 240 Grad, erspäht winzige Insekten aus drei Metern Entfernung und blickt auch im Dunkeln gut durch. Die beweglichen Trichterohren sind innen für feinste Wahrnehmung dicht behaart und thronen aufrecht auf der großen, breiten Stirn. Beim ausgestopften Exemplar im Outdoor-Shop weisen sie nach vorne, diese Orientierung ist aufs Jagen ausgerichtet. Wölf*innen hören förmlich das Gras wachsen, sie nehmen auch Ultraschall wahr und können ihre Beute akustisch in weit entfernten Verstecken aufspüren. Und wenn nicht, hilft die feine Nase, mit der Canis lupus Duftspuren im Umkreis von zweieinhalb Kilometern identifiziert.
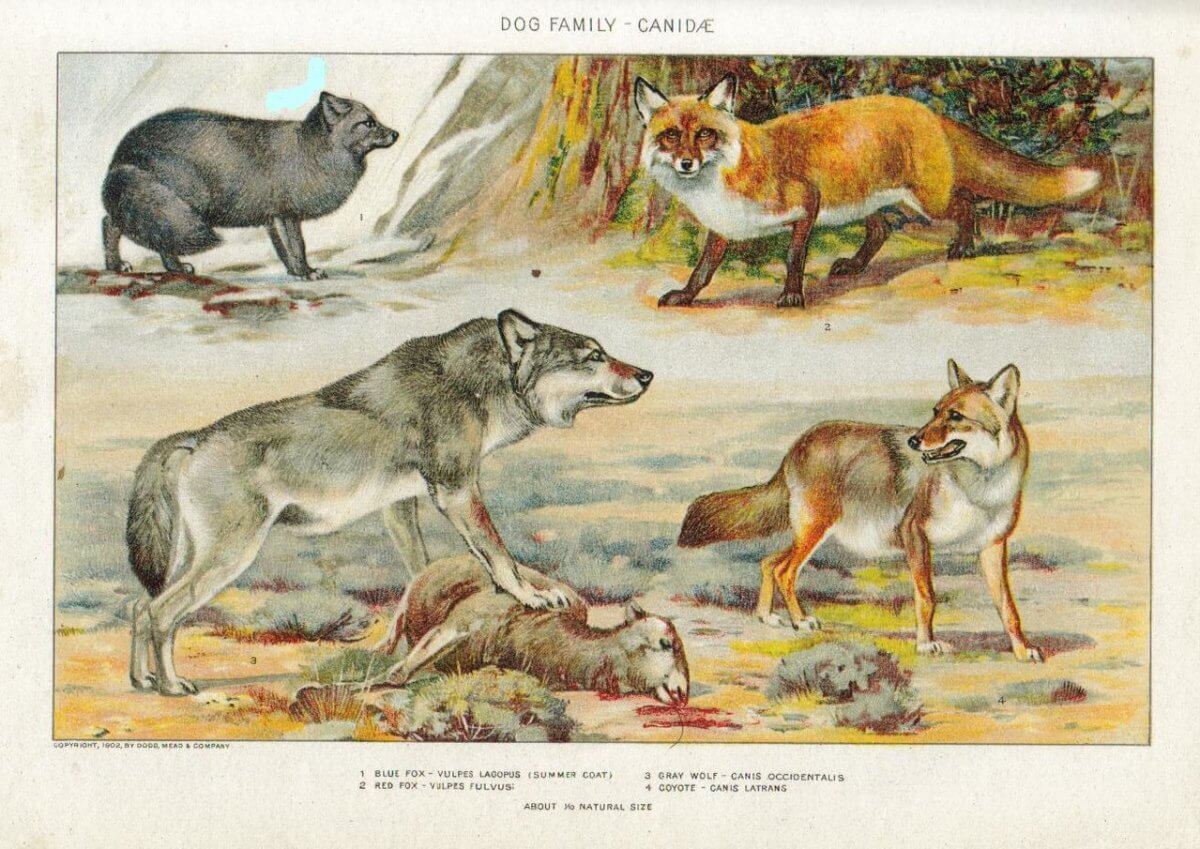
Streiche ehrfürchtig übers graubraune Fell und fühle plötzlich den Wolfspelz, den mir ein hilfsbereiter Mensch als Langzeitleihgabe über die Schulter geworfen hat, als ich mit einem Männerhemd und einer alten Jeans als ausschließlicher Bekleidung dem unwirtlichen Elternhaus entflohen war und es Winter wurde. Ja, ich bin schon immer Ökoaktivistin und trage trotzdem Pelz. Ja, Anfang der 1970er-Jahre wurde es auch in Hamburg noch richtig Winter! Dennoch ist das nordwesteuropäische Klima bei allen Veränderungen nach wie vor deutlich anders als das, was andere Wolfsunterarten brauchen.
Der Tundrawolf heißt zwar wissenschaftlich mit „Nachnamen“ weiß (Canis lupus albus), sein Fell ist meistens überwiegend grau und er lebt, wo ich unbedingt in einem meiner nächsten Leben – falls es nicht in diesem noch klappen sollte, wir wissen ja nichts genaues über die Halbwertzeit des Imperialismus mit seinen militärischen Ein- und Übergriffen:) – hinfahren muss, unbedingt mit Zug und Schiff, unbedingt im Pelz:) … in eurasischen Tundren von Finnland bis Sibirien.
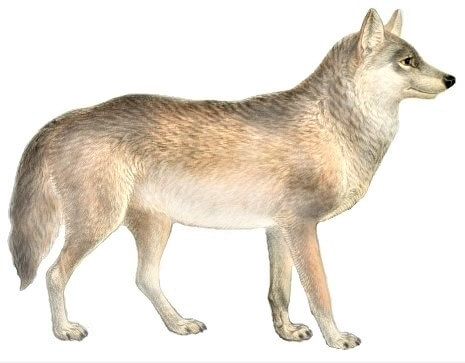
Tundrawolf, Canis lupus albus
Auch solche, die ganzjährig ein weißes, cremeweißes oder maximal sehr hellgraues Fell tragen und damit perfekt an Dauerschnee angepasst sind, sollen, weil sie so schön und rätselhaft sind, hier jetzt auftreten und vorkommen: Diese Art heißt Canis lupis arctos. Was mich als Anhängerin und Fan der wilden Tiere so besonders freut, ist, dass Canis lupis arctos, im Deutschen Polar- , Weißwolf oder Arktischer Wolf genannt, in besonders unwirtlichen und menschenfeindlichen Gegenden lebt, genauer: ausschließlich auf den kanadischen Arktisinseln und an Grönlands Küsten, wo sie von Inuit in unbedenklicher Zahl gejagt werden, wo noch nicht mal Forscher*innen vorbeikommen. Daher sind sie weitgehend unerforscht. Was auf der Hand liegt: in diesen rauen Verhältnissen, könnte ein einzelnes Tier kaum überleben, daher ist die Rudelsolidarität beim Polarwolf noch ausgeprägter als bei Wölfen anderer Unterarten.

Dieser Polarwolf, Canis lupus arctos, lebt ganz untypisch in der Nähe von Hamburg, wo sein Winterfell auffällt, fotorequest_fotolia_78673970_m
Inspirierendes Industrie-Areal oder Prächtiger Präsidenten-Pub
Nach der unerwarteten Begegnung in der arktischen Konsummeile tragen mich meine Füße in den fellgefütterten Stiefeln gemütlich ins Amtmanden. Amtmanden oder Amtmannen (Artikel inclusive) bedeutet: der Regierungspräsident. Dessen Lokal ist während des diesjährigen TIFF „industry area“, also Treffpunkt von Filmschaffenden und ihrem Umfeld. Die sind aber scheinbar noch nicht auf den Beinen. Bis auf Marianne Hoff, 75 Jahre, Kinochefin am Sognefjord, im Dauereinsatz für kleine norwegische Lichtspielhäuser. Sie fragt, ob ich mir Gesellschaft wünsche. Det gå bra! sage ich und meine: sie kommt wie gewünscht und gerufen.

Sognefjord, Eilert Adelsteen Normann
Kurze nachträgliche Peilung: Ihr Friberg kino, gemanaget von einem weiblichen Dreierkollektiv, steht und läuft gut in Balestrand, im südwestlichen Norwegen am Esefjord, einem Arm des Sognefjordes, der wiederum mit mehr als 200 Kilometern und mehr als 1300 Metern des zerklüfteten Landes längsten und tiefsten Meeresarm darstellt. Besonders eindrucksvoll wird die vor allem beim Blick von oben hinunter schwindelerregende Ecke auf den Gemälden von Eilert Adelsteen Normann. Der in Nordnorwegen geborene Künstler war der erste aus dieser zu seiner Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch sehr abgelegenen Weltgegend, der sich als Maler etablierte. Mit 23 Jahren ging er an die Kunstakademie in Düsseldorf. Seine Bilder lockten die ersten Touristen an den Sognefjord, wo Normann sich 1890 eine Villa errichtete und als Pionier Balestrand zum Künstlerdorf machte.
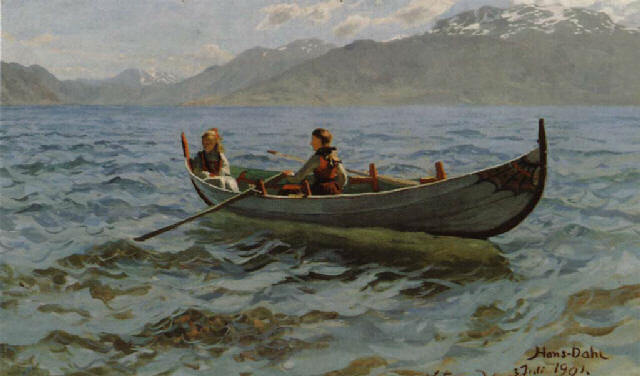
Sognefjord, Hans Dahl
Wie die Bilder aus dem deutschen Bundesarchiv zeigen, wurde es auch im Ausland berühmt, vor allem als der Landschafts- und Genremaler Hans Dahl seinem Kollegen folgte und sich dort eine Villa im von 1880 bis 1910 im Norden populären Drachenstil errichten ließ. Dahl wiederum war mit Kaiser-Wilhelm II befreundet, der wiederum in dessen Villa auf einem dragestol (Drachenstuhl) saß als er die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges erhielt. So ist es auf dem Stuhl vermerkt.

Der Drachenstuhl in der Villa Landschafts- und Genremalers Hans Dahl in Balestrand am Sognefjord, auf dem Kaiser-Wilhelm II saß, als er vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges erfuhr
Von 1840 bis 1935 war in Norwegen auch der sveitserstil (Schweizerstil) angesagt. In diesem Stil errichtete man 1913 in Balestrand Norwegens damals größtes Holzhaus, das Kviknes Hotel. Auch davon hat das Bundesarchiv ein prima Foto.

Kviknes Hotel, 1913 in Balestrand errichtet, damals Norwegens größtes Holzhaus, Bundesarchiv
Auch die örtliche Jugend begann zu bauen. Balestrands Ungdomslag (Jugendvereinigung/ -gesellschaft) errichtete ein Versammlungshaus, in dem ab 1920 lokale spelman (Musiker) für Tourist*innen spielten. Dann kamen der Zweite Weltkrieg und die extrem zerstörerischen Invasoren aus Deutschland. Gleich nach Ende dieses Krieges strebten die jungen Balestrander nach einer kulturellen und politischen Gegenbewegung und ernannten einen Filmbeauftragten. Der örtliche Arbeiterverband (arbeidsmandsforbundet) sah das von den Jungen geplante Kino nicht nur als Ort der Unterhaltung – am liebsten auf einem höheren Niveau als die bisherigen Reisekinos -, sondern auch als Antrieb für persönliche Entwicklung an und steuerte technische Ausrüstung bei. Fehlte nur noch die Konzession.
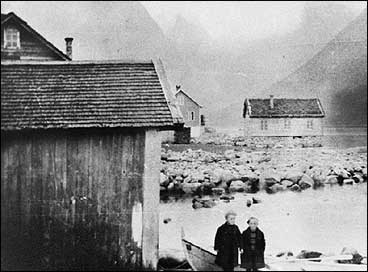
Balestrands von der Ungdomslag (Jugendvereinigung/ -gesellschaft) in den 1920ern errichtetes Versammlungshaus
Gar nicht so einfach. Ein Pastor und Propst half kräftig nach, das ist besonders bemerkenswert, weil die vorherrschende und auch herrschende evangelisch-lutherische Kirche den Film als per se sündig ansah und befürchtete, das Kino könne die Jugend vom „Wort des Herren“ abbringen. Aber dieser Pastor und Propst war ein radikaler Linker und mit seinem Segen wurde 1950 das Kino in Balestrand eröffnet. Mit dem von Asta Nielsen produzierten und in der männlichen Hauptrolle gespielten Film „Hamlet“.
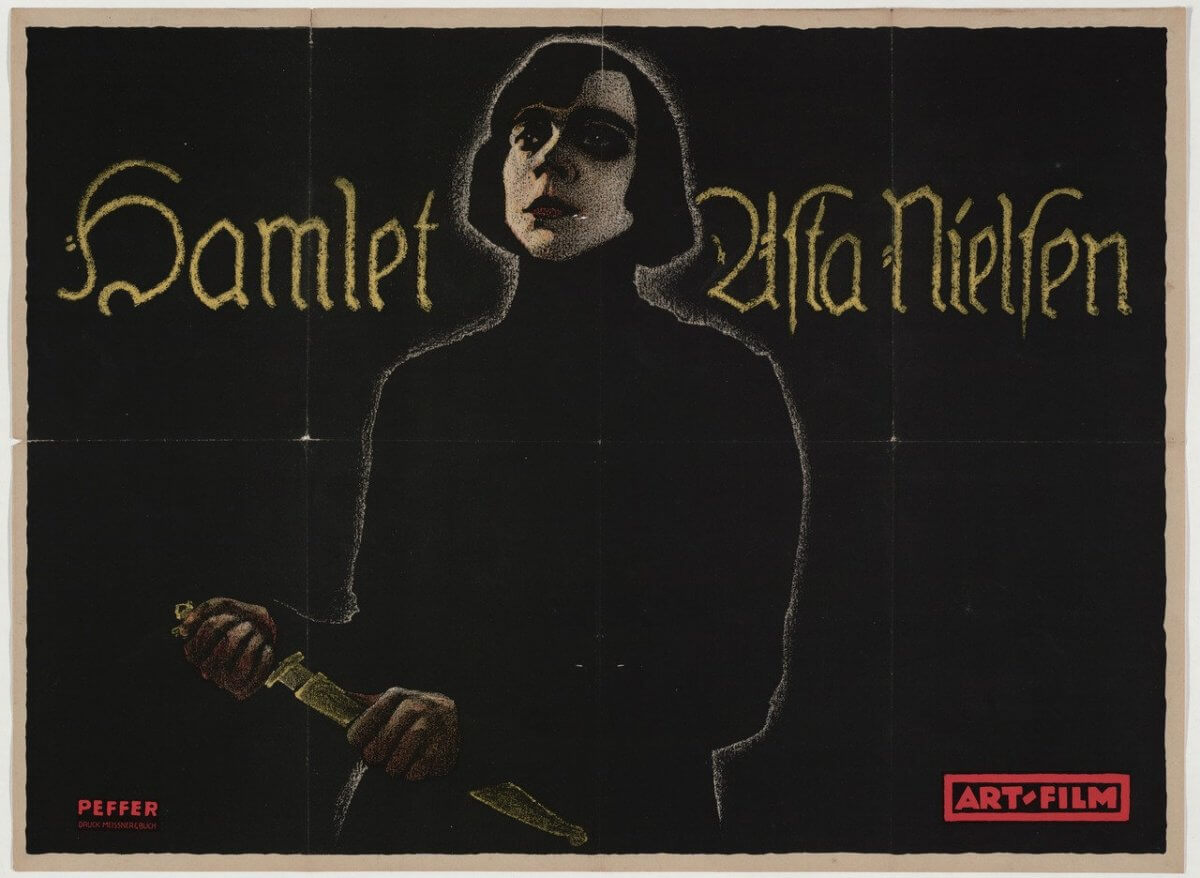
Kinoplakat für den Stummfilm Hamlet, um 1920, Druck von Meissner und Buch, Leipzig, im Besitz des Museum of Modern Art (MomA)
Als das heutige Friberg kino 1957 in ein größeres Gebäude umzog, ging Marianne schon zur Schule, und vielleicht auch ins Kino. Später dann, ab 1985, übernahm sie mit zwei weiteren Frauen freiwillig die Organisation ihres Lieblings-Lichtspielhauses. Marianne hat noch die großen Filmrollen geschleppt. Und hat sich auch im Norsk filmforbundet, einer sehr streitbaren Organisation, die sich vor allem um die Arbeitsbedingungen in der Filmindustrie kümmert, ab 2010 intensiv um die Digitalisierung der kleinen Kinos gekümmert. Norwegen sei das erste Land der Welt gewesen, wo alle Kinos digitalisiert waren. Das spart den Frauen in Balestrand jede Menge Büroarbeit.
Süße Sonnenklöße oder Spontanes Journeying
Aber nun widmen Marianne und ich uns weiteren gemeinsamen Leidenschaften. Ich fand in ihr nicht nur eine erfahrene Kino-Spezialistin, auch, zum ersten Mal auf meinen Reisen durch dieses Leben eine in meinem Alter, die ungefähr so reist wie ich. Unsere Schilderungen vom Pfade- und Unterkünfte-Finden als Spontis überschlugen sich. „We are travellers“, fasst sie die von uns beiden seit einer Handvoll Jahrzehnten praktizierte absolute Spontaneität zusammen, die uns an den seltsamsten Orten zu Schlafplätzen und tiefen Gesprächen verhilft.

Die Gebäckstücke des Tages heißen Solboller (Sonnenwecken/-klöße), begehe dieses Ritual pünktlich um 12 Uhr im Amtmanden mit Marianne Hoff, eine von drei Kinochefinnen im Friberg kino in Balestrand am Sognefjord
Wir zwei reisen bei einer Tasse Kaffee mal kurz ums Weltchen und dann gibt es Berliner. Nein, das sind keine Berliner, das sind Solboller! Weil nämlich Soldagen ist! Das Datum dieses nordnorwegischen Feiertages variiert nach Breitengrad, die Leute in Longyearbyen müssen noch bis zum März warten, in dieser magischen blauen Dämmerung dort; und nach Geografie, in Tromsø muss die Sonne zum Ende der Polarnacht erstmal über den Berg kommen. Am 21. Januar soll sie planmäßig um 12 Uhr ihr Licht auf die Dächer der Stadt werfen. Wir beißen ins Symbol dieses sehr wichtigen Feiertages. Pünktlich um 12 Uhr. Sonnenstrahlen sind nicht zu sehen in der Cora Sandels gate vorm Amtmandens. Wir fangen trotzdem schon mal an mit dem Feiern und feiern neben der Sonne die erhellende Begegnung reisender Cineastinnen.

Blick aus dem Amtmanden am 21. Januar, Ortszeit 12:40, auf die nach der von mir verehrten Schriftstellerin benannten Cora Sandels gate: langsam wird es grau
Kaum haben Marianne und ich „på gjensyn“ gesagt, auf Wiedersehen, denn ich will unbedingt mal ins Friberg kino und zu Badestrands JazzFestival und ins riesige Holzhotel am tiefsten und längsten Fjord …, steht Tor Edvin Eliassen vor mir, der Kameramann, der mit einer ziemlich großen 35-Millimeter-Kamera Sisilie bei der Arbeit gefilmt hat, die junge Fischerin von den Lofoten, die ich am Vortag interviewt hatte.

Tor Edvin Eliassen, der Kameramann, der für die Doku Havfrue/The Mermaid mit einer ziemlich großen 35-Millimeter-Kamera Sisilie, die junge Fischerin von den Lofoten, an Bord bei der Arbeit gefilmt hat
Vor allem sei es um Vater und Tochter gegangen, erzählt Tor, darum, wie Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und er beschreibt mir, wie er seine riesige analoge Kamera auf dem ziemlich kleinen Fischkutter verstaut hat, um physische Arbeit mit einem physischen Format aufzunehmen. Im Gegensatz zu Marianne schwärmt Tore von allerletzten analogen Kinos wie dem Verdensteatret. Und vom Filmen auf dem schaukelnden Boot, wo der Vater sein Wissen an die nächste Generation weiterreicht. Er fand es total passend. Das analoge Filmen sei schon etwas ganz Spezielles, zumal eine Filmrolle 2500 Kronen koste. Er bleibt speziell und macht weiter auf 35 Millimeter. Wie schön! Ich beschließe spontan, mich am späten Abend dieses Soldagen für die Last-Minute-Tickets einzureihen, um sein Werk zu besichtigen. Davon später. Viel später.

Soldagen, Ortszeit 14:05, bei Franciska und Florian sind Sonnen aufgegangen
Denn nun fällt an diesem Tag der Freude alles Weitere an die richtige Stelle: aus der Tasche meiner alten Strickjacke fällt Sandra Ingermanns alte CD mit deren getrommelter schamanischer Reiseleitung, die ich für Franciska und ihren Freund Florian (Flo) mitgebracht und verloren geglaubt hatte, und die beiden fallen im Amtmandens (ein amt- oder fylkesmann ist übrigens eine Art Regierungspräsident bzw. Kanzler, aber sojemand ist hier nicht in Sicht, wir lümmeln unregiert) aufs Sofa. Sie freuen sich über den Tonträger (sandraingermann.com: Shamanic Journeying: A Beginners Guide) einer wirklich Erfahrenen. Und Franciska trägt auf meiner intuitiv vorsorglich mitgebrachten Lofotenkarte (die mir ja kurz vor der Reise in Hamburg bei Goetze Land + Karte in die Hände gefallen war) das Bunkerprojekt (siehe auch unser Hamburger Bunkerprojekt kulturenergiebunker.de) eines Freundes bei Kabelvåg auf eben jener Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens ein.

In Kabelvåg auf den Lofoten haben im 12. Jahrhundert Øystein Magnussen Fischerhütten, im 20. Jahrhundert deutsche Nazis einen Bunker und im 21. Jahrhundert Franciska eine gut versteckte Erdhütte errichtet, Von Gerd Eichmann – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
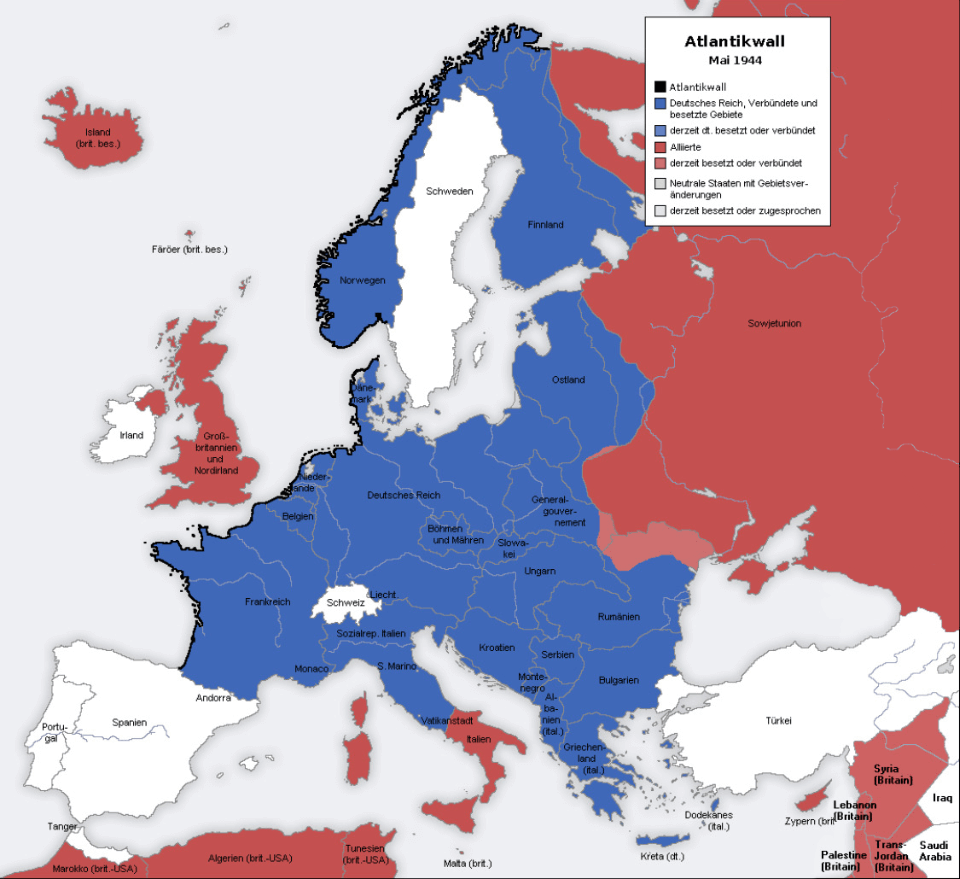
Atlantic_wall_may_1944_de, Verlauf des Atlantikwalls im Mai 1944, CC BY-SA 3.0
An der von Franciska auf meiner Lofotenkarte markierten Stelle haben im 12. Jahrhundert Øystein Magnussen, ein König der alten Art, dessen Macht von einer Thingversammlung in Zaum gehalten wurde, Fischerhütten und 800 Jahre später ein völlig ungebremster Herrscher ein Bollwerk gegen seine Feinde, die Anti-Hitler-Koalition, errichtet. Der Bunker in Kabelvåg war Teil eines von ihm geforderten und von anderen errichteten Festungswalles an den Küsten von Frankreich bis Norwegen. Franciska zeichnet mir auch die von ihr errichtete Erdhütte ein, die ich natürlich nicht poste:).
Florian schiebt mir ein Buch über Bodenmikrobiologie über den Tisch: Teaming with Microbes (Jeff Lowenfels: The Organic Gardener’s Guide to the Soil Food Web). Er hat von der Kunst in die Landwirtschaft gewechselt, zum Glück, denn was erfordert mehr Kunst und Können als in diesen rein ausbeuterischen Zeiten wieder eine fruchtbare Zusammenarbeit mit nichtmenschlichen Wesen zu starten?
Laurens schreibt nebenbei eine Laudatio für die Gewinner*innen des diesjährigen TIFF-Friedenspreises, sie haben eine Dokumentation über ein Massaker in Palästina 1948 gemacht, ein gut vertuschtes.

Filmemacher und Juror Laurens Pérol am Soldagen im Amtmanden
Sie zerren alles ans Licht – Kameramann Tor und seine Crew interviewen jetzt Zeugen des Zweiten Weltkrieges in der Umgebung von Oslo – und das ist gut so. Wir müssen in die schwarzen Löcher steigen und die hinterlassenen Probleme gemeinsam anstarren, alle lebenden Generationen. In all der Düsternis fällt auf den watteweichen Polstern eine junge Frau Laurens versehentlich auf den Schoß, er wechselt auf ein anderes Sofa. So kommt Suniva, Franciskas Ex-Mitbewohnerin aus Oslo, Performance-Künstlerin, die wie Franciska auch bei unseren Ahninnen andocken möchte; und wie meine Lieblingspiratin Peggy (https://peggymerkur.blog), mit der ich sie mit digitalem Seefrauenknoten verbunden habe, die Weltmeere im Zeichen des Wandels zu one ocean besegeln möchte, neben mir zu sitzen. Wir spinnen Performerinnen- und Seefrauengarn für eine lange kurzweilige Weile und dann folge ich fürs Besorgen von Gastgeschenken für die WG Laurens´ Tipp: Einkaufszentrum Nerstranda.

Terminal von Hurtigruten und Lichter von Tromsdalen, dem Stadtteil am anderen Ufer, Ortszeit 21. Januar, 18:09
So komme ich nochmal am Vertshuset Skarven am Strandtorget (Strandmarkt) vorbei, wo ich erst vor zwei Tagen, die mir wie Monate vorkommen, mit Geir und Herbjorg über einer Fischsuppe über Fischereipoitik sprach, fotografiere leicht verschwommen das Terminal von Hurtigruten und die Lichter von Tromsdalen, dem Stadtteil am anderen Ufer; und taste mich, knapp nördlich der Halle mit dem Robbenfänger MS Polstjerna, des Polaria akvarium, des Norsk Polarinstitutt und des Framsenteret, die ich allesamt nicht besichtigt habe, auf die Mole hinaus, die völlig dunkel und menschenleer einen guten Viertelkilometer in den Tromsøsundet ragt. Kurze Ortsbestimmung: Der Sund trennt die Innenstadt vom Festland, der Wind kommt vom Nordpol und fegt mir das Gehirn frei. „mindblowing.“, schreibe ich später in der Ølhallen, zu der es von hier gar nicht weit ist, „the wind is in from nordpole. Und ich hab ihn mir draußen auf der Mole, ganz allein, im Dunkeln um die Nase blasen lassen, während ein großer Dampfer wendete.“

Macks ølbryggeri og mineralvannsfabrikk wurde 1877 von Ludwig Markus Mack, dem Sohn eines Bäckers aus Braunschweig, der auf Wanderschaft nach Tromsø kam, dort blieb und eine Norwegerin heiratete, gegründet.
Ergänze in Sachen Trinkhalle aus zunehmender Schwärmerei heraus noch, dass L. Macks ølbryggeri og mineralvannsfabrikk 1877 von Ludwig Markus Mack, dem Sohn eines Bäckers aus Braunschweig, der auf Wanderschaft nach Tromsø kam, dort blieb und eine Norwegerin heiratete, gegründet wurde; und dass meine derzeitiger Lieblingsbierkeller, würde ihn am liebsten mitnehmen, der nördlichste der Welt ist, und – für Norwegen früh – bereits um 12 Uhr den Ausschank von mehr als 70 norwegischen Biersorten öffnet.

Die werden nach deutschem Reinheitsgebot (die erste Sorte war 1878 Bayerøl und der Hopfen dazu kam und kommt aus Bayern und Tschechien) nach Pilsner Art gebraut; mit Fjellwasser. Fjell heißt Berg, und so ein Gebirgsquellwasser wie das von Ráneš, wie die Insel nicht weit nördlich von Tromsø auf Nordsamisch, Ringvassøya, wie sie auf Norwegisch heißt, mit ihrem Soltindan, der das Nordpolarmeer um gut 1000 Meter überragt, gibt es wohl weder in Bayern, noch in Pilsen. Seit ihrer Eröffnung galt diese Trinkhalle in Tromsø als Treffpunkt für Walfänger und Polarforscher, heute treffen sich dort alle. Sie spielen Brettspiele und Karten und lachen sich kaputt. Ich trinke alkoholfreies Bier namens Isbjørn, futtere Chips und mach mir so meine Notizen.

Ernähre mich an diesem Tag ausschließlich von Bier, Sandwiches, Hotdog, Chips und Schokolade und gebe irre viele Kronen dafür aus. Sie fließen nur so aus meiner Karte. Das ist es mir wert. I will make ends meet.

Mørketidettermiddag, Dunkelzeitnachmittag, sehr früher Nachmittag in Tromsø in der dunklen Zeit (mørketiden), Av Osopolar – Eget verk, CC BY-SA 3.0
Dann eile ich zum FOKUS 4 und reihe mich, inzwischen routiniert, in die norwegisch tiefenentspannte Reihe für die Rush-Tickets für die FFN-Shorts 1 ein. FFN, das ist diese von mir favorisierte und von …. kuratierte Reihe film fra nord und die Kurzfilme sind deren absolute Highlights. Soviel Durchblick und Rundblick in Sachen Arktik gibts wohl sonst nirgendwo.
Eilif Bremer Landsends Doku über Havfrue (Meer-/Seefrau) Sisilie holt uns ein pralles Netz voll Zauber an Deck. Sisilie hat das Handwerk von klein auf von ihrem Vater gelernt, trägt sein Gesicht als Tätowierung, und er hat ihr gerade samt überwiegend ohne Worte vermittelter Fertigkeiten den Fischkutter weitergegeben. Das Nordpolarmeer befreit sie nach eigenen Angaben täglich von sämtlichen Problemen mit Hyperaktivität und anderem Störenden (oft ADHS genannt). Als Kapitänin findet Sisilie ihren Fokus und strotzt von Kompetenz und Temperament, das konnten wir TIFF-Besucher*innen gut erkennen. Wir waren ja dank Tor Edvin Eliassens 35-Millimeter-Kamera hautnah und quasi aus dem Sessel zupackend dabei.

Kameramann Tor Edvin Eliassen beim NUFF, Norsk Ungdom Film Festival, einem seit 2003 jährlich stattfindenden Kurzfilmfestival samt Workshops für U26-Filmleute aus dem Norden und dem Rest der Welt
Aleksander Huser vom NORDNORSK FILMSENTER (nnfs.no) hat das Film-Porträt über die junge Fischerin, diesen kurzen und eindringlichen Bericht von der Übergabe eines Bootes und Betriebes auf die nächste Generation, ebenfalls gesehen und Sisilies „påfallende sterk dokumentarfilmkarakter“, ihren auffallend starken Dokumentarfilm-Charakter entdeckt.
Der finnische Kurzfilm „Lakana – The Blanket“ handelt, wie so viel in der Gegenwartskunst von der nordeuropäischen Halbinsel Fennoskandia, vom Leben und Sterben im Zweiten Weltkrieg. Hier geht es ums Überleben der zehnjährigen Marja, die sich selber aufmunternde Lieder singt und beim Fliegerangriff auf dem zugefrorenen See mit einem Laken (lakana) tarnt. Ich komme im heißen Juni 2023, wo ich über die drei Kriege schreibe, die damals auf finnischem Boden ausgetragen werden nachforsche und herausfinde, dass der historische Spielfilm wohl im sogenannten Winterkrieg spielt, den Finnland 1939/40 mit der Sowjetunion ausficht, von einer in die Vergangenheit und in die Zukunft weisenden Lesung mit der Publizistin und Schriftstellerin Daniela Dahn: „Im Krieg verlieren auch die Sieger“. Egal auf wessen Seite sie sich schlagen… Finnland schlägt sich gerade auf die Seite der Organisation des Nordatlantikvertrags, der finnische Regisseur Teppo Airaksinen auf die der Schwächsten, Dahn schreibt: „Nur der Frieden kann gewonnen werden!“ Und ich weiß als Enkelin einer Überlebenden mehrerer Kriege: er muss!

Im FOKUS folgt in der Nacht des Soldagen, des lokalen Tages der Sonne, nun eine Animation mit Bildern der Inuk Germaine Arnattaujuq (Arnaktauyok). Inuk ist die Einzahl des Wortes Inuit. So nennt sich die Bevölkerung, die auf dem Gebiet des heutigen Kanada lebte, sehr lange vor dessen Eroberung und Kolonisierung und die darauf folgende Staatsgründung durch Europäer*innen. Seit 2000 Jahren leben sie dort wo Arnattaujuq 1947 geboren wird, in der Region von Igluilk, das bedeutet: Platz der Schneehäuser, im westlich von Grönland gelegenenen Territorium ᓄᓇᕗᑦ Nunavut. Das bedeutet unser Heimatland/beziehungsweise unser Land und zu diesem Lebensraum haben die Inuit in diesen langen Zeiträumen eine enge emotionale, wirtschaftliche und spirituelle Bindung.
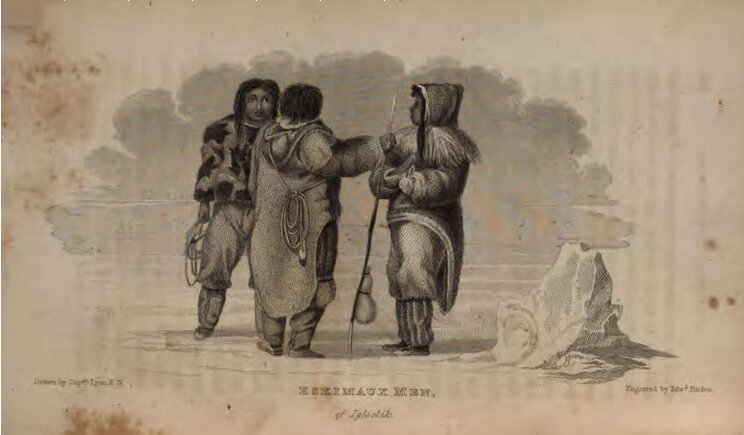
Einwohner*innen von Igluilk
Die Schöpfungs- und Naturgeschichte ihres Gebietes wurde mündlich, genauer singend, weitergegeben, und mit dem Animationsfilm Arctic Song möchte Arnattaujuq dieses alte Wissen mit künftigen Generationen teilen. Und ich möchte die bildende Künstlerin dringend mit meiner TIFF2023-Auszeichnung würdigen: mostly female – mostly brave – mostly fantastic! Auch, weil Arnattaujuq mit Mitte 70 sagt, sie habe gezeichnet, seit sie klein war, habe das nie in Frage gestellt und einfach weitergemacht. „I´m still on it.“
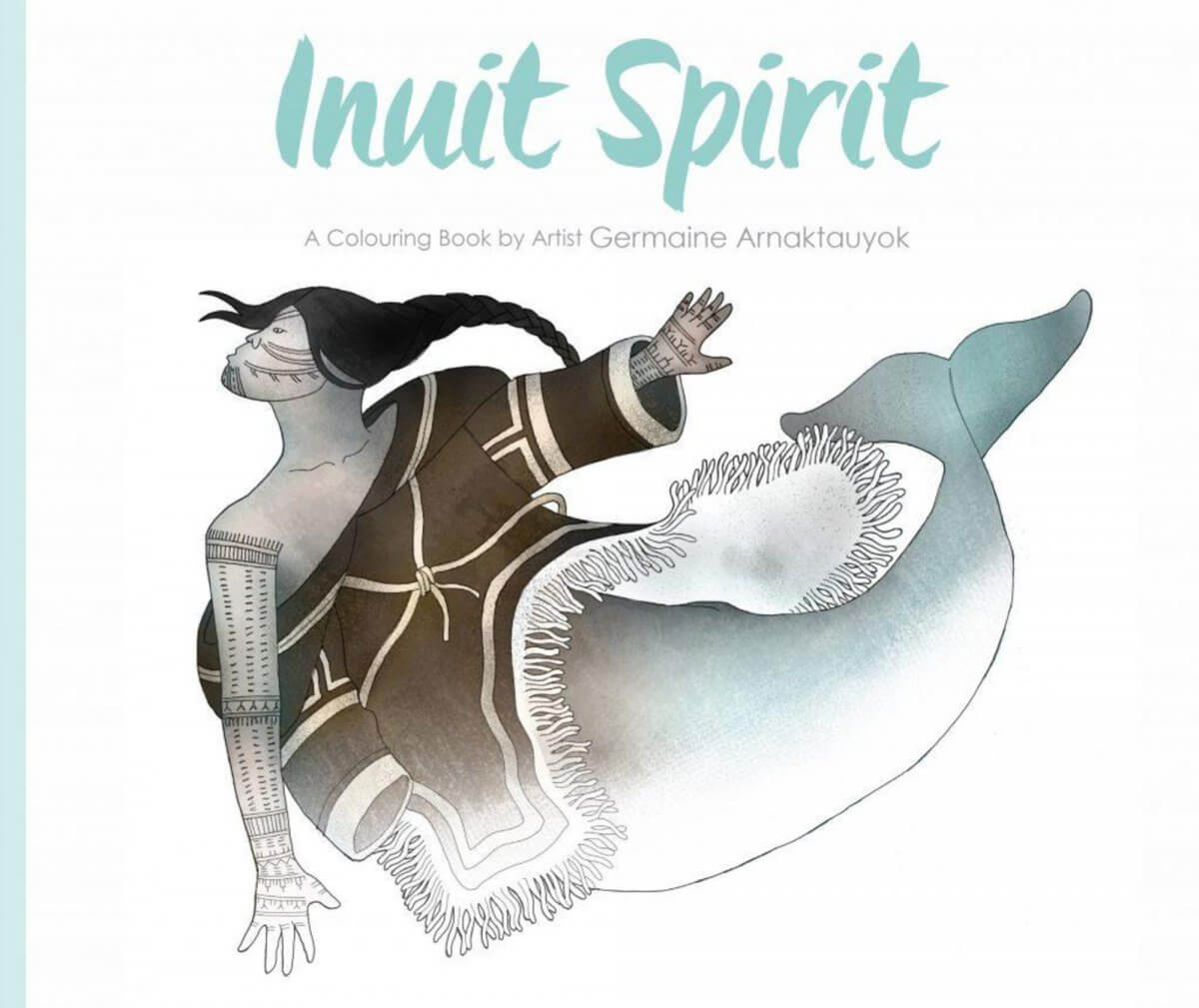
Und schon folgen die nächsten Heldinnen der Arktis: Die Frauen, die im 20. Jahrhundert die Ausdauer, Stärke, Beharrlichkeit und Geduld hatten, um in der Tundra, der offenen baumfreien Kältesteppe, mit den Rentieren zu leben, würdigt die samische Regisseurin Inga Elin Marakatt. Ihr an japanische Horrorfilme angelehntes Drehbuch zu Unborn Biru basiert auf Traditionen und Mythen der Sámi und ist von einer wahren Geschichte inspiriert. „Ich kann die Geschichte nicht ändern, aber der Welt von uns erzählen“, sagt Marakatt. Und trägt ebenfalls den Award „mostly female – mostly brave – mostly fantastic!“.

Der fünfte Kurzfilm schlägt sich mit Walrosszähnen in mein visuelles Gedächtnis – für alle Zeit. Wie dieser russische Wissenschaftler in einer abgelegenen Gegend, die scheinbar keinerlei menschliche Einflüsse zeigt, Ausschau hält. Wie sie ihm nahe rücken und doch gar nicht bedrohlich sind, viel mehr die Bedrohten. Wie er per Walky Talky ein dem Tode geweihtes soeben verwaistes Walrosskalb meldet. Und es seinem vom Menschen gemachten Schicksal überlassen muss. Jede Kuh gebärt nur ein Kalb und das ist sechs Monate lang auf Muttermilch angewiesen.

Выход heißt der Film von Evgenia Arbugaeva und Maxim Arbugaev, das bedeutet Auszug oder Austreten. Der internationale Titel Haulout bezieht sich aufs Hauling-out, ein Verhalten der Walrösser, die zu bestimmten Zeiten das Wasser verlassen.
Wir haben ihren Lebensraum ruiniert! Das geht mir nun nicht mehr aus dem Sinn und ich entscheide mich aufs Neue für radikale Ökologie, außerparlamentarische Opposition und Deep Green Resistance: A world where biodiversity is rising, dead zones are shrinking, and land-based cultures grounded in human rights and a sustainable relationship with the planet arise and flourish. Выход heißt der Film von Evgenia Arbugaeva und Maxim Arbugaev, das bedeutet Auszug oder Austreten. Der internationale Titel Haulout bezieht sich aufs Hauling-out, ein Verhalten der Pinnipedia, der Robben oder Flossenfüßer, zu denen auch Odobenus rosmarus, das Walross gehört. Unter anderem zum Ausruhen und zum Gebären der Jungen verlassen sie das Wasser. Walrösser brauchen Meereisschollen und suchen, um ihre Jungen zu gebären, das Land auf. Der Strand um Chakilevs extrem einsame Hütte in Tschukotka, dem Autonomen Kreis der Tschuktschen (Чукотский автономный округ/ Tschukotski awtonomny okrug, Чукоткакэн автономныкэн округ) füllt sich jedes Jahr im Herbst mit Walrössern. Das Jahr, in dem Arbugaeva und ihr Bruder begleiten 2020 den russischen Wissenschaftler Maxim Chakilev bei seinen Feldforschungen an der Chukchi-See (Чуко́тское мо́ре, Chukótskoye móre), wo er jedes Jahr am Cape Serdtse-Kamen (мыс Сердце-Камень, Kap Herzstein) das Leben der Walrösser beobachtet. Dieses Jahr, 2020, ist eines der grauenvollen Rekorde: der arktische Ozean wärmt sich zu Rekordtemperaturen auf und die Zahl der Tiere, die dicht an dicht auf dem Strand liegen, und sich gegenseitig erdrücken – ein Walrossbulle wiegt 1200 Kilogramm – ist so hoch wie nie zuvor. Dreimal konnten die drei entsetzten Beobachter*innen die Hütte für eine Woche nicht verlassen, sie war von Walrössern umzingelt. Chakilev meldet sehr traurig, dass die Zahl der Toten am Kap Serdtse-Kamen jedes Jahr steigt, die globale Erwärmung, die um die Pole herum besonders rasant erfolgt, lässt ihre Refugien auf See schmelzen. Gezwungenermaßen ziehen immer mehr Walrösser in der sibirischen Arktik von den Schollen, die für sie die Welt bedeuten, aufs Land, was für sie den Untergang bedeutet. Und mir wird soeben klar, dass Fotografin Arbugaeva, deren hinreißende Fotos ich nur drei zuvor im Perspektivet museum bewundert habe – большо́й спаси́бо!!! – diejenige ist, der wir diesen nahezu niederschmetternden Dokumentarfilm verdanken.

Eine Walrosskuh und ihr Kalb in der Herde, die im Zuge des Halout, Haling-out das Wasser verlassen hat, By Ansgar Walk – Own work, CC BY-SA 3.0
Versuche, bei der TIFF CLOSING PARTY im Storgata Camping wieder Fuß zu fassen und laufe in Clara hinein, die dort ihren 24. Geburtstag feiert. Wir futtern Pizza, sprechen über gewolltes Alleinsein, tanzen. Auf der Bühne tobt Ella Marie Hætta Isaksens Band ISÁK, sie joikt sich und uns die Seele aus dem Leib und wieder hinein. TIFF-Pressefrau Anne gesellt sich mit ihrer Lebensgefährtin zu mir, wir plaudern über queere Communities hier und dort; dann gerate ich an einen jungen Veganer, der mich fürs Fleischessen rügt, sich aber nicht fürs Fliegen. Womit wir mal wieder bei der vermeidbaren lateralen Aggression wären, von der Deep Green Resistance Aktivistin (Buchtitel auf Deutsch: DEEP GREEN RESISTANCE – Strategien zur Rettung des Planeten) Lierre Keith, geboren 1964 in den USA, Schriftstellerin, Kleinbäuerin, radikale Ökofeministin schreibt: „Wir müssen uns über den Individualismus erheben und in dem Wissen leben, dass wir die einzigen sind, die das Potential im Menschen für das Gute gegen das zerstörerische Machtstreben von Kapitalismus, Patriarchat und Industrialisierung verteidigen werden.“ Sie zitiert Dichterin Adrienne Rich: „Ohne Zärtlichkeit sind wir in der Hölle.“ Wir müssten Möglichkeiten finden, trotz Uneinigkeiten eine ernsthafte – ergänze: so zärtliche wie zielstrebige – Bewegung aufzubauen und unbedingt aus der Geschichte lernen! Eine Kultur, die um individualistische Erfahrung aufgebaut sei, könne den Planeten nicht retten. Also lasse ich den einen oder anderen fliegen:) und auch mal etwas links oder rechts liegen, erinnere mich stattdessen an meinen Schwur, mich für den Erhalt dieses traumhaften Planeten auf meine Weise einzusetzen, den ich auf einer Solo-Skitour über die Hardangervidda geleistet habe, und konzentriere mich auf die Belange der Walrösser, enorm energetisiert durch Ellas Joik, der noch nach Monaten in mir tönt.

Isák auf der DnB-Bühne in Grefsenkollen am 20. June 2018 in Oslo. Lineup: Ella Marie Hætta Isaksen (vocal) Daniel Eriksen (producer) Aleksander Kostopoulos (drums), Von Tore Sætre – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Margareta, die im italienischen Bologna Film-Masterclasses betreut und bei Laurens´ Film Solo un pomodoro/Just a tomato mitgewirkt hat; Laurens und ich versuchen, den Bus 34 zu bekommen, der hat sich aber schon in Tromsøs Zentrum mit Feiernden vollgeladen und fährt vorbei. Wir bilden eine kleine Straßenbande und kapern ein Taxi, rollen auf dem Strandvegen zur Sydspissen, zur Südspitze, lassen die Telegrafbukta, die Telegrafenbucht mit ihrem Badestrand (!) links liegen, bewegen uns langsam und sicher auf dem Kvaløyvegen, dem Walinselweg, Richtung Sandnes-Sundet, der diese Insel, die mir gerade mindestens die Welt bedeutet, von der Walinsel und dem Nordpolarmeer trennt, am Stadtteil namens Sorgenfrei vorbei, quatschen über Parties und Filme. Hell wird es draußen an diesem Morgen noch lange nicht, aber in mir schon.
trauere Sonntag, den 22. – 14:16 arktiske universitetsmuseum –
vorher frühstücke ich mit Eirin und Laurens auf dem WG-Sofa. Und dann backt Eirin Brot und es erschallt ein Küchenzuruf: „Solen kommer!“ Und tatsächlich steigt die Sonne jenseits des großen Terrassenfensters und jenseits des von der Kuppe der Insel aus unsichtbaren Tromsøysundet so gegen 12:00 über die Berge am Festland. Heute ist Solsøndag. An den Sunden flanieren flanieren sportlich gekleidete Tromsøer*innen, im Norges arktiske universitetsmuseum (http://uit.no/tmu) sind Familienaktivitäten und Waffeln angesagt. Vorm Waffelessen gerate ich an den Exponaten der Nordlichtforschung vorbei, die in vielen Farben glühen, in die Abteilung: SÁPMI – EN NASJON BLIR TIL.

Auf dem Weg zu Norges arktiske universitetsmuseum, Ortszeit Solsøndag, 14:02
Im Jahr 1930 gaben 61% von Norwegens Bevölkerung an, nicht norwegisch zu sein, das hieß Samen oder Kväner. Nahezu zwei Drittel von Norwegens Anwohnern sind zwischen 1930 und 1950 aus der Statistik verschwunden. In zwanzig Jahren war der landesweite Anteil nichtnorwegischer Bevölkerung auf nahezu Null reduziert. Der Grund ist Schweigen.
In der Gemeinde Kvænangen (nordsamisch Návuona suohkan) in Romsa (Troms), nicht sehr weit östlich von Tromsø, gaben 1930 fast 900 Personen, knapp drei Viertel der Einwohner, an, Sámi zu sein, fast ein Fünftel bezeichnete sich als Kvenen. Im Jahr 1950 war der Anteil der offiziell nicht norwegischen Bevölkerung mit sieben Personen unter die 1%-Marke gerutscht. Das heimische „urfolk“ war aus den Volkszählungen schweigend verschwunden. Im Zuge der Norwegisierung.
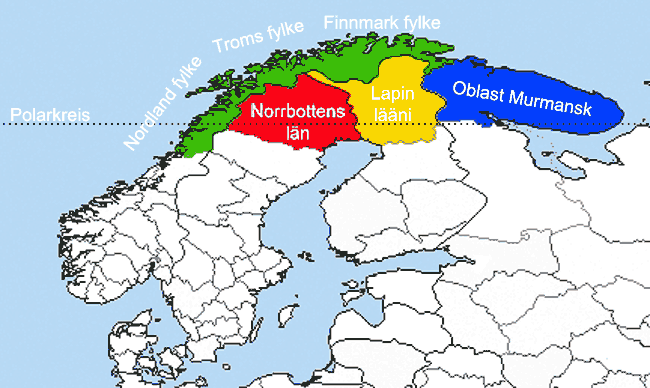
Die Nordkalotte erstreckt sich nördlich des Polarkreises und umfasst auch einen großen Teil der Halbinsel Kola
Die Kväner, Kvenen oder Kvänen nennen sich kväänit oder lantalaiset und wurden 1998 als nationale Minderheit in Norwegen anerkannt. Die Finn*innen sagen kveenit, lantalaiset oder lappilaiset, die Nordsamen kveanat oder láddelaččat. „Kvener har levd på nordkalotten i uminnelige tider“, berichtet wikipedia.no; dieses Volk habe seit undenklichen Zeiten, auf der Nordkalotte gelebt, die die heutigen norwegischen Provinzen Nordland, Troms und Finnmark; die schwedische Provinz Norbottens län und die finnische Provinz Lapin lääni umfasst. Der begnadete Kartograf Olaus Magnus hat das Land der Kvenen in seiner „Seekarte und Beschreibung der nordischen Länder und deren Wunder, sorgfältig ausgeführt im Jahr des Herrn 1539“ als Berkara Qvenar eingezeichnet, ein Stück nordöstlich der Lofoten, samt Elchgespann. Ich habe das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Kvenen (laut wikipedia.no) mit dem Zug durchfahren, von Boden kommend, das nahezu am Bottnischen Meerbusen liegt, über Kiruna, durch die interkulturelle Kulturregion Tornedalen am langen See Torneträsk entlang bis nach Narvik, am Nordpolarmeer.
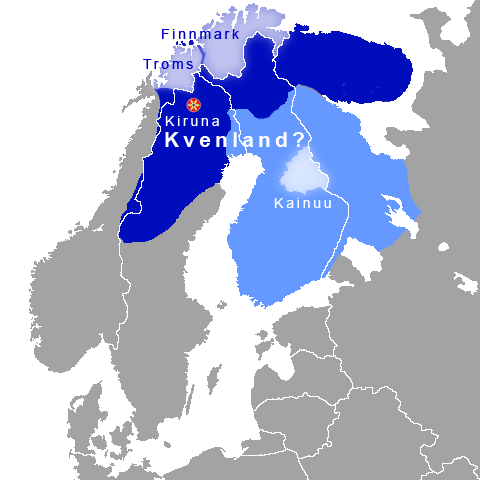
Lokalisierungsbemühungen fürs Kvenland innerhalb des gesamten ehemaligen Siedlungsgebiets der Samen (dunkelblau) und der gegenwärtigen Gebiete der Finnen (hellblau, einschließlich Karelier), Von Roxanna
Auf der Karte „EUROPE at the death of Charles the Great 814“ (untere Karte) ist das Quaenland, das Siedlungsgebiet der Kvenen, am Nordende der Ostsee eingezeichnet. Und ich lokalisiere an deren Südende mein eigenes Urvolk (Eigenbezeichnung *Prūsai, eingedeutscht Prußen oder Pruzzen). Es gehört zu den BALTIC TRIBES, den baltischen Stämmen und wird auf der englischsprachigen Karte Pruzzi genannt. Da die *Prūsai – so lautet die Eigenbezeichnung, aber da die Sprache meiner Vorfahren ausgestorben ist , weiß ich nicht, wie eine sie ausspricht – von den vom Westen sie überrollenden Kreuzrittern brutal geschrieben quasi ausgerottet wurden und nun von allen Landkarten verschwunden sind, verbindet mich tiefstes Mitgefühl und höchste Solidarität mit allen Indigenen. Und mein Interesse an der europäischen Zwangschristianisierung und Kolonialisation kennt keine Grenzen.
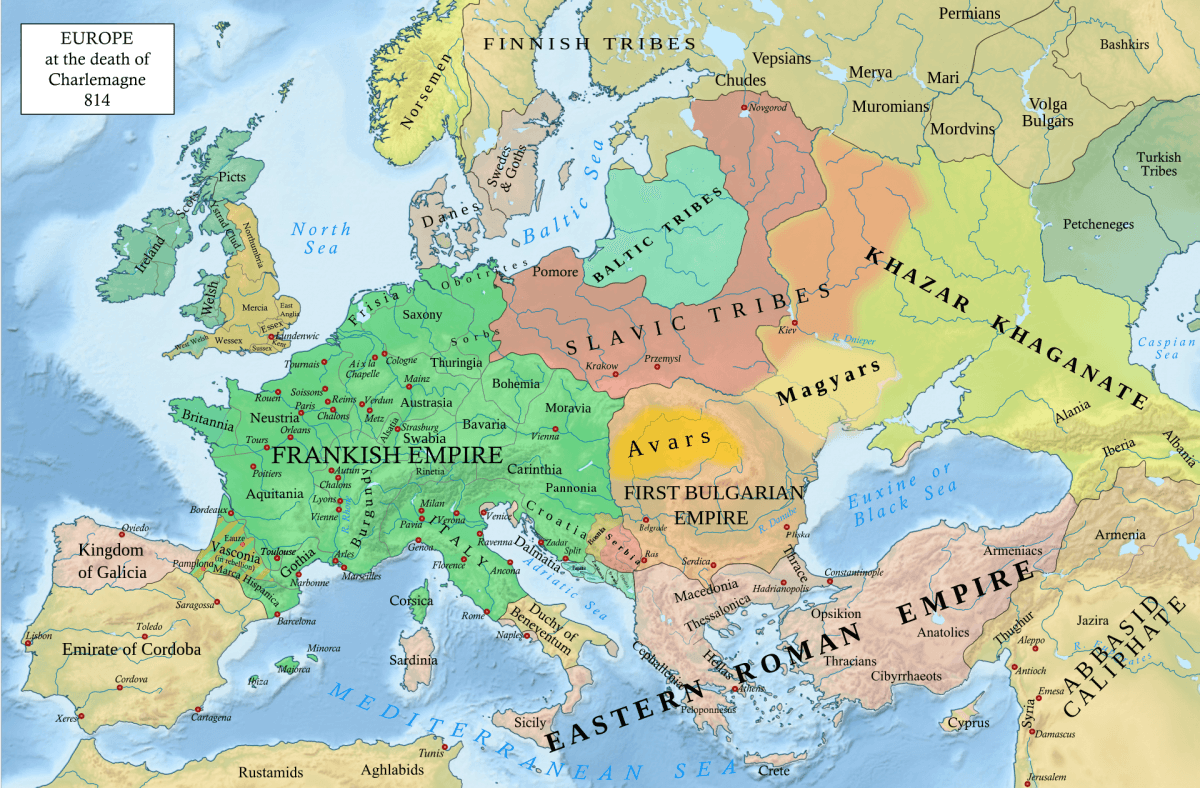
Europa, Ortszeit 814, Norsemen = Wikinger, Finnisch Tribes = Sámi und Kvenen , Baltic Tribes = Kuren, Letten, Litauer, Galinder, Jatwinger, Prußen, Schalauer
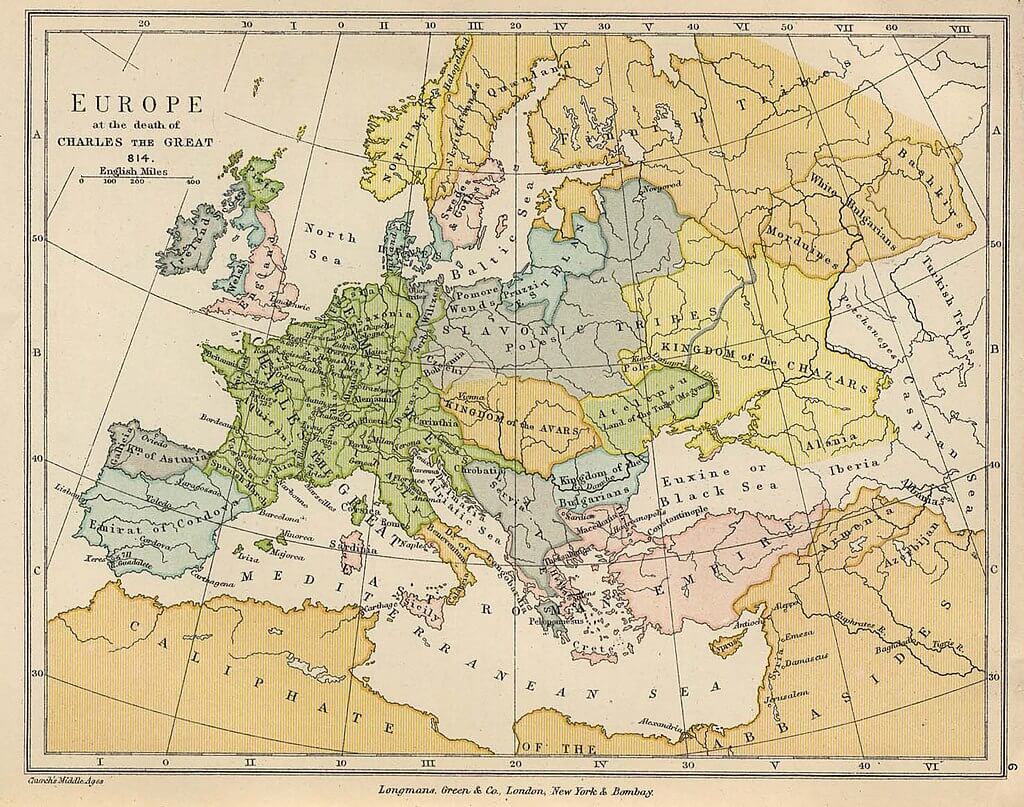
Europa, Ortszeit 814, von Westen: Northmen = Wikinger (mit ihrem Halogaland), Skvithfinnas (?), Quaenland, Finnish Tribes = Sámi. Neben Halogaland, dem „sagahaften“ sind hier zu meine Vorfahren, die Pruzzi = Prußen zu entdecken .
Im Quaenland waren die klimatischen und sonstigen Bedingungen nicht wesentlich anders als auf der übrigen Nordkalotte. In Ostseenähe wohl etwas milder als gen Polarmeer. Daher unterschieden sich die Lebensgewohnheiten der Kvenen wenig von denen der Sámi. Vielleicht war man und frau ein wenig finnischer? Auf jeden Fall war das Schwitzbad beliebt.

Vor dieser kvenischen Sauna steht ein Rentier mit Schlitten. Neiden/Finnmark, 1890er-Jahre

Die Kvenen, die Fischerei betreiben, wurden auf Norwegisch Fiskekvæner genannt, das Foto machte Axel Lindahl 1892 an der Küste der Finnmark

Im Landesinneren betrieben auch die Kvenen Rentierzucht
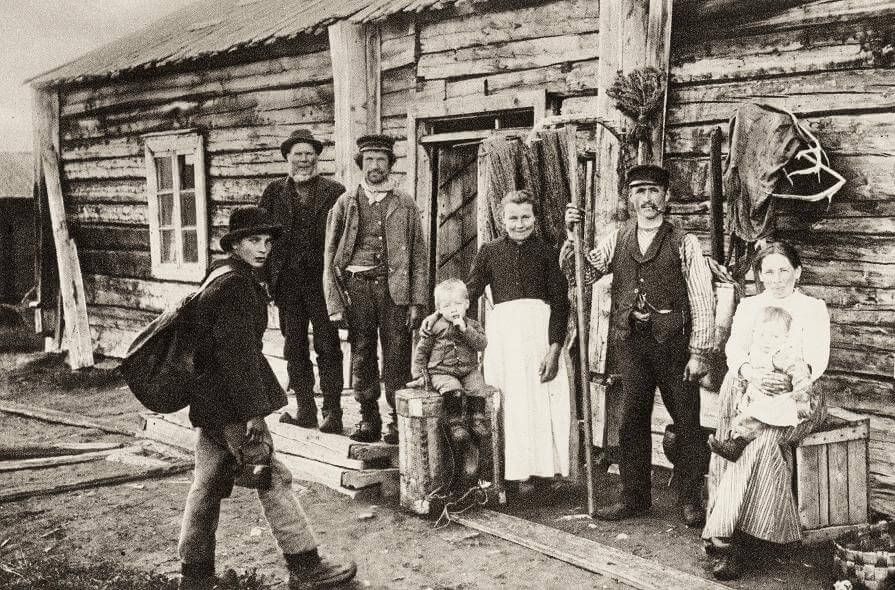
Dieses Foto entstand 1926 in Kurravaara. So heißt der Ort auf Meänkieli (Meänkieli heißt wörtlich übersetzt „unsere Sprache“, Tornedalfinnisch, tornedalsfinska oder tornionlaaksonsuomi und ist ein finnischer Dialekt, der im Tal Tornedalen gesprochen wird und in Schweden als nationale Minderheitensprache anerkannt ist) und Schwedisch, auf Nordsamisch heißt er Gurravárri und ist ein Småort, Kleinort. Dieser schwedische Begriff bezeichnet eine Ansammlung von Gebäuden mit 50 bis 199 Einwohnern und einer maximalen Entfernung von 150 Metern zwischen den Häusern. Dieser Kleinort liegt im Tornetal etwa 12 km nordnordöstlich von Kiruna, in einer Einbuchtung des verbreiterten Torne älv auch Torneälv oder Torneälven (schwedisch) bzw. Tornionjoki (finnisch) genannt, dem 410 Kilometer langen Abfluss des Sees Torneträsk (siehe weiter oben in den Texten). Borg Mesch

Womit wir bei jemandem wären, dessen Bilder die Urvölker der Nordkalotte in ganz anderem Licht zeigen, Borg Mesch wurde 1869 in Schweden geboren und war als Fotograf vorwiegend im Land der Kväänit und Sámi tätig.
Die samischen Stämme siedeln auf der unteren Europakarte Stand 814 quer über drei Längengrade in einem Gürtel, der das heutige Finnland umfasst und übers heutige Archangelsk hinausreicht. Erst seit den 1960ern, von denen die oben genannte Ausstellung SÁPMI – EN NASJON BLIR TIL handelt, werden Sámi in Norwegen und anderswo mit ihrem Eigennamen angesprochen; zuvor als finne (Plural: finner), das geht auf das altnordische Wort finnr und das altdeutsche Wort fendr für Fußgänger zurück.

Und da es uns Ostseeleute samt Kväänit, *Prūsai und Sámi einander kulturell näher bringt – wie wir es auch damals 1990 auf der ersten Internationalen Ostseekonferenz der Meeresschützer*innen in Lettland zelebrierten – gibt es jetzt noch die dezent nach vermoderndem Seetang an Sommertagen duftende Karte von Baltoskandia. „We are all one“, wie ein russischer Bekannter betont.
Proteste gegen die Norwegisierung, die den Kväänit (Kvenen) und der Urbevölkerung der Sámi unter anderem ihre eigene Sprache verbot, und ihre nomadische Lebensweise einschränkte, hat es schon Ende des 19. Jahrhunderts gegeben. Die südsamische Rentier-Besitzerin, Managerin, Aktivistin und Politikerin Elsa Kristina Laula Renberg gibt 1904 die Kampfschrift „Infor lif eller död? Sanningsord i de Lappska förhållandena“ heraus. Sie fragt, ob die samische Gesellschaft (Lappska förhållandena) aufs Leben oder auf den Tod zuschreitet.
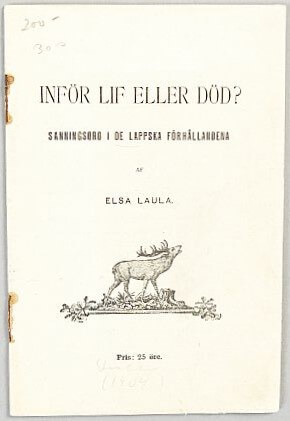

„Infor lif eller död? Sanningsord i de Lappska förhållandena“, die südsamische Rentier-Besitzerin, Managerin, Aktivistin und Politikerin Elsa Kristina Laula Renberg fragt 1904 in ihrer Kampfschrift, ob die samische Gesellschaft (Lappska förhållandena) aufs Leben oder auf den Tod zuschreitet.
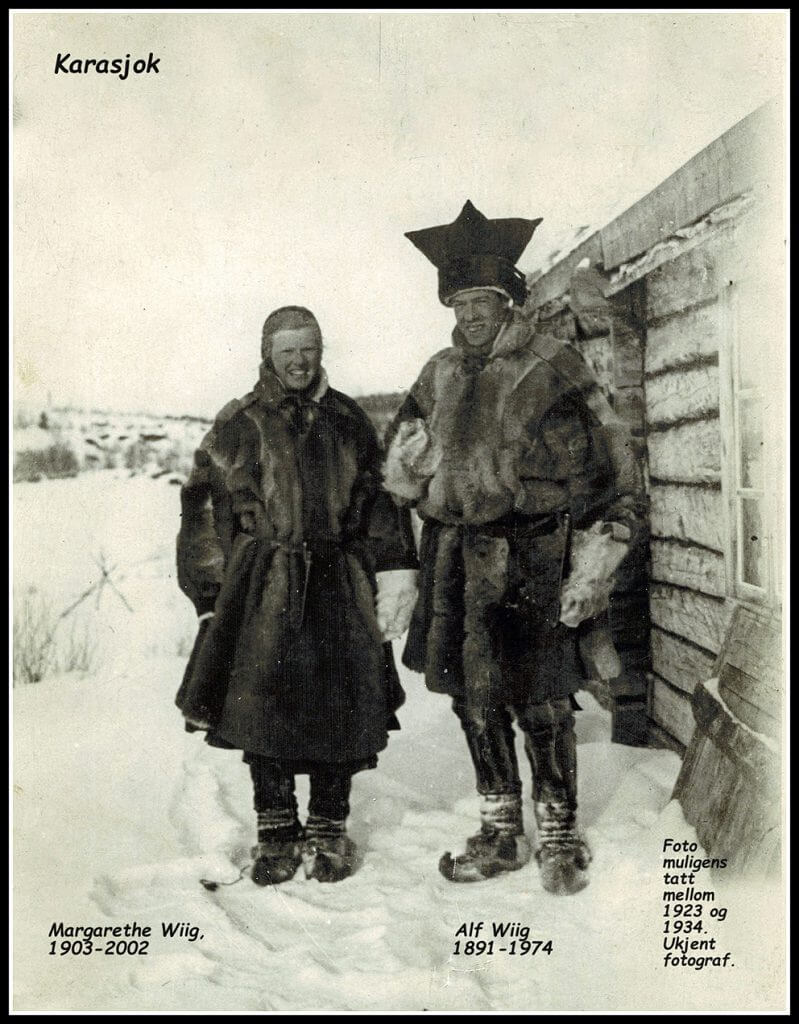
Zu jener Zeit gab Margarethe Wiig, eine Pastorenfrau aus der Kommune Karasjok auf dem Hochplateau Finnmarksvidda, in der zentralen Finnmark, dem Hauptsiedlungsgebiet der Samen, Bilderbücher für samische Kinder mit norwegischen Texten heraus, die deren Leben erstmals abbildeten.
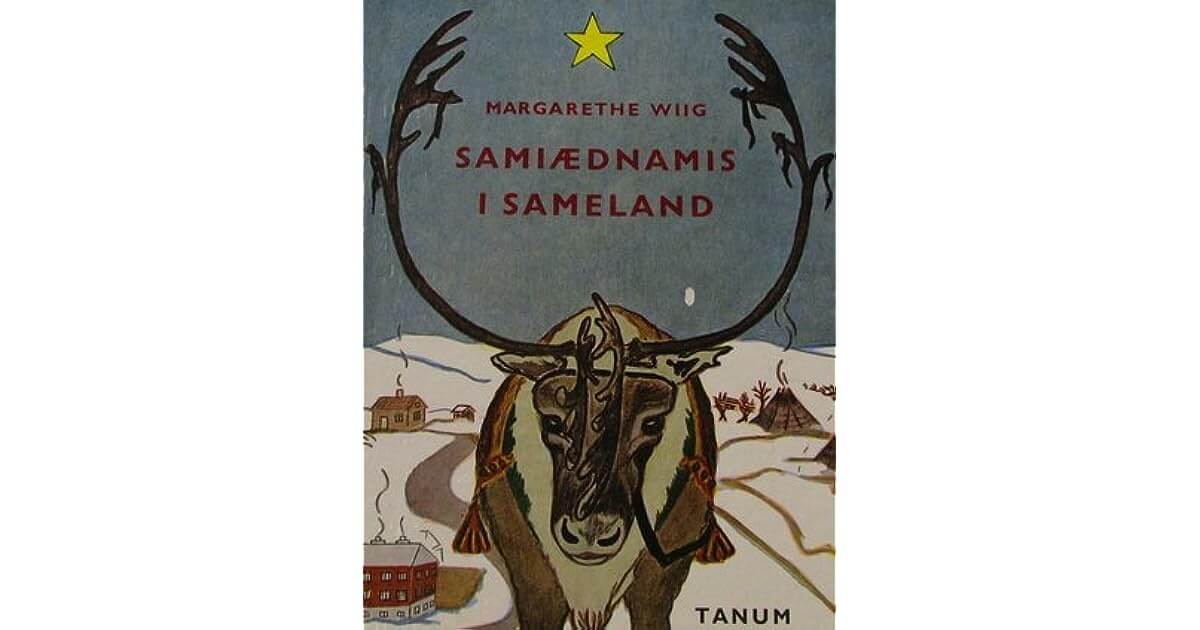
Die aktive norwegische Assimilierungspolitik, Fornorsking av samer, im Zuge derer die samischen Kinder in Schulen gehen mussten, die ausschließlich (auf) Norwegisch unterrichteten, erreichte in den 1950ern ihren Höhepunkt.
Auf das erste Kinderbuch auf Samisch musste die Community noch mehr als 20 Jahre warten. Da trat – female, fantastic, brave – meine Altersgenossin Marry Ailonieida Sombán Mari (früher auch: Marry Somby) auf den Plan. 1976 erschien ihr Bilderbuch „Ámmul ja alit oarbmælli“, Ammul und die blaue Cousine.
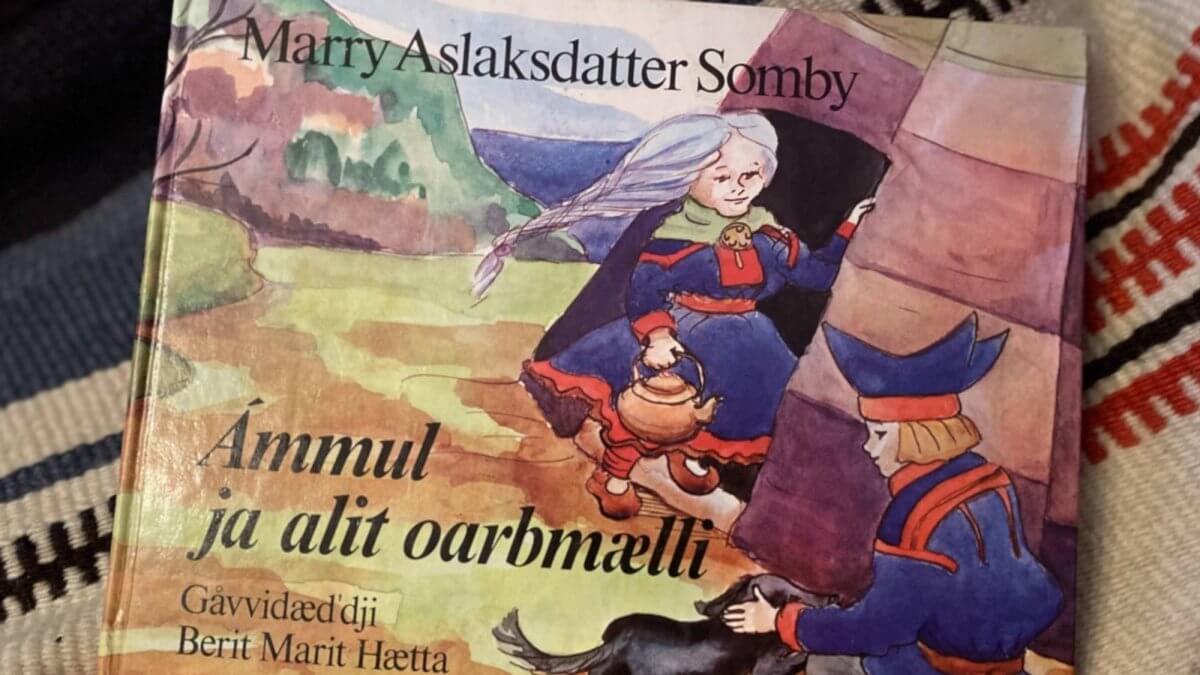

Das erste Kinderbuch in samischer Sprache gab 1976 Marry Ailonieida Sombán Mari (früher auch: Marry Somby) heraus.
Gerechte Rebellion oder Überholte Überlegenheitsideologie
An diesem Museums-Sonntag sehe und höre ich Mari Boines BLI MED MEG TIL DET HELLIG FJELLET – Vuolgge Mu Mielde Bassiv á rr á i – Come With Me to the Sacred Mountain. Allein die Musik zum Film reißt mich zum wiederholten Mal nahezu vom Schreibtischstuhl.

Kautokeino-opprøret/Die Rebellion von Kautokeino, historischer Spielfilm von Nils Gaup
Boine hat auch die Musik zu Kautokeino-opprøret/Die Rebellion von Kautokeino N/S/DK 2008 komponiert. Der historische Spielfilm des Sámi Nils Gaup zeigt die brutale Unterdrückung und Verfolgung – und die Stärken seines Volkes. Die Rentiersamen in der Region Guovdageaidnu (Kautokeino), wo Gaup 1955 geboren wurde, gerieten im 19. Jahrhundert durch andauernde norwegische Kolonialisierung und Bautätigkeit, die auch ihre Weidegebiete bedrohte, immer mehr unter Druck. Sie griffen Repräsentanten des norwegischem Staates und der norwegischen Kirche an, und den örtlichen Kaufmann, der Alkohol verkaufte und dabei samische Kunden betrog und ausbeutete. Alkoholismus verbreitete sich und zerstörte die jahrtausendealte samische Kultur. Regisseur Gaup stammt von einer der jungen Aufrührerinnen ab – Berit Hansdatter Gaup war damals 16 Jahre alt und wurde zu 12 Jahren Strafarbeit verurteilt – und erzählt die Geschichte dieser blutigen Auseinandersetzung wie sie noch nie zuvor erzählt worden ist.

Kautokeino-opprøret/Die Rebellion von Kautokeino, historischer Spielfilm von Nils Gaup
Und Monate später gucke ich nach: Nellejet Zordrager schreibt 1989 in ihrem Aufsatz „Der Kampf der Gerechten – Kautokeino 1852 – samischer Widerstand gegen norwegischen Kolonialismus“, dass dieser aus ihrer Sicht voraussehbar und verständlich gewesen wäre, dass seine Ursachen im niedrigen sozialen Status lägen, den die norwegische Überlegenheitsideologie den Samen zuwies. Den Aufruhr selbst könne eine*r den Aufrührer*innen nicht vorwerfen, nur mangelnde Strategie, schreibt die niederländische Sozialanthropologin. Und Ole Henrik Magga schreibt dort 2008 in der norwegischen Zeitung Klassekampen (Klassenkampf), dass sich diese Überlegenheitsideologie auch in späteren Zeiten gezeigt habe, beispielsweise daran, dass das Anatomische Institut der Universität Oslo die zur „Rassenforschung“ dorthin gebrachten Schädel der enthaupteten Aufständischen Aslak Jacobsen Hætta und Mons Somby bis 1997 behielt und sie so erst knapp eineinhalb Jahrhunderte nach dem Aufstand in Guovdageaidnu beerdigt werden konnten.

Kautokeino-opprøret/Die Rebellion von Kautokeino, historischer Spielfilm von Nils Gaup
Im Zentrum des ton- und bildgewaltigen Spielfilmes Kautokeino-opprøret steht Ellen Aslaksdatter Skum, geboren 1827. Als der Schwede Carl Johan Ruth 1844 die erste Zulassung zur Eröffnung von Gaststätte und Geschäft in Guovdageaidnu (Kautokeino) erhält, gerät die junge Frau mit dem von ihr und den anderen Aufständischen als Betrüger identifizierten Kaufmann aneinander. Im Zuge des Aufstandes wird Ruth ermordet. Skums Todesurteil wird später in lebenslange Strafarbeit im Zuchthaus Trondheim umgewandelt, und 1867 wird sie nach 13 Jahren Haft begnadigt.

Ánne Risten Juuso (finnisch Anni Kristiina Huuso) stellt im Film Kautokeino-opprøret die Rebellin dar.
Ánne Risten Juuso (finnisch Anni Kristiina Huuso) stellt im Film Kautokeino-opprøret die Rebellin dar. Die samische Schauspielerin kommt 1979 zur Welt, in Avvil (inarisamisch Avveel, skoltsamisch Âʹvvel, finnisch Ivalo), das wie alle anderen Ortschaften in sehr weiter Umgebung von der deutschen Wehrmacht vollständig niedergebrannt wurde. Dazu kommen wir gleich – unausweichlich lauern die Kriege hinter Bildern und Geschichten. Vorher reihe ich Juuso unbedingt in die Reihe „Mostly female – mostly brave – mostly fantastic“ ein! Habe sie das erste Mal im Winter 20/21 bewundert, als ich mir für mein Solo-Heimkino (Füße und Beamer auf dem Tisch, Boxen verkabelt) einige russische digitale vielseitige Scheiben (digital versatile discs) aus der Hamburger Zentralbücherei – wo jemand exquisit kuratiert! – ausgeliehen hatte, darunter einen Film aus dem Jahr 2002: Кукушка (Kuckuck) von Александр Владимирович Рогожкин (Alexander Wladimirowitsch Rogoschkin).
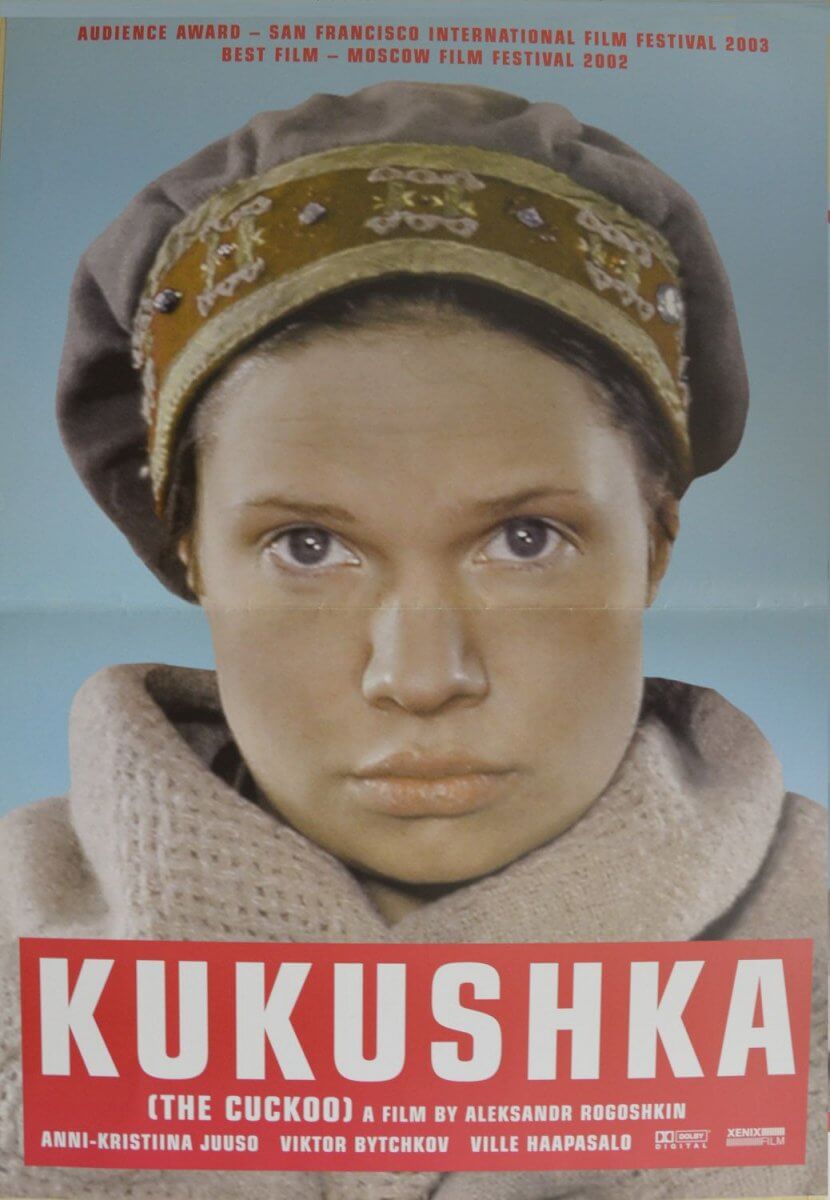
Darin stellt Juuso eine junge Sámi dar, Anni, auf deren Bauernhof in der Landschaft lappi, wie sie auf Finnisch, Лапландия Laplandija, wie sie auf Russisch heißt, kurz vorm Ende des Zweiten Weltkrieges zwei Soldaten stranden, ein Finne und ein Russe, die beiden haben keine gemeinsame Sprache. Als der friedliebende Finne dem Russen enthusiastisch das Kriegsende verkündet, interpretiert dieser das als Angriff und schießt ihn nieder. Anni ruft die Seele des tödlich Verletzten mit einem schamanischen Ritual ins Leben zurück. Giitu Ánne Risten! Cпаси́бо Александр Владимирович! Кукушка sei eine bezaubernde erotische Komödie, schreibt der Spiegel damals; das Lexikon des internationalen Films sieht darin ein politisches Antikriegsmärchen. Für mich geht es um um Schamanismus, der alle Grenzen überfliegt, sowie zerstörerischen Nationalismus.
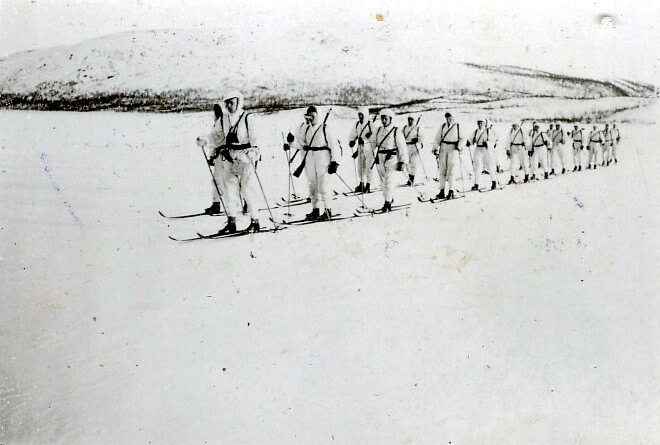
Finnische Skitruppen im Lapplandkrieg (1944/45)
Im Land der Samen kam es auch nach dem Krieg weiterhin zur Rebellionen. „Samer tier ikke lenger“ bedeutet, die Sámi beendeten ihr jahrhundertelanges Schweigen.
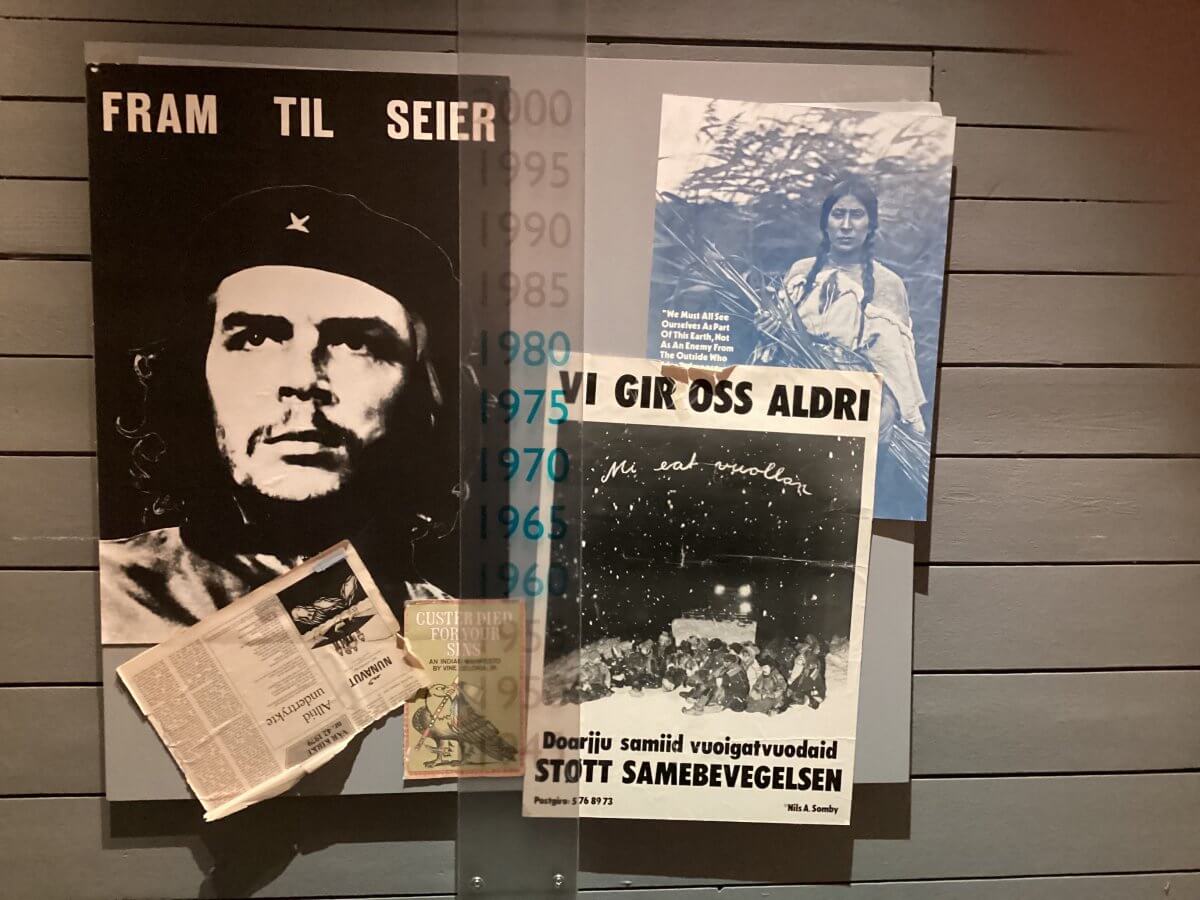
„Vorwärts zum Sieg“, „Wir geben nicht auf – Unterstütze die Sami-Bewegung“ lauteten die Parolen.

Die Samen schweigen nicht länger
Die große Karte zeigt, dass die Stadt Tromsø – wo 1980 das samische Parlament Sameting beschloss: „Wir Samen sind ein Volk, dessen Zusammengehörigkeit nicht durch Staatsgrenzen gespalten werden soll. Wir haben unsere eigene Geschichte, unsere Traditionen, eigene Kultur und unsere eigene Sprache. Von unseren Vorfahren haben wir das Recht auf Land und Wasser und unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten erworben. Es ist unser unveräußerliches Recht, unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und unsere Gemeinschaften in Übereinstimmung mit unseren Lebensbedingungen zu bewahren und zu entwickeln, und wir werden gemeinsam unsere Territorien, unsere Naturreichtümer und unser nationales Erbe für kommende Generationen bewahren.“ – nahezu mittig liegt in Sápmi, dieser Nation ohne nationale Grenzen, in der 50.000 Sámi leben.
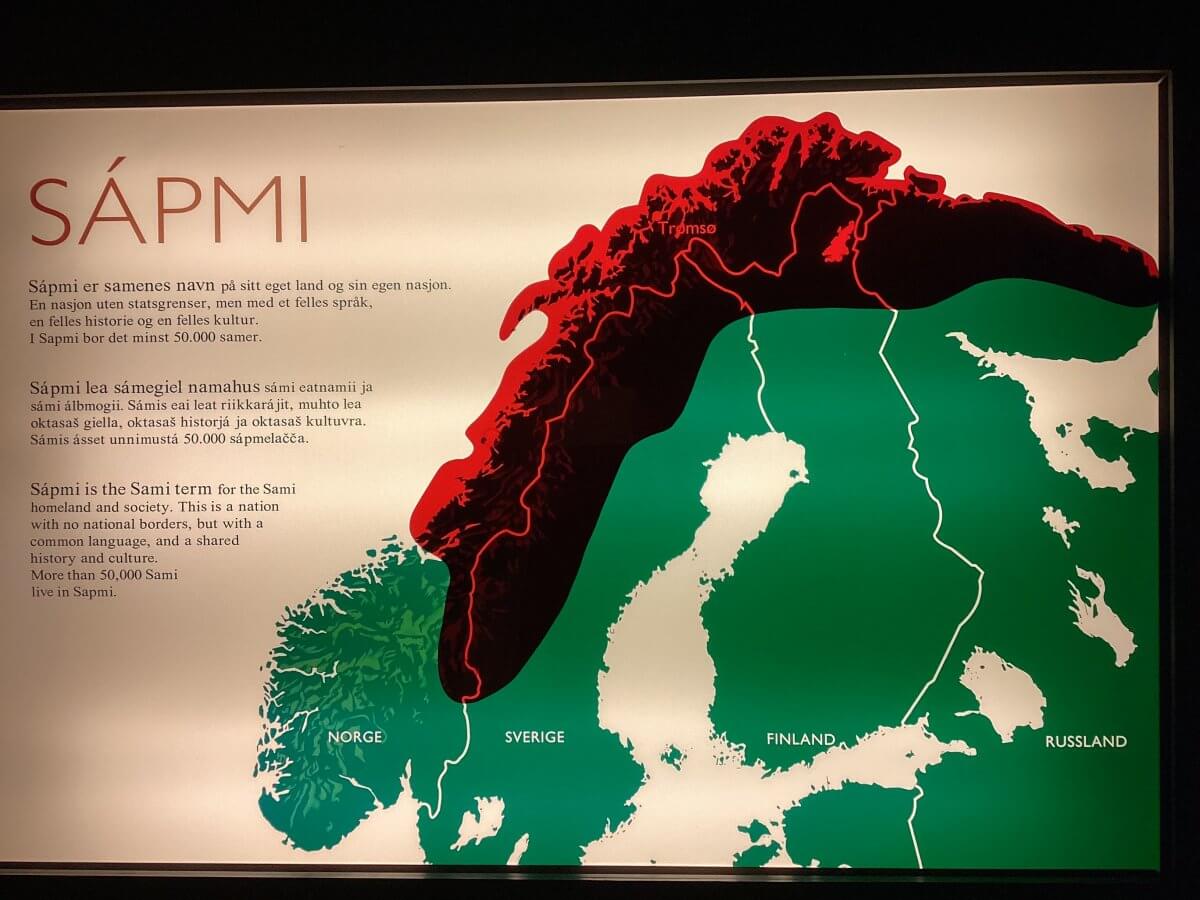
Auch in der Ausstellung des arktischen Universitätsmuseums geht es auch wieder um die Frage: Wer reguliert die Nutzung von Wasser und Land?
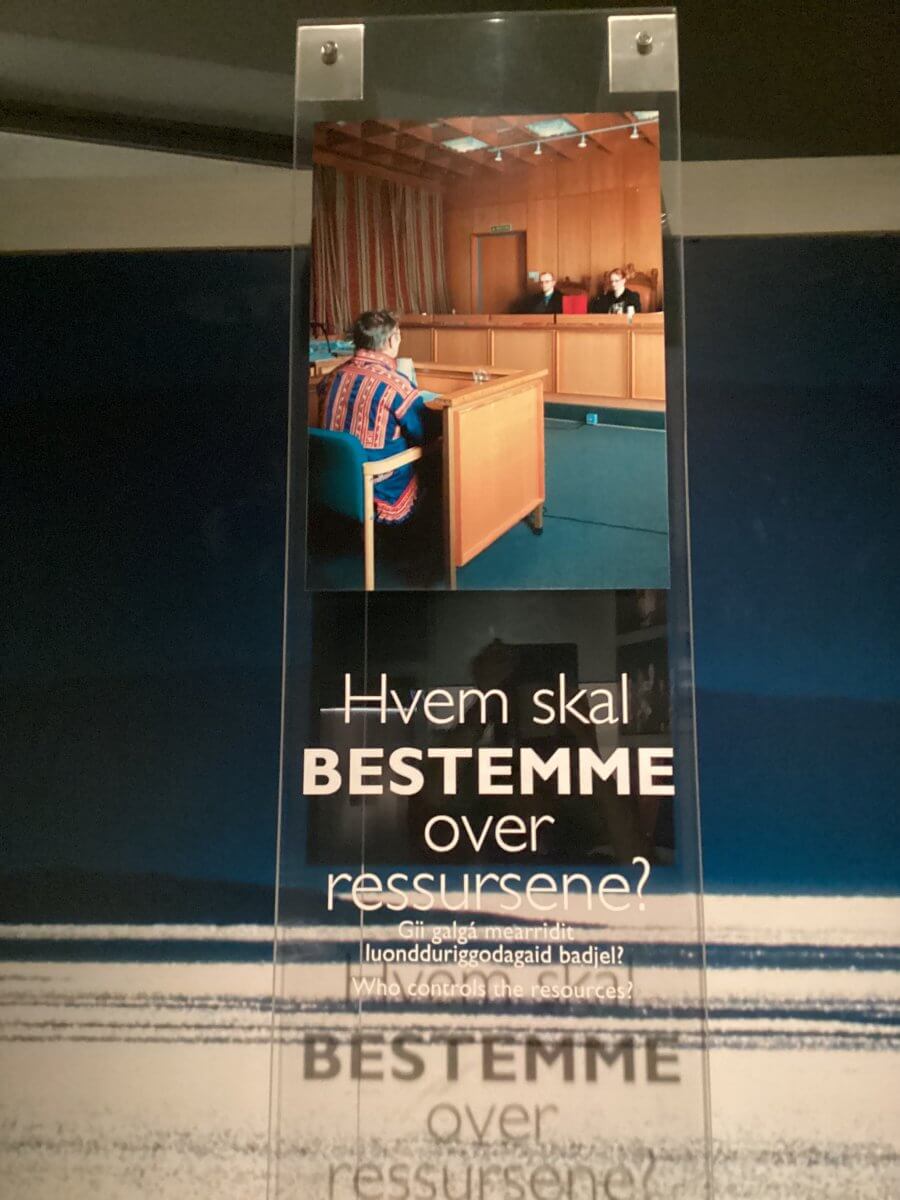
Wer bestimmt über die Ressourcen? Das Bild zeigt eine der vielen Gerichtsverhandlungen, in die Sámi zogen.

Hier geht es um die Bodenschätze. Ihre Claims in Sápmi abgesteckt haben Elkem, ein norwegischer Konzern, der u.a. in der Provinz Nordland Ferrosilicium für Elektronik u.a. produziert; Statskog, das staatliche Forstwirtschaftsunternehmen, dem bis zur Verabschiedung des Finnmark Aktes ein Drittel Norwegens gehörte (davon 80% oberhalb der Baumgrenze, wo es weniger um Holz als um Jagd und Tourismus geht), das 2005 im Rahmen dieser Gesetzesänderung, die den Sámi das durch fortgesetzte Nutzung von Land und Wasser erworbene Recht dazu einräumt (ausgeschlossen waren Bergbau, Meerwasser und Ölbohrungen), die Finnmark abgab, so dass es nun noch ein Fünftel des Landes ist, was Statskog verwaltet; ScanMining, diese schwedische Firma besitzt eine Goldmine in Sodankylä (nordsamisch Soađegilli), einer dünn besiedelten Gemeinde im dünn besiedelten finnischen Teil Zentrallapplands; Barents Stein AS, mit Hauptsitz in Tromsø, die sich um Naturstein bemüht.

Die Meeresnutzung blieb 2005 außen vor beim Finnmark Akt, das heißt, sie steht den samischen Küstenbewohnern, die seit Urzeiten auch im Nordpolarmeer fischen, nicht als fortgesetzt genutzte traditionelle Ressource zur Verfügung.
Unter den Bildern dieser Ausstellung springt mir das vom Urfolkfestival in der nordnorwegischen Kommune Gáivutna (Gáivuotna alias Kåfjord ist ein Nebenarm des Lyngenfjords) ins Auge, die seit mehr als 30 Jahren ein Austragungsort kultureller samischer Neuschöpfungen ist: Seit 1991findet dort, in der Ortschaft Olmàivággi nicht weit von Tromsø, jährlich Riddu Riđđu („kleiner Sturm an der Küste“; https://riddu.no/se) statt und feiert die Kulturen der Urvölker. Es beginnt genau heute (am 12. Juli 2023), als ich all dies recherchiere und beschreibe. Wünsche bestes Gelingen und beschließe, im kommenden Jahr hinzufahren, komme wer oder was wolle.
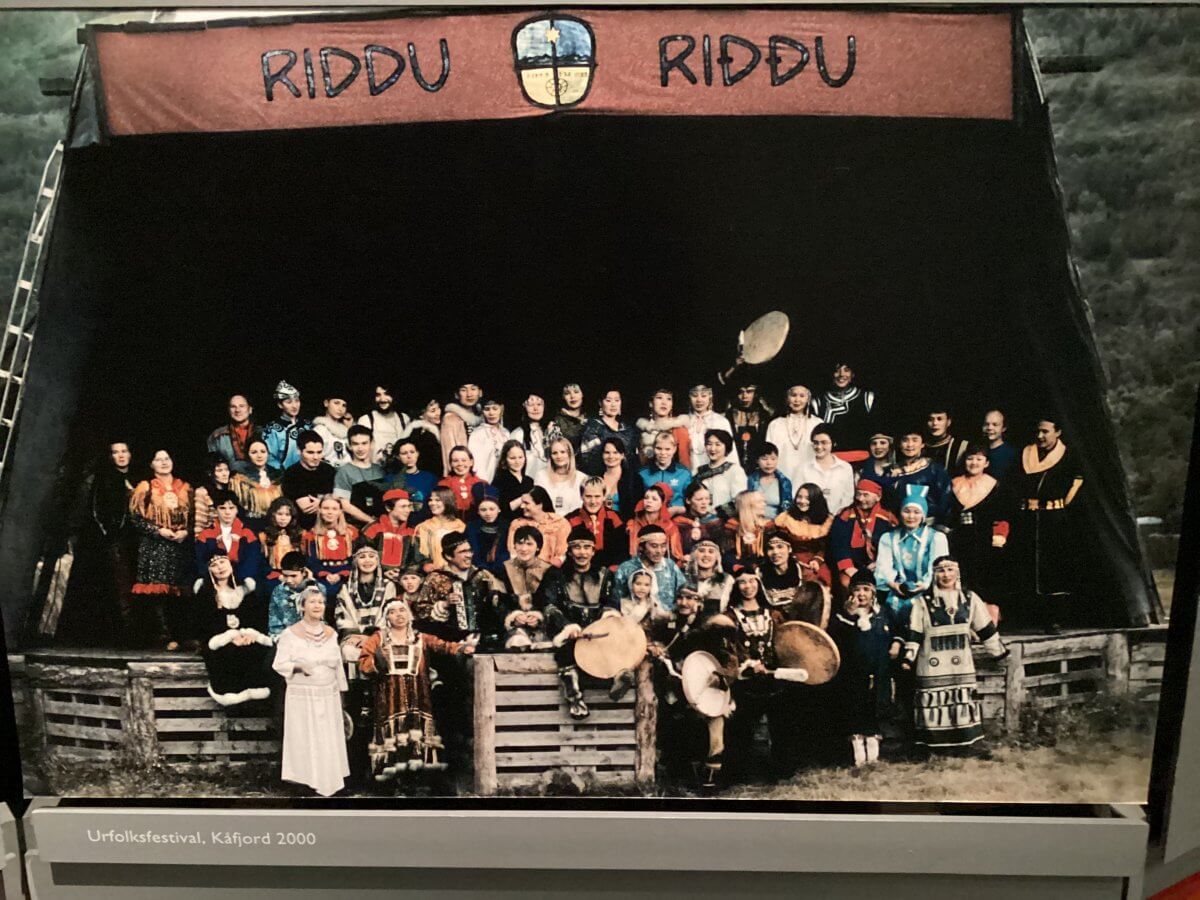
Urfolkfestival in der nordnorwegischen Kommune Gáivutna (Gáivuotna alias Kåfjord ist ein Nebenarm des Lyngenfjords), seit 1991 findet dort, in der Ortschaft Olmàivággi nicht weit von Tromsø, jährlich Riddu Riđđu („kleiner Sturm an der Küste“; https://riddu.no/se) statt und feiert die Kulturen der Urvölker.
Arktische Anarchistinnen oder Orthodoxe Operationen
„1945 buollán eanan“ übersetzt: 1945 verbrannte Erde, steht über der Landkarte im Arktischen Universitätsmuseum, auf der die damals noch nicht zusammengelegten Provinzen Romsa (norwegisch Troms) und Finnmárku (norwegisch Finnmark, ins Deutsche übersetzt: Land der Samen) zu sehen sind. Von der Grenze zur Sowjetunion im Osten bis zum Ivgovuotna (Lyngenfjord) in Troms steht diese arktische Region, in der damals drei Viertel der samischen Bevölkerung Norwegens lebte, in Flammen.
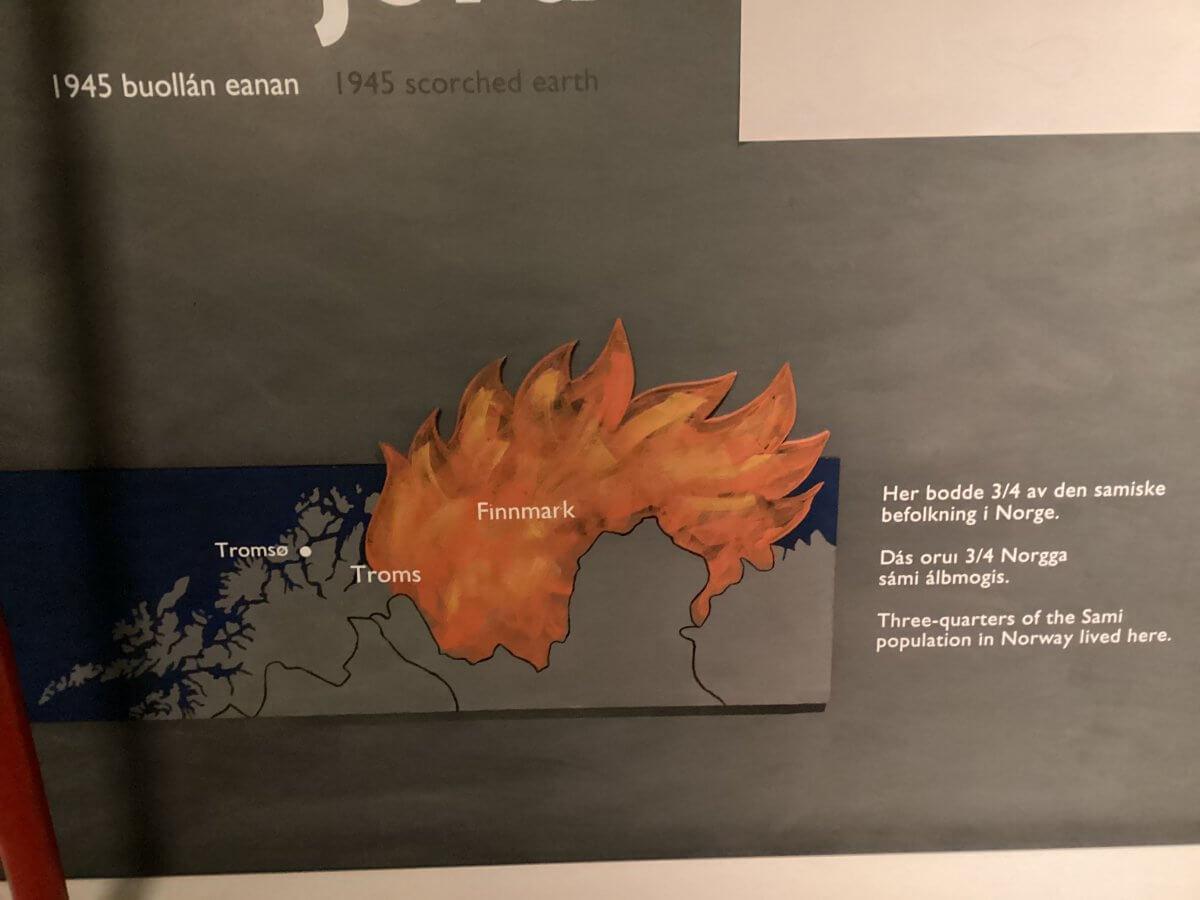
Von Deutschen verbrannte Erde in der Finnmark, wo 1945 drei Viertel von Norwegens samischer Bevölkerung lebte
In deutschen Quellen sind die Brandstifter bis heute gar nicht so leicht zu identifizieren. In der Schule, in den 1970er-Jahren, lernen wir über die Verbrechen deutscher Faschisten außerhalb der Arbeits- und Vernichtungslager praktisch nichts. Und so sind wir Hamburger Student*innen über den ausdrücklichen Widerwillens, der uns bei den ersten Norwegenexkursionen vor allem von Älteren entgegenschlug, verblüfft; hatten kaum eine Ahnung davon, was unsere Großeltern- und Elterngeneration im Norden Eurasiens und in Fennoskandinavien angerichtet hat. Bis heute findet eine in deutschen Quellen zuallererst gefühlte Desinformation über den deutschen „Rückzug“ aus Finnland, über Gebirgsjäger und ein „Unternehmen“ namens „Nordlicht“. Gebirgsjäger und Nordlicht hören sich idyllisch an, Rückzug liest sich dezent und defensiv.

Deutscher Gebirgsjäger in Norwegen 1942 (Wachtposten im Gebirge/Fjell), Deutsches Bundesarchiv
Auf dem tief verschneiten Schlachtfeld tritt damals unter anderem der Bayer Alfred Josef Ferdinand Jodl auf, als Führer des XIX. Gebirgskorps. In Sachen Gebirgsarmee, -jäger, -korps, -truppe erfahre ich, dass dies speziell für den Kampf in schwierigem Gelände und unter extremen klimatischen Bedingungen ausgebildete und ausgerüstete Streitkräfte seien; die im Zweiten Weltkrieg auch von der Deutschen Wehrmacht eingesetzt wurden; die sich „meist durch eine hohe militärische Effektivität“ auszeichneten; deren Einsatzgebiet vom tunesischen Bergland bis zur subpolaren Tundra von Russland, Finnland und Norwegen reichte; die eine Reihe von Kriegsverbrechen verübten. die erstreckten sich demnach über fast 40 Breitengrade, von der Sahara bis zum Nordkap.

Deutsche Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg (links Luftwaffe, rechts Gebirgsjäger), ausgestellt im Krigsminnemuseum (Kriegsgedenkmuseum) auf den Lofoten
Knapp südlich des Nordkaps führen Angehörige der 20. Gebirgs-Armee der Wehrmacht einen im Oktober 1944 erlassenen Befehl ihres Oberkommandeurs, des oben genannten Jodl, mit hoher militärischer Effektivität, mit Härte und deutscher Gründlichkeit aus. Wie von Kriegsverbrecher Jodl befohlen, vollstrecken sie von Norwegens Grenze zur Sowjetunion bis zum Lyngenfjord östlich von Tromsø die vollständige und rücksichtslose Deportation der Bevölkerung und die Zerstörung all ihrer Unterkünfte.

Gebirgsjäger mit Skiern, Deutsches Bundesarchiv
Von deutschen Texten habe ich genug. Die englische Bildunterschrift des norwegischen Reichsantiquariates (Riksarkivet, National Archives of Norway) unter einem Foto von uniformierten Deutschen auf einem Dampfer spricht Bände. „Der erste Blick auf Nord-Norwegen“, so lässt sich deren Titel übersetzen. Weiter geht es im Text mit der oben genannten und darunter beschriebenen sogenannten „Operation Nordlicht“, bei der die Deutschen in der Finnmark und im Norden der Provinz Troms die Taktik der verbrannten Erde genutzt hätten, um die Rote Armee zu stoppen. Als Folge hätten dort nur wenige Häuser den Krieg überstanden (Erläuterung: die meisten Wohnstätten waren Holzhäuser oder Jurten) und ein großer Teil der Bevölkerung sei gewaltsam nach Süden evakuiert worden. Tromsø sei völlig überfüllt gewesen. Viele Menschen hätten ihre Evakuierung verhindert, indem sie sich in Höhlen und Berghütten versteckt, den Abzug der Deutschen abgewartet und dann ihre Häuser inspiziert hätten. Es wären 11.000 Häuser, 4.700 Kuhställe, 106 Schulen, 27 Kirchen und 21 Krankenhäuser niedergebrannt, Verkehrsverbindungen und Straßen gesprengt, Boote zerstört, Tiere getötet und 1000 Kinder von ihren Eltern getrennt worden. Nach Kriegsende wären im nördlichen Troms und der Provinz Finnmark mehr als 70.000 Menschen heimatlos gewesen. Die gehorsamen Verbrecher hinterlassen 1944 dort wo damals drei Viertel der Sámischen Bevölkerung Norwegens lebten buollán eanan – verbrannte Erde.

Verfolgte Vogelfreie oder Weissagende Völva
Wie gewinne ich jetzt wieder Land? Am arktischen Strand. Mit Bildern aus der Finnmark fernem Osten: … Hamningberg is an abandoned fishing village in Båtsfjord Municipality in Finnmark county, Norway. The village lies at the northern coast of Varanger at the Barents Sea. It is one of very few places in all of Finnmark county that was not burned down by the retreating Germans in the latter part of the Second World War.“
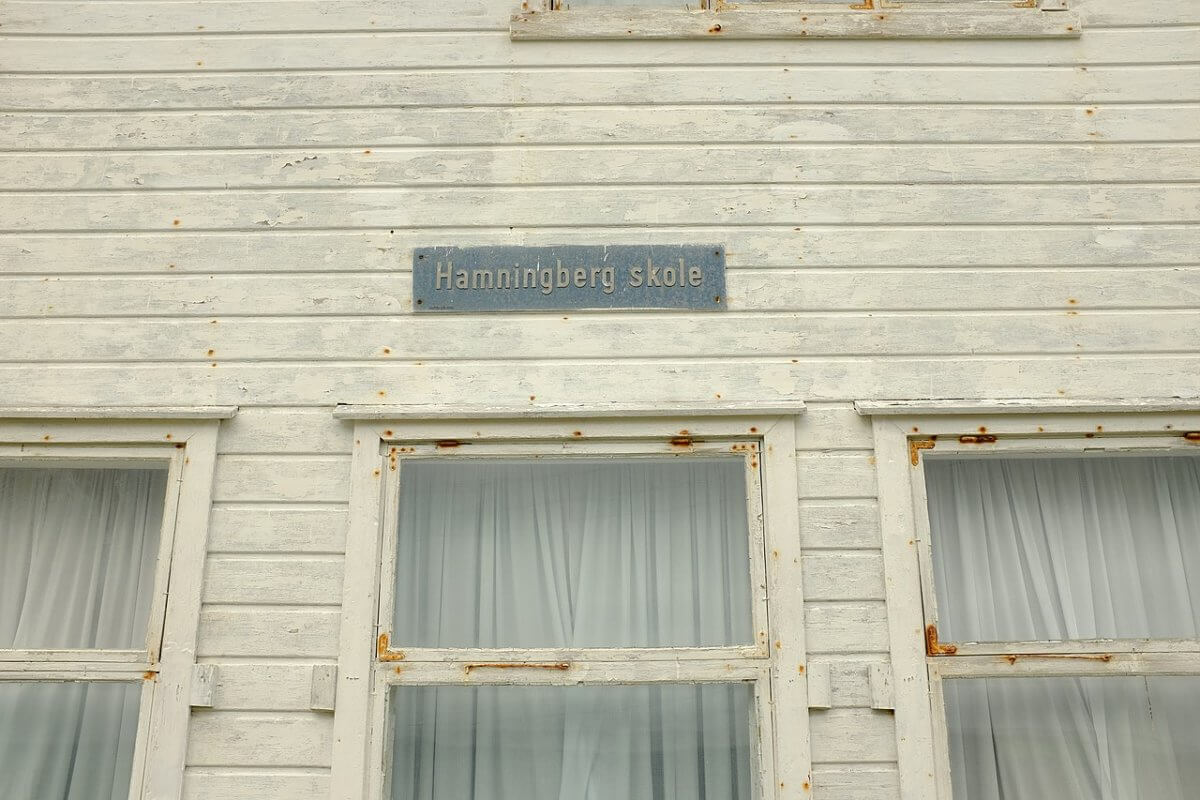
Das alte Schulhaus in Hamningberg, Von Frankemann – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0



Hamningberg, Datenbank der norwegischen Denkmalschutzbehörde riksantikvaren
Der letzte Satz oben ist der wichtigste: Hamningberg ist einer der sehr wenigen Orte in der norwegischen Provinz Finnmark, die die Deutschen 1944 nicht niedergebrannt haben. Laut norwegischer Denkmalschutzbehörde riksantikvaren – die eine sensationell schöne Fotoserie von diesem heute verlassenen Dorf in ihre Datenbank aufgenommen hat – ist es die am besten erhaltene Fischersiedlung an der norwegischen Polarmeerküste.
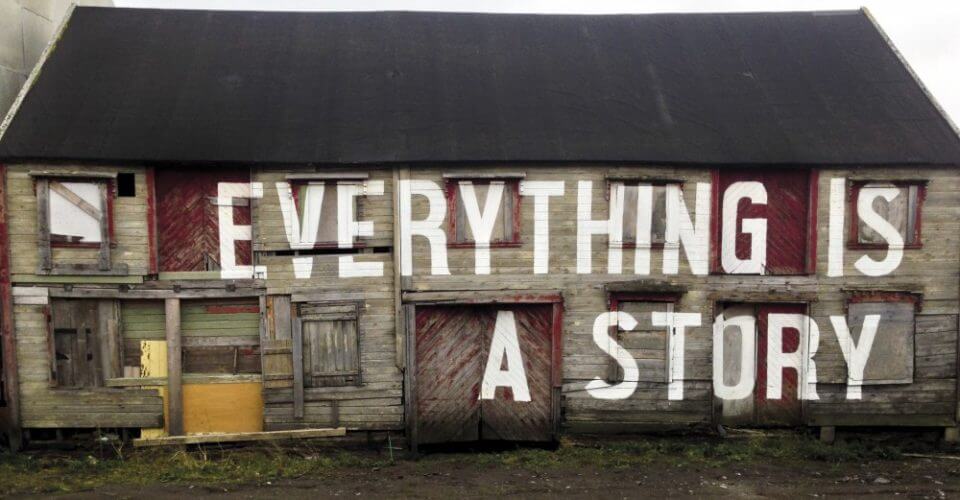
Gleich um die Ecke, vor der Ostspitze von Várnjárga, wie sie auf Nordsamisch, Varangerhalvøya, wie sie auf Norwegisch heißt, der Varanger-Halbinsel, östlicher als St. Petersburg, Istanbul und Kairo, liegt Norwegens nordöstlicher Vorposten, auf einer Insel im Nordpolarmeer. Von hier aus wurde schon vor 9000 Jahren gefischt. Der exponierte Ort scheint von jeher Außenseiter*innen angezogen zu haben. Der norwegischen Wikipedia entnehme ich, dass sein erster niedergeschriebener Name auf das altnordische Wort „vargr ´ulv“ für vogelfrei zurückgeht. Vogelfreie, Menschen, die außerhalb der Gesellschaft leben, hießen in deutschsprachigen Landen auch Wolfsfreie (im heutigen Norwegisch bedeuten sowohl varg als auch ulv Wolf). Und im 13. Jahrhundert, als die heutige Hafenstadt Vargøy gegründet wurde, hatten die Bezeichnungen vargr ´ulv/fredlaus mann/fredløs/Vogelfreier noch nicht unbedingt eine negative Bedeutung. Berühmtheiten wie Martin Luther und Robin Hood gehörten im Mittelalter zu denen, die frei wie ein Vogel und ungebunden lebten. Wann in Skandinavien die Ächtung einsetzte, vermag ich nicht herauszufinden, weiter südlich sorgte Jacob Grimm (die Gebrüder Grimm haben ja bekanntlich auch die kundigen Frauen aus den Wäldern verächtlich gemacht) 1819 in seiner Deutschen Grammatik für die Verdammung. Wir beamen uns zurück in die Zeiten von 800 bis 1050, als laut altnordischer Erzählungen im hohen Norden verstorbene Wolfs- beziehungsweise Vogelfreie an Orten wie dieser von der Barentsee umtosten steinigen Insel vor der Halbinsel Vögeln und Wölfen zum Fraß übergeben wurden. Als vielleicht hier Waräger angelegt haben, skandinavische Händler, auf ihrem Weg zum Бе́лое мо́ре (karelisch und finnisch Vienanmeri, nenzisch Сэрако ямʼ Serako yam, deutsch Weißes Meer) und über die Северная Двина, Sewernaja Dwina (Nördliche Dwina) zum Xəzər dəniz, wie der größte See der Erde auf Aserbeidschanisch heißt, dem Каспий теңізі (kasachisch), دریای خزر / دریای مازندران (persisch), Kaspi deňzi (turkmenisch) oder übers Schwarze ans Mittelländische Meer (mare mediterranum).

Treibholz bei Vardö, Finnmark, Norwegen, Von Stylegar – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Im 17. Jahrhundert wurde die einst nach Vogel-und Wolfsfreien benannte Hafenstadt in der Finnmark, die heute auf Norwegisch Vardø – zurückgehend aufs altnordische Wort für Wacht: varði – heißt, zum schlimmen Schauplatz. In „Dei europeiske trolldomsprosessane“, dem Band, den ich kurz vor meiner – zumindest körperlichen – Abreise aus Troms & Finnmark im Arktischen Universitätsmuseum aus dem Regal ziehe, berichtet Historiker Rune Blix Hagen von der Universtät Tromsø über die Verfolgung von Menschen, die der Zauberei und Hexerei (auf Norwegisch trolldom) angeklagt waren. Über Vardø und das benachbarte, an der Südküste der Varanger-Halbinsel gelegene Vadsø lese ich, der Historiker Einar Niemi betrachte die lokalen Hexenverfolgungen im Licht der styresmakt-allmuge-problematikk. Aus dem Nynorsk, der seit Ende des 19. Jahrhunderts in Norwegen dem Bokmål gleichberechtigten Schriftsprache, in der Hagen schreibt, übersetzt sind dies Konflikte zwischen lokaler Regierung, den vor Ort Herrschenden und Steuernden (styresmakt) und allmuge. Letzteres wird mir aus dem Nynorsk automatisch als „allesmögliche“ übersetzt, die Computer-generierte Übersetzung lautet: Bauernstand. Da bleiben wir mal vorsichtig, umsichtig, grammatikalisch und politisch korrekt.

Die Vogelfreien Robin Hood und Little John, 1912, Louis Rhead
Im dicken GYLDENDALS Handwörterbuch, verfasst in Bokmål – diese „Buchsprache“ ist durch staatliche Abgrenzung und Reform aus dem in Norwegen lange als Verwaltungssprache benutzten Dänisch entstanden -, steht almue = der gemeine Mann. Die norwegische Wikipedia wirft mir das altnordische grenzen- und ländergreifende Wort almugi, das altschwedische almoghe und das altdänische almughæ vor die Brille und erläutert, es handle sich um „das ganze Volk“, „des Reiches freie und mündige Menschen“ und werde auch für die Einwohner einer Gegend im Gegensatz zu deren König oder die Bürger im Gegensatz zur Obrigkeit gebraucht. So gebraucht es Niemi. Und verweist auf Abhängigkeitsverhältnisse in Vardø und Umgebung, in der Gegend im äußersten Nordosten Norwegens, wo die vom Fischfang lebenden Küstenbewohner Bevölkerung von lokalen Händlern und Autoritäten abhängig waren. Und sich widersetzten.

Vardø in der Finnmark ca. 1900
Als „gjenstridige og opprørske kvinner i opposisjon til sentrale mannlege aktørar innanfor handel og det lokale styringsverket“ schildert Niemi schildert die sogenannten trollkvinnene – das aus dem Deutschen stammende Wort heks kommt in Norwegen erst Ende des 16. Jahrhunderts in Gebrauch -, als widerständige, widerspenstige, ungehorsame und aufständische Frauen in Opposition zu den zentralen männlichen Akteuren im Handel und in der lokalen Regierung.
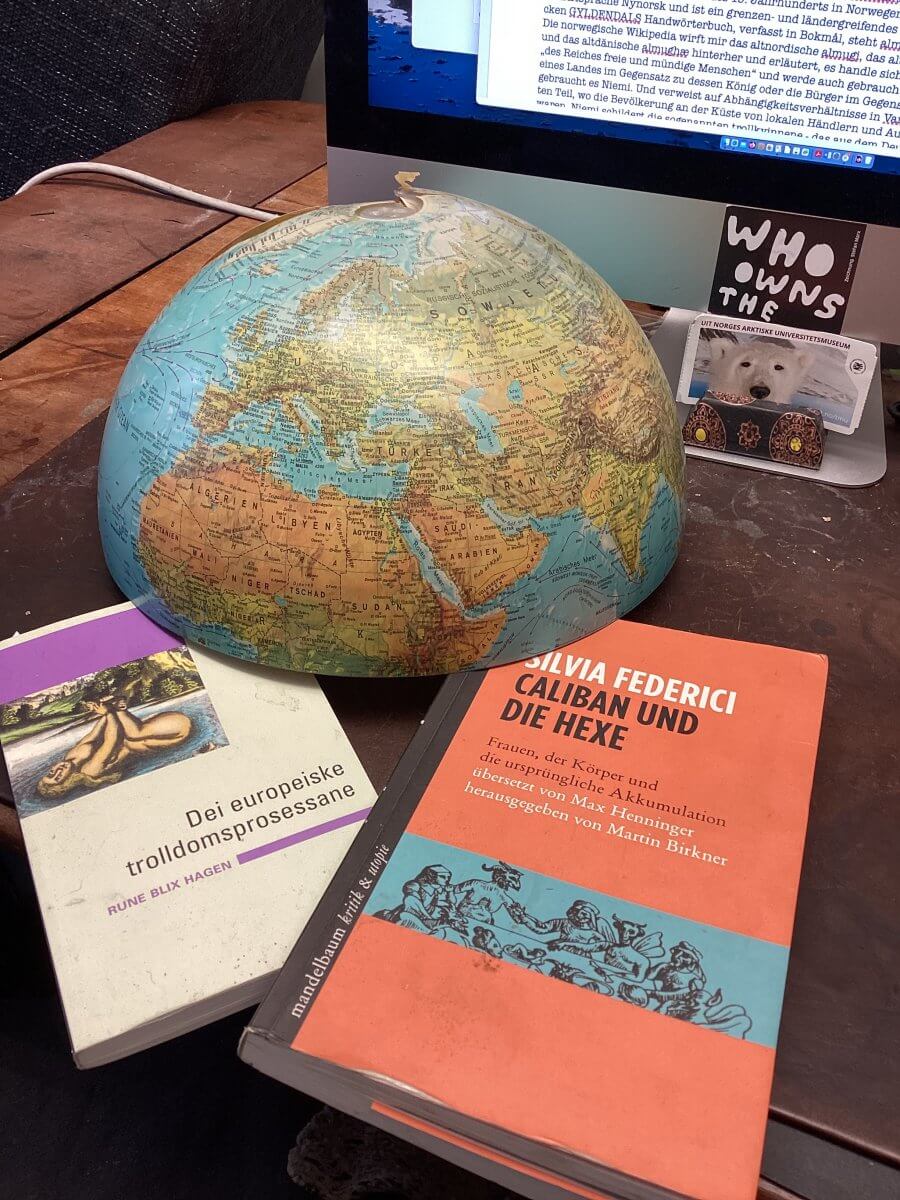
Die italienische Aktivistin und Wissenschaftlerin Silvia Federici, emeritierte Professorin für politische Philosophie, internationale Politik und women studies an der Hofstra Universität in den USA, schreibt in „Caliban und die Hexe“ – das extrem lesenswerte Buch handelt von der Enteignung und Ausbeutung der Frauen im Übergang zum Kapitalismus – übers 16. Jahrhundert, diese Zeit mit ihren Hungerperioden sei eine der schlimmsten fürs europäische Proletariat gewesen, mit weitverbreiteten Unruhen und einer Rekordzahl an Hexenverfolgungen.
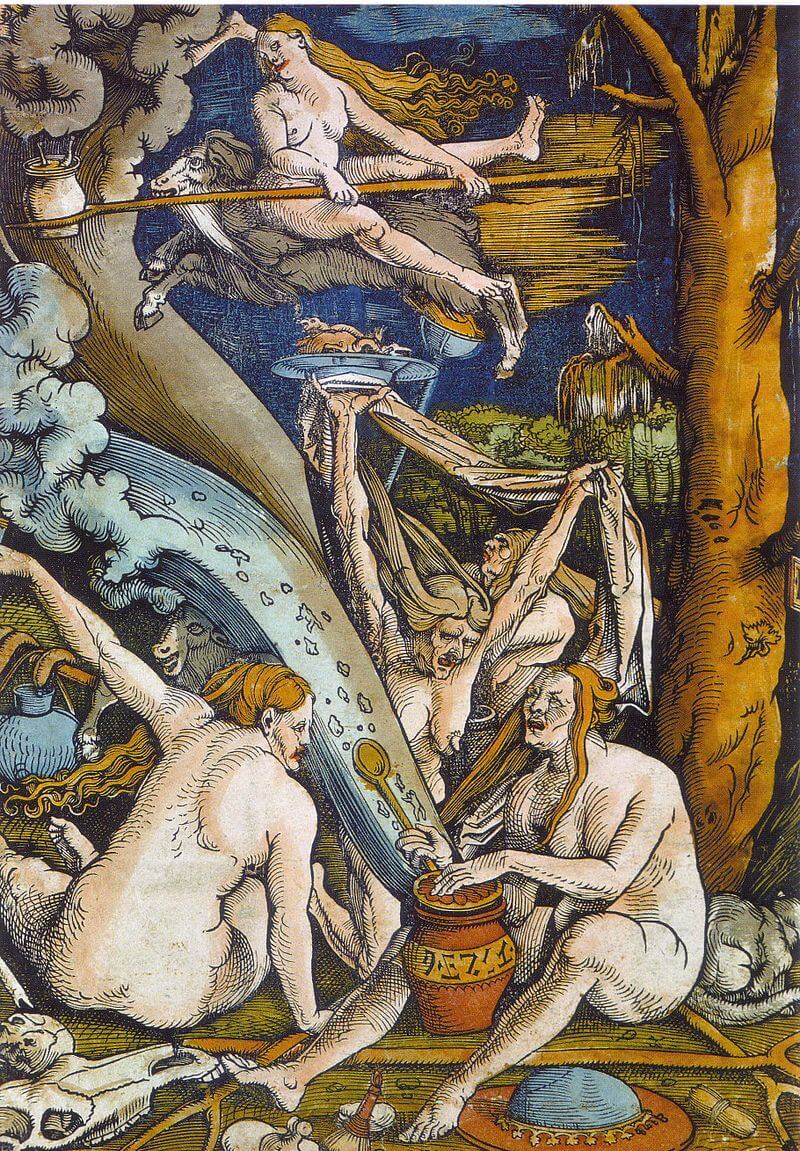
Hexen, 1508, Hans Baldung, dazu Federici: „Die Hexenjagd war auch die erste europäische Verfolgung, die von multimedialer Propaganda Gebrauch machte, um in der Bevölkerung eine Massenpsychose zu erzeugen…. ZU diesem Zweck wurden auch Künstler angeheuert, unter ihnen der Deutsche Hans Baldung, von dem die unvorteilhaftesten Hexendarstellungen stammen.“
„Die große Hexenjagd in Europa“ bliebe bis heute eine der am wenigsten erforschten Perioden der europäischen Geschichte. Die Gleichgültigkeit, die Historiker diesem Genozid gegenüber bislang an den Tag gelegt hätten, „mag sich daraus erklären, dass die europäischen Opfer der Hexenverfolgung vor allem bäuerliche Frauen waren.“

Schriftstellerin und Feministin Silvia Fedrici 2014 bei einem Interview, Von Marta Jara (eldiario.es) – eldiario.es – " Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres" CC BY-SA 3.0 es
Ich füge hier die Verfolgten hinzu, die nicht von der Landwirtschaft, sondern vom Fischfang lebten, und lese, dass die aus Italien stammende Federici wie der aus Nord-Varanger stammende Historiker Niemi davon ausgehen, dass es sich bei trolldomsprossesane und Hexenjagden anderswo in Europa um politische Aktionen handelte. Sie dienten laut Federici „auch dem Aufbau einer neuen patriarchalen Ordnung, unter der die Körper der Frauen, ihre Arbeit und ihre reproduktiven Vermögen unter staatliche Kontrolle gestellt und in ökonomische Ressourcen verwandelt wurden.“ Dafür, dass die Ausbreitung des Kapitalismus samt Vertiefung soziale Abstände und Zusammenbruch kollektiver Beziehungen sowie Ausbeutung und Enteignung ein entscheidender Faktor bei der Hexenverfolgung gewesen sei, spreche auch die Tatsache, dass die Mehrzahl der Beschuldigten arme Frauen waren, während es sich bei den Klägern oft um Arbeitgeber und Wohlhabende gehandelt habe, „die Teil der lokalen Machtstrukturen waren.“

Hexenmahnmal, Louise Bourgeois, Von Bjarne Riesto
Zurück zu trolldom, zu Zauberei und Magie, derer man im 17. Jahrhundert in Vardø mehr als hundert Menschen beschuldigte – 77 Frauen wurden auf Grund solcher Anschuldigungen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, daran erinnert dort heute ein Mahnmal der Künstlerin Louise Bourgeois – blicken wir forschend zurück ins als besonders abergläubisch und finster beschriebene Mittelalter, von dem Federici schreibt, dass es zu keinem Zeitpunkt Massenprozesse und -hinrichtungen gab, „obwohl das Alltagsleben von Magie durchsetzt war“. Und mir fällt plötzlich dieses magische Wort ein, das Filmemacherin Franciska Eliassen zugeraunt hatte, als wir bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck, im November 2022, über weibliche Macht sprachen: Seiðr! Mange takk, Francisca!!!

Hilfsmittel zum Betreiben von Seid aus dem Grab einer Volvo von der schwedischen Insel Öland: ein 82 Zentimeter langer Eisenstab mit Bronzeornamenten, eine Kanne aus Persien oder Zentralasien, ein Bronzekessel aus Westeuropa, die Verstorbene war in Bärenfell gehüllt, Nationalmuseum Stockholm,
Man nannte sie Heiðr. Wo sie ins Haus kam, die weissagende Völva, verwendete sie Zauberstäbe. Sie trieb Seiðr“, heißt es in einem Gedicht von 960. Solche schriftlichen Quellen geben laut norgeshistorie.no Auskunft über die Machthaberinnen in vikingertidens norden, kulturellen Gebiet namens Norden zu Zeiten der Wikingerinnen, das die heutigen Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden umfasst. In deren gemeinsamem Altnordisch bedeutete der Name Heiðr heiter, hell, licht, klar, aber auch Ruhm und Ehre. Gerühmt und verehrt wurden zu jenen Zeiten in diesem ausgedehnten Norden die vǫlva – auf Altnordisch Stabträgerinnen -, so steht es in norgeshistorie.no, sie seien vor allem religionsfortolkerne gewesen, sozuschreiben Religionsdolmetscherinnen, oft ältere Frauen, losgelöst von strengen Familienbanden. Ihre Kenntnisse und Techniken, ihr Kultwissen im Grenzland zwischen Religion und Magie, nennen sich Seiðr, auf Norwegisch seid, und haben große Ähnlichkeiten mit dem Schamanismus. Ihre Stäbe wurden ihnen mit ins Grab gegeben. Ihre gesellschaftliche Rolle gab ihnen große Macht.

Diese Volva von Håvard Larsen ist in Norges arktiske universitetsmuseum ausgestellt.
Kleiner Nachtrag: „VOLVE – SEIDR“ hatte mir Franciska am Vortag in Großbuchstaben in mein kleines Notizbuch geschrieben, als Wegweiserin fürs Nachforschen. Machtvolle Frauen hätten – „before christianity“ – nicht nur das Wetter vorhergesagt, seien Meisterinnen der Intuition, Seherinnen (ich ergänze im Geiste: Hörerinnen, solche, die auch das Gras wachsen hören) gewesen. Das heutige norwegische Wort volve (deutsch: Völva) bedeutet Sibylle, Prophetin, Wahrsagerin, Stabträgerin (stavbærerske). Vom mittelalterlichen Wort volva, das in der altnordischen Sprache Frau mit Stab bedeutete, kommt die heutige medizinische Bezeichnung Vulva für die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Das Werk „Volva“ des 1955 geborenen norwegischen Künstlers Håvard Larsen macht daraus eine runde und kraftvolle Holzplastik. Sie ist im Arktischen Universitätsmuseum abgebildet, was mir erst im Nachhinein verständlich wird.
Antibourgeoise Kossoworotka oder Solide russetømmer
Das war siebenhundert Jahre vor der von lokalen Machthabern entflammten Hexenhysterie in Vardø. Das Städtchen auf der Insel in der Barentsee wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts gegründet, als Bollwerk gegen Russland, und beförderte mehr als 600 Jahre lang länderübergreifende Beziehungen, unter anderem zu den Pomoren. Zeugen dafür ist ein Ende des 19. Jahrhunderts aus solid russetømmer – solidem russischen Bauholz – und sibirischen Lärchenbrettern errichtetes Gebäude, Norwegens ältestes übers Meer gebautes, Anlegestelle und Schiffsbrücke (sjøhus). Hier arbeiteten russische Pomoren bei einer Handelsfirma des im 17. Jahrhundert in Norwegen eingewanderten sächsischen Geschlechts Brodtkorb. Bis 1917. REVOLUSJON OG TERROR, weiß auf rotem Grund, so ist der Abbruch der Handelsbeziehungen in Vardøs Pomorenmuseum betitelt, wo hinter dem Nordlandsbåt – solche traditionellen Klinkerboote, mittlerweile Kulturerbe der Menschheit, stellten über viele Jahrhunderte das einzige Verkehrsmittel zwischen Nord-Trøndelag, der Gegend nördlich von Trondheim und der Kola-Halbinsel dar – eine Leninbüste steht.

Revolutionäre Plakate, Leninbüste und Nordlandsboot im Pomorenmuseum in Vardø, Av Stylegar – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Weil sie so schön anzusehen sind: zwei Nordlandsboote, das eine voll beladen, vor Svolvær auf den Lofoten, ca. 1890, Library of Congress, USA
Und so können wir uns nun an gesellschaftlichen Veränderungen – aber nicht an Terror – interessierten Europäer*innen zuwenden, die sich 1920 trafen, in der Russischen Sowjetrepublik – die Union der 15 Republiken Armenien, Aserbeidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan wurde erst zwei Jahre später ausgerufen. Zum dortigen 2. Weltkongresses der Kommunistischen Internationalen reist auch Raymond Lefebvre, überzeugter Pazifist, Schriftsteller. Der Franzose sei aus einer total bourgeoisen Familie gekommen, aber revolutionärer Enthusiast geworden, schreibt Lev Davidovich Bronstein, besser bekannt als Leon Trotzky. Lefevbre, habe mit seiner Klasse gebrochen und schon am zweiten oder dritten Tag des Kongresses ein russisches Hemd angelegt. Eine косоворо́тка, Kossoworotka, übersetzt: schräger Kragen. Der Halsausschnitt dieser traditionellen Herrenoberbekleidung ist seitlich versetzt, als Oberhemd oft mit links geknotetem Stoffgürtel getragen.
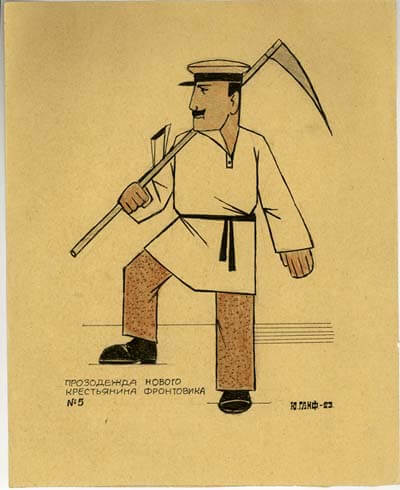
Nach dem Kongress befürchteten Lefevbre und seine Begleiter, die Anarchisten Marcel Vergeat und Jules Lepetit, denen es an Visa mangelte, aber nicht an gewaltbereiten politischen Gegnern, auf der Heimreise aufgehalten zu werden, und wählten den Seeweg nach Norwegen, dort sind sie nie angekommen, ihr Verschwinden wurde nie aufgeklärt.
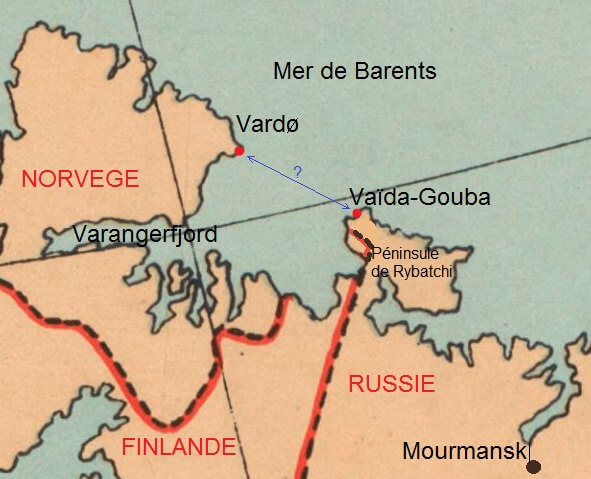
Die Karte zeigt die Route, auf der der französische Schriftsteller Raimond Lefebvre nach der 2. Weltkonferenz der Kommunistischen Internationale mit seinen Begleitern Jules Lepetit und Marcel Vergeat in der Barentssee verschwand, Von Jospe – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
An Bord gingen die drei Franzosen damals in Vayda-Guba (russisch Вайда-Губа, finnischVaitolahti, skoltSámisch Âiʹddvuõnn, norwegisch Vajda-Guba). Dieser Ort am Polarmeer – von dort sind es nur gut fünf Seemeilen nach Vardø – hatte 2010 weniger als hundert Einwohner*innen und die 180 Kilometer Landweg von Murmansk gelten derzeit unter Abenteurern des Vierradantriebes als ganz besondere Herausforderung. Er befindet sich im nördlichsten Teil des europäischen Russlands auf полуо́стров Рыба́чий, der Fischerhalbinsel, die wiederum den nordöstlichsten Teil des Gebietes von Печенга (Petschenga, Petsamon lääni, Provinz Petsamo) darstellt.
Über diesen geografischen „Pfannenstiel“ verlief ab 1920 die Grenze zwischen Finnland und der Sowjetunion und er verschaffte Finnland Zugang zum Arktischen Ozean, bis er 1944 von der Sowjetunion annektiert wurde, durch eine „Operation“, die Петсамо-Киркенесская операция, Petsamo-Kirkenes-Operation, die angeblich sowohl in der russischen als auch in der US-Armee als Studienobjekt für einen Krieg in der Arktis verwendet wird. Als Rüstungsgegnerin und Friedensfreundin wird mir erstmal schlecht. In die militärischen Finessen deutsch-russischen Schlacht im Winter 1944 möchte ich mich auf keinen Fall vertiefen. Mich interessiert eher die Gegend.

Peäccam, Petsamo, Petschenga zwischen 1926 und 1928
Die Skoltsamen nennen sie Peäccam, und waren dort wohl die Ersten. Mehrere Jahrtausende vorm christlichen Jahre Null und vorm Aufkommen des Rentier-Nomadentuns organisierten sie sich als Fischer*innen, Jäger*innen und Sammler*innen in herrschaftsfreien Horden namens sijd (skoltSámisch), sijte (südSámisch), sijdda (luleSámisch), siida (norwegisch), Погост (Pogost, russisch).

Eine samische Siida in der Finnmark zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Ich setze hier & jetzt der Einfachheit halber aufs digitale Plagiat aus der deutschsprachigen Wikipedia: „Im Frühjahr und Sommer wirtschafteten die einzelnen Haushalte getrennt und verteilten sich über die verschiedenen Erwerbsquellen, also Flüsse und Binnenseen, Jagdgebiete, Weideland, Fischplätze am Meer. Im Herbst und Winter sammelten sie sich an gemeinsamen Wohnplätzen um gemeinschaftlich Jagd auf das Wildren zu betreiben und die sozialen Kontakte zu pflegen. Eine Siida war mindestens so groß, dass sie eine Jagdgemeinschaft von acht bis zwölf erwachsenen Jägern stellen konnte. Manche umfassten aber auch mehrere solche Jagdgemeinschaften. Die gemeinschaftliche Beute wurde unter den Haushalten proportional aufgeteilt. In den ostSámischen Gebieten ist bekannt, dass die Siida von einem Ältestenrat, der aus den Haushaltsvorständen gebildet wurde, geleitet wurde. Häuptlinge kannten die Samen nicht.“ Auch von Herrscherinnen ist nirgendwo die Rede. Die wichtigsten Persönlichkeiten der Siida waren wohl die noaidi (nordSámisch), noajdde (luleSámisch), nåjjde (piteSámisch), nåejtie (südSámisch), nōjjd ( skoltSámisch), niojte (terSámisch), noojd/nuojd (kildinSámisch), noaide (norwegisch), jene Mittler*innen und Vermittler*innen, die sich unter anderem im Diesseits und Jenseits auskannten und daher bei Krisen zu Rate gezogen wurden.

Die westlichste dieser egalitären Gemeinschaften der Sámi, die sich auf der Kola- und der Varanger-Halbinsel am längsten erhalten haben, bis ins 20. Jahrhundert, heißt bei den Skoltsamen Njauddâm sijdd, nordsamisch Njávdán, finnisch Näätämö, kvenisch Näätämö, norwegisch Neiden. Dort öffnete 2017 das Äʹvv Saa’mi mu’zei, das SkoltSámische Museum (dvmv.no), in dem Kultur und Geschichte der Gegend seit dem Ende der Eiszeit vorgestellt wird, was nach meinen mangelhaften Archäologie-Kenntnissen bedeutet: seit einem Dutzend Jahrtausenden.
Spielzeugartige Unterdrücker oder Ernstzunehmende Erlöserinnen
Die seit jenen Zeiten Ortsansässigen und ihre herrschaftsfreien Gemeinschaften waren weltlichen und geistlichen Oberhäuptern der umliegenden ungleichen Gesellschaften, genauer: deren Geschäften, im Wege. Von den Museumsmacher*innen dieses Äʹvv Saa’mi mu’zei – Maria Kemi Rein, Yngvar Julin, Honna Havas und anderen – ist zu lernen, dass der russische Zar im Jahr 1556 skoltsamische Gebiete dem Petschenga-Kloster „gegeben“ habe, das seither mit Rentieren, Salz und Fisch „gute“ Geschäfte machte und die Siida Skolt und Muotka den Klosterregeln unterwarf. Die durchlässigen Grenzen der Skoltsamen verliefen organischer. Die westlichste Gruppe von Fischer*, Jäger* und Sammler*innen, Skolt genannt, lebte westlich des Petschanga-Fjordes im Gebiet Peäccam. Richtig friedlich liegen sie da, die Fischerboote auf dem Gemälde „Bach des Heiligen Triphon von Petschenga“. Triphon oder Tryphon bedeutet Zertrümmerer. Der so genannte Mann, der an der Mündung dieses Bachs in den Fjord, der wiederum bei der Fischerhalbinsel in die Barentssee mündet, ein Kloster gründet, wird Ende des 15. Jahrhunderts nordwestlich von Moskau geboren und versuchte, die Skoltsamen zu christianisieren.
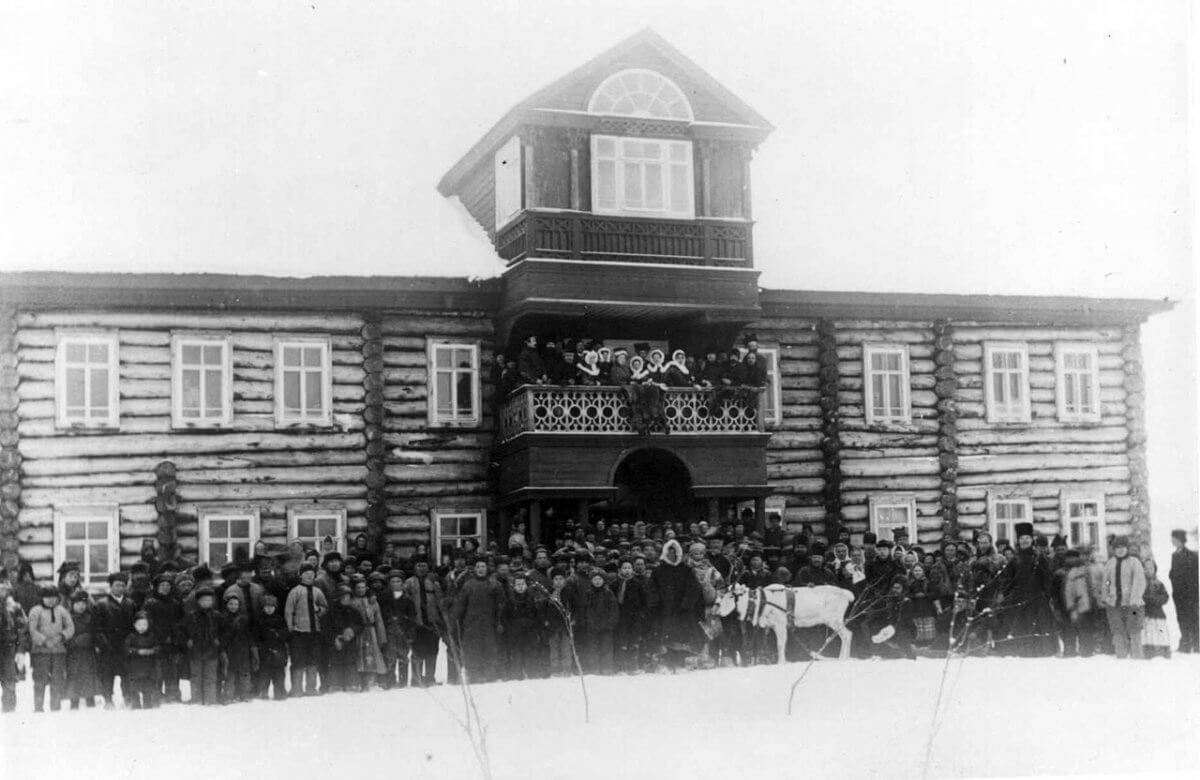
Klosterschule in Petschenga vor 1900
Das friedliche Bild aus dem 19. Jahrhundert täuscht. Auch wenn es kooperativ begann, wie Karten und Berichten aus vorherigen Jahrhunderten zeigen. Zum Beispiel vertrugen sich scheinbar die Kildinsamen, ihr Name kommt von der Insel Кӣллтсуэл (kildinSámisch), Кильдин (russisch), Kiltinä (finnisch) Kildin (deutsch), die der Halbinsel Kola vorgelagert ist, auf dieser Insel mit den pomorischen Fischern und Händlern. Der holländische Kaufmann, Autor und Entdecker Jan Huygen van Linschoten verzeichnet hier in seiner Reisebeschreibung zwei von Samen und Pomoren seit dem 16. Jahrhundert gemeinsam genutzten Handelsplätze. Der Süden und die beiden Siedlungen liegen auf dem Groote nieuwe Zee-Atlas, dem Großen neuen Seeatlas des 17. Jahrhunderts, oben, das war seinerzeit geografisch korrekt.

Кильдин на карте 1790 года, Kildin auf einer Karte von 1790
Weiter gefasst gehören die Halbinsel zwischen Barentssee und Weißem Meer, den beiden Nebenmeeren des Arktischen Ozeans schlicht und übergreifend zu Fennoskandinavien, doch damit wollen sich weltliche und geistliche Oberhäupter nicht zufriedengeben. Im 1264 von Pomoren gegründeten Colo ließ Zar Iwan IV. Wassiljewitsch, der Schreckliche im 16. Jahrhundert eine Holzfestung errichten, den Kola-Ostrog und sandte Bogenschützen, Strelizen (russisch стрельцы́, strelzy) und andere Gesandte, die seine Interessen am Nordpolarmeer vertraten Holzfestung. Die orthodoxe „Übergabe“ der Sidii von Kildin- und Skoltsamen wurde also massiv und militärisch unterstützt. Ab 1533 gehörten sie zu Russland. Die dort praktizierte, politisch, kirchlich und ökonomisch extrem erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Popen und anderen patriarchalen Oberhäuptern wurde nur für einige Jahrzehnte unterbrochen, nach der Russischen Revolution, durch Abschaffung des orthodoxen, kirchlichen Patriarchats, des патриархат der ROK, der Русская православная церковь, der Russischen orthodoxen Kirche. Angefangen hat das Patriarchale mit und in einem historischen Gebiet namens Русь (ostslawisch), Ρωσία (Rossía, griechisch) im früheren deutschen Sprachgebrauch Russland, Ruthenien oder Reußen, im heutigen die Rus, dessen Name von einem nordischen Wort hergeleitet wird: roðr für Rudern, Rudermannschaft. Apropos Rudern: Auf der bunten Flickenteppich-Karte, die die politisch-religiöse Lage im 13. Jahrhundert umreißt, ist gut zu erkennen, dass die westlich von Rus lebenden baltischen Völker, zu denen auch meine Vorfahr*innen, die Prußen (Eigenname *Prūsai, auf der Karte als Old Prussians bezeichnet, auf einer anderen als Prussians), die Esten und die Litauer gehören, nicht zu den Rudern greifen mussten, Wikinger aber See und/oder Meer zu überqueren hatten, um nach Minsk oder Novgorod zu kommen.
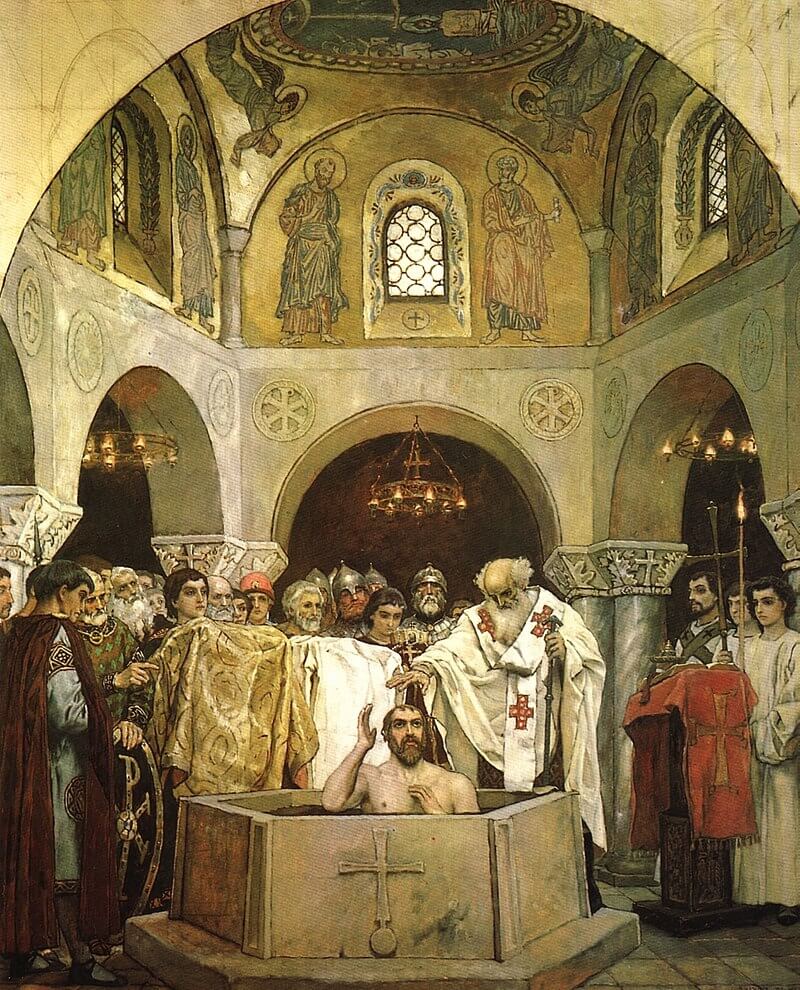
Taufe Wladimirs (1890), Viktor Vasnezow
Mit den dortigen Patriarchen & Politikern hat es angefangen, als der damalige Herrscher der Rus, Володимѣръ Свѧтославичь (Volodiměrъ Svętoslavičь, altostslawisch), Valdamarr Sveinaldsson (altnordisch), Владимир Святославич (russisch); Володимир Святославич (ukrainisch); Уладзімер Сьвятаславіч (belarussisch), Wladimir I. (für die übrigen Eurasier*innen), geboren 960 nahe der Grenze seiner Rus zu Estland, fest darauf bauend, dass die Lehre der griechisch-orthodoxen Kirche, alle Obrigkeit komme von Gott, seine Stellung enorm festigen und seine Herrschaft stützen werde, sich taufen ließ. So konnte er mit dem Patriarchen kollaborieren, der das Oberhaupt von Millionen orthodoxer Christen darstellt, das kirchliche. Dieses Ende des 17. Jahrhunderts in östlichen Gefilden installierte Patriarchat wurde mehrfach renoviert, umbenannt, ab- und wieder angeschafft, je nach Vorlieben und Umtrieben der jeweiligen Herrscher. Zar Peter I. schaffte es ab und unterstellte die ROK weltlicher Kontrolle; 1917 wurde es wieder eingeführt, ein Jahr später im Zuge der Russischen Revolution und der Trennung von Kirche und Staat wieder abgeschafft; Stalin holte die Patriarchen wieder ins Boot; und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gemeinden im kommunistischen Machtbereich (Osteuropa, Ostdeutschland) ins Moskauer Patriarchat eingegliedert, das Московский патриархат Moskowski patriarchat (Moskauer Patriarchat), das Русская православная церковь, das heute der Russischen orthodoxen Kirche in der gesamten russischen Föderation vorsteht, in Gestalt von Kyrill I. (Achtung Patriarchat-Plagiat: bürgerlich Wladimir Michailowitsch Gundjajew, russisch Владимир Михайлович Гундяев; Geistlicher und ehemaliger Agent des Komitee für Staatssicherheit, des sowjetischen Geheimdienstes, mit einem Privatvermögen von rund vier Milliarden US-Dollar).

Мари́я Влади́мировна Алёхина, auf deutsch genannt Mascha Alechina, Marija Aljochina, Maria Alyokhina während der Gerichtsverhandlung in Moskau (2012)
Diesen ROK-Vorsteher überlasse ich jetzt mal einer, die sich – vor allem künstlerisch sehr viel mit Patriarchaten befasst hat: Мари́я Влади́мировна Алёхина, auf deutsch genannt Mascha Alechina, Marija Aljochina, Maria Alyokhina. 1988 wurde sie in Moskau geboren, hat dort Journalismus und kreatives Schreiben studiert, sich als Greenpeace-Aktivistin, Performance-Künstlerin und Putin-Kritikerin engagiert. Gerade in den Wochen, in denen ich an diesem den halben Globus und viele Jahrtausende umspinnenden Blog knüpfe, fällt eine Flugschrift in meinen Briefkasten. Der 2012 bei der Hamburger Edition Nautilus erschienene Band versammelt Briefe, Plädoyers, Erklärungen und Gedichte von Aljochina und zwei weiteren Künstlerinnen eines im Jahr zuvor gegründeten feministischen Performance-Kollektivs Pussy Riot, von mir übersetzt: „Vulva-Aufruhr“.

Pussy Riot 2012, Von Игорь Мухин, Igor Mukhin, in der Wikipedia auf Russisch, CC BY-SA 3.0
Die Texte handeln vom Filz zwischen der Kirche und dem größten Staat der Welt. Bevor wir in die Kirche gehen, gehe ich mal auf dieses Staatswesen ein. Quasi als Biologin unternehme ich eine laienhafte Bestimmungsübung: laut digitaler Enzyklopädie ist ein Staat eine irgendwie geartete politische Vereinigung einer größeren Menschengruppe, die in einem mehr oder weniger geschlossenen Gebiet unter einer mehr oder weniger einheitlichen Form der Machtausübung lebt.
Bei der Machtausübung in der Rossijskaja Federazija, kurz Russland genannt, hat der Präsident verfassungsgemäß eine herausragende Rolle. Ansonsten werden die knapp 150 Millionen Einwohner*innen dieses sehr dünn besiedelten Gebietes offiziell demokratisch regiert und säkular. Dieses Fremdwort für die Entchristlichung von Staaten stammt von saeculum und verweist aufs Zeitliche und Irdische. Die „Machtausübung“ der Kirche soll sich in säkulariusierten Staaten wie dem heutigen Russland auf religiöse, ewige, überidische, nicht weltliche, den Glauben betreffende Angelegenheiten beschränken. So weit, so vage.

Marija Aljochina, 2022, Von Amrei-Marie – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Darauf, dass in ihrer Föderation mit der Machtausübung einiges aus dem Ruder geraten ist, weisen Aljochina und die anderen starken sowie mutigen Frauen des oben genannten Kollektivs öffentlich und drastisch hin. Ihre Performances an öffentlichen Orten sind optische und akustische Angriffe auf Putins Politik. Im Februar 2012 stiegen sie auf die Kanzel der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, wie Laurie Penny im Vorwort zur Textsammlung PUSSY RIOT! EIN PUNKGEBET FÜR FREIHEIT schreibt, „in Strickmützen und skandalös kurzen Kleidern“.

Christ Erlöser Kathedrale, Moskau, August 2012, Von Алена Рязанова, CC BY 3.0
Drei der fünf jungen Frauen, Aljochina, Jekaterina Samuzewitsch und Nadeschda Tolokonnikowa, wurden verhaftet, zwei von ihnen zu Straflager verurteilt, wegen angeblich grober Verletzung der öffentlichen Ordnung (die m. E. in Moskau und und dem von dort beherrschten Umland eher von dort derzeit herrschenden weltlichen und kirchlichen Herren verletzt wird).

Laurie Penny, Leipziger Buchmesse 2016, Von Amrei-Marie – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Bevor wir in die Lager Нижний Новгород, Nischni Novgorod und Мордовия, Mordwinien, müssen, erlauben wir uns Exkursionen nach London und Odessa, zu anderen Heldinnen des Freiheitskampfes. In London wurde 1986 die sozialistische Feministin, Kolumnistin, Journalistin, Autorin, Bloggerin, Utopistin, Querulantin und Unruhestifterin Laurie Penny geboren. Sie studierte Englische Literatur und verfasste Meat Market. Female Flesh under Capitalism (Fleischmarkt) – worin sie das herrschende Perfektionismusgebot für weibliches Aussehen und Verhalten, beispielsweise den Schlankheitswahn direkt auf das kapitalistische System zurückführt -; Unsagbare Dinge. Sex, Lügen und Revolution – worüber die Kritikerin Gaby Hinsliff schwärmt: „she wrote like a dream: she had such a raw, bright, urgent voice and she was telling such different stories to everyone else“ (sie schrieb wie ein Traum: sie hatte so eine raue, intelligente, eindringliche Stimme und erzählte Geschichten, die so ganz anders waren als die aller anderen), worin sie sich die dominierenden und dominanten Vorstellungen von romantischer Liebe und die weiterhin vorherrschende sexuelle Unterdrückung vornimmt und noch einmal unterstreicht, dass dafür, und auch für die „Krise der Männlichkeit“, die sich daran zeige, dass wirtschaftlich erfolglose junge Männer ihren Frust an Frauen und Homosexuellen abließen, das kapitalistische System zuständig sei -; Sexualität. Revolution. Rechter Backlash und feministische Zukunft – worin sie herausarbeitet, dass für guten Sex finanzielle Unabhängigkeit erforderlich sei.
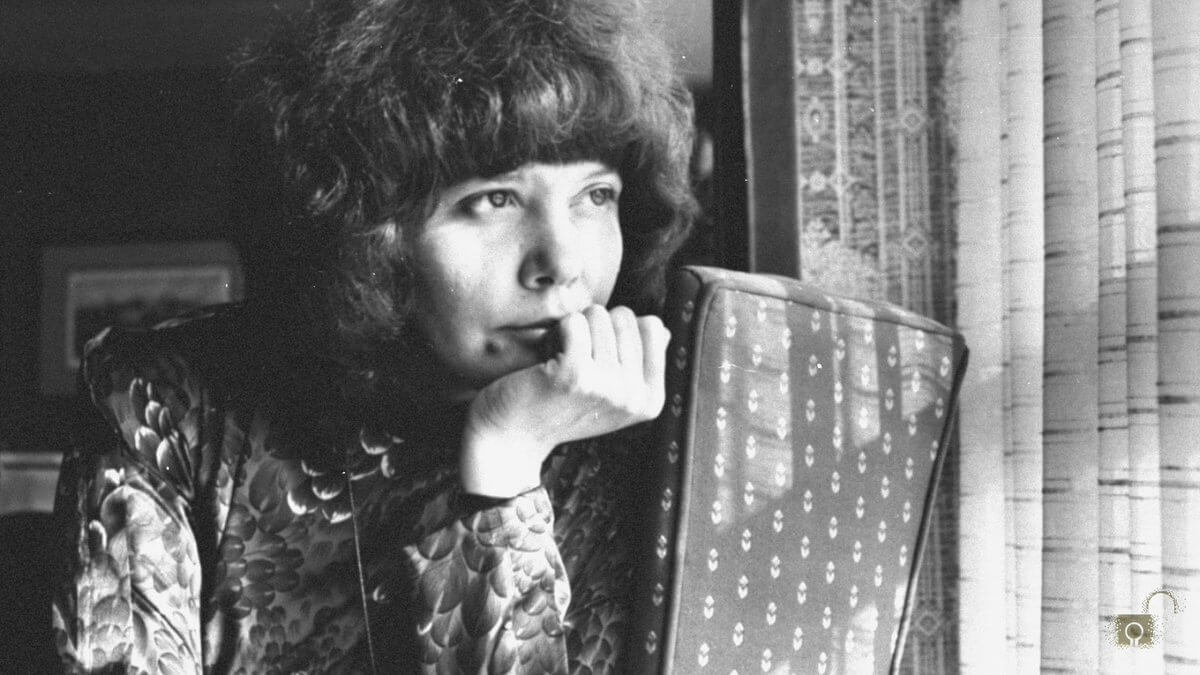
Die russische Dichterin und Dissidentin Ирина Борисовна Ратушинская, Irina Borissowna Ratuschinskaja, geboren 1954 in Odessa
Und sie erinnert in ihrem Vorwort an Ирина Борисовна Ратушинская, die russische Dichterin und Dissidentin, geboren 1954 in Odessa. Die Familie von Irina Borissowna Ratuschinskajas Mutter stammt aus Polen, hat sich dort beim Januaraufstand Ende des 19. Jahrhunderts gegen der Teilung – quasi Auflösung – Polens widersetzt und wurde nach Sibirien deportiert. Sie selbst wurde auf Grund ihres Einsatzes für politische und persönliche Freiheit sowie Menschenrechte ins Arbeitslager verbannt. Ihr Buch Grau ist die Farbe der Hoffnung erzählt von der Gefangenschaft, ihre Gedichte feiern die Schönheit.
Darüber schreibt auch Alechina alias Aljochina in „Tage des Aufstands“. Extrem lesenswert beschreibt sie die hoffnungs- und wundervolle Zeit vor der russischen Präsidentschaftswahl 2012, als sie mit ihrem sowohl regierungs- als auch kirchenkritischen Kollektiv mit Mützen, die nur Augen und Mund frei lassen, und leichten Kleidern performte, um die Wiederwahl Putins zu verhindern, um auf dessen unheilvolle Koalition mit den orthodoxen Patriarchen aufmerksam zu machen.
Die insgesamt zehn Künstlerinnen sehen sich als Teil der globalen antikapitalistischen Bewegung, die aus Anarchist*innen, Trotzkist*innen, Feminist*innen und Autonomen besteht. Sie kämpfen als zivilgesellschaftliche Aktivistinnen inmitten eines Staates, der seine Macht gegen grundlegende Menschen- und Bürgerrechte einsetzt. Sie kämpfen kunstvoll gegen Patriarchen und Präsidenten, die mit ihrem engen Schulterschluss in den Fußstapfen zaristischer Gewaltregime Freiheiten abschaffen und alte Herrschaftsverhältnisse wiederherstellen. Und sie verztrauen, so schreibt Aljochina, im magischen Winter von 2011, als sie Pussy Riot gründen, auf diese „Schneerevolution“. Im plötzlichen Glauben daran, dass Veränderungen möglich sind, gingen sie auf die Straße, „multiplizierten Buchstaben mit Buchstaben zu Texten über die Revolution“, trugen weiße Bänder. Traten auf und an gegen den kleinen, grauen Tschekisten (Angehörigen der Staatssicherheit) Putin und den in einen Anzug geblasenen, spielzeugartigen Medwedew, wie sie die politischen Hauptgegner beschreibt.
Das „Patriarchat von Moskau“ erklärt die Autorin folgendermaßen: „Beide sind ehemalige Tschekisten, deswegen sind sie auch so verliebt ineinander…. Putin – der ehemalige KGB-Agent „Michalitsch“, und der Patriarch der ganzen Rus – der ehemalige KGB-Agent „Michailow“. Und sie würden es nicht gerne hören, wenn man sie daran erinnert, dass Russland ein säkularer, ein weltlicher Staat ist, in dem laut Verfassung Kirche und Staat getrennt sind. Nach dem „Kick-off-Meeting von Putin und dem Patriarchen, „war klar, dass der Patriarch beschlossen hatte, die Kirche dafür zu benutzen, die überirdische Bedeutung des Präsidenten zu begründen. Mit dem Versuch, Putins bis dahin elfjährige Präsidentschaft zu beenden.

Lobnoje Mesto, CC BY 1.0
Sie stiegen auf ein Baudenkmal auf dem Roten Platz, Лобное место, Lobnoje Mesto, eine runde erhöhte Terrasse, wo Zaren Beschlüsse verlesen und Kriege erklärt haben, wo Hinrichtungen stattfanden, wo 1968 acht Dissidenten gegen den Einmarsch der Truppen in die Tschechoslowakei protestierten – ein in Sowjet-Russland noch nie da gewesener Protest, wie Alechina erklärt. „Wir, Pussy Riot, gingen auf den Platz, weil wir eine andere Geschichte wollten. Denn die, in der sich der Präsident in einen Imperator verwandelt, passte uns nicht. … Ein Aufstand, ein Bruch, ist immer auch Schönheit, das war der Grund, warum ich an der Sache interessiert war.“ Ihr Choral in der Kathedrale lautete: „Gottesmutter, Jungfrau, jage Putin davon, jage Putin davon, jage Putin davon. Schwarze Kutte, Schulterklappen golden – Kirchenbesucher kriechen zur Verbeugung – Im Himmel weilt das Phantom der Freiheit – Nach Sibirien verbannt man schleunigst die Gay Pride – Der KGB-Chef ist ihr oberster Heiliger – Alle Protestler schickt er ins Lager“. Sie wollten niemandem etwas Böses, sind überzeugt davon, dass Kritik kein Verbrechen sein darf, ihre Aktion keine Gotteslästerung war, sondern eine Kritik an der Institution Kirche im modernen Russland – und wurden ins Lager geschickt.

Ihre Erfahrungen in den beiden Straflagern schilderte Tolokonnikowa in einem Interview nach ihrer Begnadigung. Laut wikipedia.de erläuterte sie, dass sie im Lager in erster Linie mit Frauen aus der gegenüber ihren Aktionen negativ eingestellten Bevölkerungsmehrheit zusammengelebt habe. „Und wenn ich den Frauen dort unsere Aktion erklärt habe, waren sie schnell auf unserer Seite. Die Menschen in Russland können zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Moderne Kunst hat zudem immer negative Reaktionen hervorgerufen. Wir sind ja nicht ein 100-Dollar-Schein, der jedem gefällt. Im Gegenteil: Es ist Aufgabe des modernen Künstlers, die Gesellschaft zu provozieren und zu spalten … Ich verstehe Russland jetzt viel besser, einfach weil ich es dort mit Frauen aus sozialen Gruppen zu tun hatte, die ich sonst nie getroffen hätte. Das ist für eine Politaktivistin wie mich ziemlich wichtig. Außerdem habe ich eine große innere Ruhe gewonnen, eben die Gelassenheit eines Häftlings.“ Tolokonnikowa schilderte ihre Behandlung als „fürchterlich. Man hat alles versucht, um mich zu brechen und zum Schweigen zu bringen. Am schlimmsten und kaum auszuhalten waren die Kollektivstrafen. Wegen einer kleinen Geste oder wenn ich die Lagerleitung aufforderte, das Gesetz einzuhalten, sind gleich hundert Leute ins Strafbataillon abkommandiert worden. Dort waren Schläge an der Tagesordnung. Ich wurde besser behandelt als andere, einfach weil die öffentliche Aufmerksamkeit so hoch war. Bei mir hat man sich auch an die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeit von acht Stunden gehalten. Die anderen Frauen mussten oft bis zu 16 Stunden lang malochen.“ Auf ihren eigenen Erfahrungen basiere Tolokonnikowas Ansatz für ihr Engagement: „Ich erhebe hier jetzt keinen Anspruch auf die letzte Wahrheit. Aber nötig wären: mehr Sport, eine größere Auswahl unter den Arbeiten, entsprechend den Talenten und Neigungen der Häftlinge, eine angemessene Bezahlung, so dass man sich ohne Unterstützung von außen auch mal etwas kaufen kann. Ich habe gerade mal 25 Rubel im Monat bekommen, dafür dass ich tagaus tagein Uniformen genäht habe. Das sind in Euro umgerechnet 60 Cent. Hätte ich nicht Lebensmittelpakete erhalten, wäre es mir schlecht ergangen. Ganz dringend müsste auch dafür gesorgt werden, dass Gefangene Mithäftlinge nicht fertigmachen. Auch Bildungsmaßnahmen finde ich wichtig: Warum soll nicht mal eine Theatertruppe im Knast zu Gast sein?“
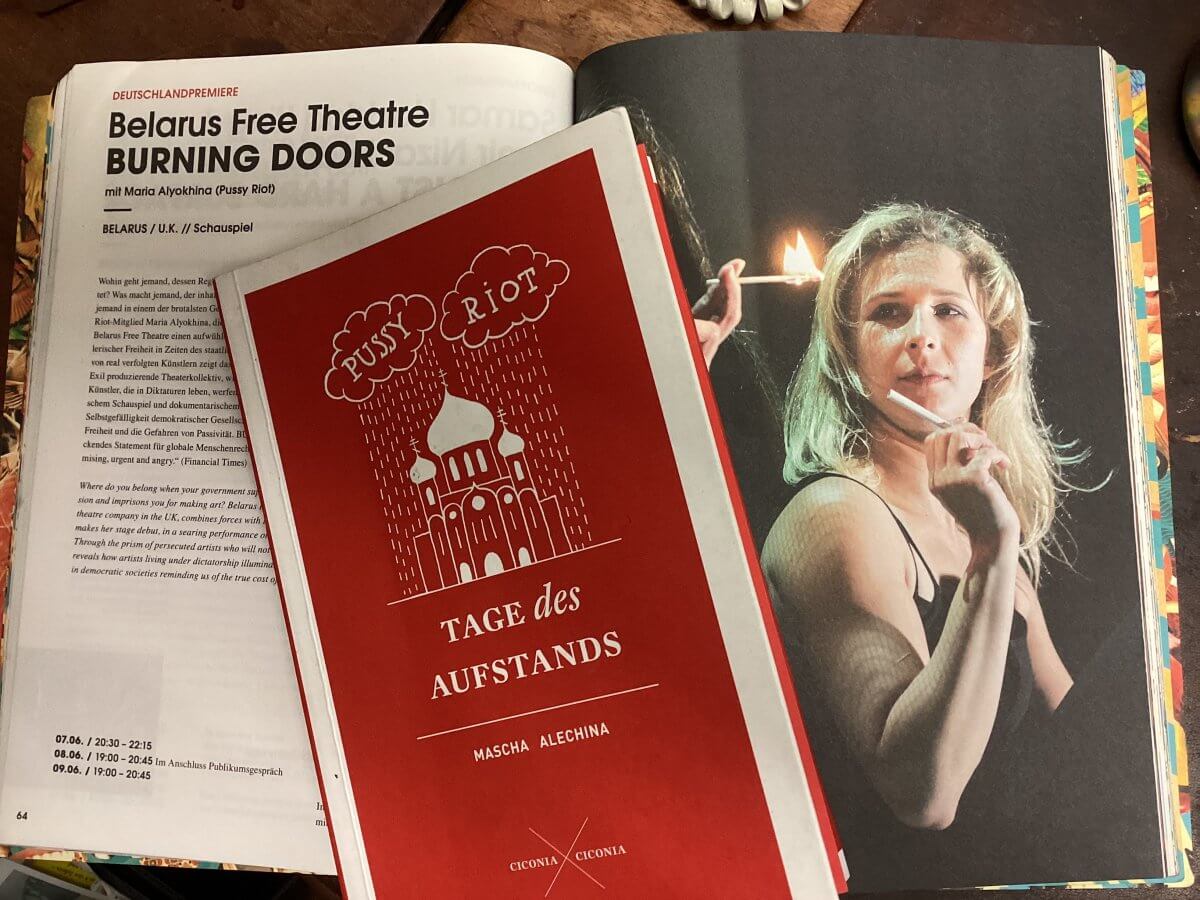
Aljochina wurde 2013 anlässlich der Olympiade in Sotschi freigelassen. Vier Jahre später tritt sie in Hamburg auf, beim „Theater der Welt“, zusammen mit dem Belarus Free Theatre, und steht zum ersten Mal auf einer Bühne. In einem ergreifenden Stück über künstlerische Freiheit, die trotz Unterdrückung weiter existiert. Als ich das aus Weißrussland verbannte Theaterkollektiv höre und sehe, weiß ich noch nicht, dass ich nur wenige Wochen später an der weißrussischen Grenze festgehalten werden würde – in einem uniformierten Szenario, das mir wie eine filmische Persiflage aller Militär- und Behördenapparate dieser Welt erscheint. Diese Erfahrung dauert für mich nur ein paar Stunden. Alechina hat zu diesem Zeitpunkt mehrere Jahre in einem der brutalsten Gefängnis-Systeme der Welt überlebt und ich bewundere ihren Scharfsinn und ihre Überzeugungskraft. Sie wird beim Publikumsgespräch gefragt, warum sie sich als Mutter eines Kleinkindes in die Gefahr einer Verhaftung begeben habe, und sie antwortet, dass sie gerade als Mutter gegen jede Art der Unterdrückung kämpfe. Auch wenn das ganz sicher nicht in ihrem Sinne ist, wähle ich sie an diesem Abend heimlich, still und leise zur Zarin der Zukunft: female – brave – fantastic!Von da an versäume ich keinen Auftritt von Pussy Riot. Im Mai 2023 tritt das feministische Künstlerinnen-Kollektiv in der Hamburger „Fabrik“ auf. Meine Banknachbarin Elisabeth ist extra aus Nottingham fürs Konzert von Pussy Riot nach hamburg gekommen. Wir stehen auf, als Alechina ruft: „We didn´t chose, where we were born,but we can choose to be a human!“ большо́й спасибо, Мари́я Влади́мировна Алёхина!
Im Arktischen Universitätsmuseum erreicht mich in der Ausstellung Sápmi – über eine uralte und zugleich sehr junge Nation – die mich im Geiste nach den egalitären Gemeinschaften von Peäccam (Petschamo) und den dortigen russischen Patriarchen entführt hat, nun der verlockende Call zu den letzten Waffeln dieses Solsøndag im Rotunde-Kafé. Bin gefolgt und hatte zwei (!), eine mit Jordbaer-, eine mit Bringebaer-Syltetoy (Himbeermarmelade), eine mit jordbær-syltetoy (Erdbeermarmelade), beide mit Römme (saurer Sahne).

Dann schickt mich die junge holländische Mitarbeiterin des Museums, sie ist 22 und macht in Tromsø ihren Master in Meeresbiologie, in die Ausstellung „Who are you, when the world is burning?“ im ersten Stock und ich war plötzlich unter Partisan*innen und Evakuierten. Unvorstellbar die perfekt organisierte Feuersbrunst, die Deutsche in Romsa (Troms) und Finnmarku (Finnmark) entfachten. Diese Ausstellung bringt es uns so nah, dass die Augen tränen. Und sie bringt mich nochmal an die Grenzen, die sich durch Sápmi ziehen und zu seinen grenzenlos agierenden Bewohner*innen, die mittels profunder Natur- und Ortskenntnisse viele verfolgte Menschen aus dem von der Wehrmacht besetzten Norwegen führten. Unter Einsatz ihres Lebens und des Lebens ihrer Familien. Nahe der Grenze zu Russland wurden Fischer*innen und Bäuer*innen zu Partisan*innen. Eine von ihnen setzte ihr Leben und das ihrer acht Kinder aufs Spiel, um Verfolgte und Vertriebene zu retten. Wie die Sámi Anna vom See Suoksavuomjávrre (norwegisch Makkvatnet) in der norwegischen Kommune Hamarøy, in der dünn bevölkertes Bergland an Schweden grenzt. Auch sie gehörte zu den „border pilots“, die im Herbst 1944 Flüchtlingen über die Grenze verhalfen.
Und mir wird schlagartig das ungeheure Ausmaß der von Deutschen mit höchster bürokratischer und militärischer Genauigkeit durchgeführten Evakuierung der Finnmark vor Augen geführt, bei der 50.000 Menschen ihr Zuhause für immer verloren, 12.000 Wohnstätten und ein großer Teil des materiellen Erbes der Sámi niedergebrannt wurden. Im Zuge derer die Stadt Tromsø, die damals 10.000Einwohner*innen hatte, 1944 rund 30.000 Menschen aufnahm, die Rede ist von einem Drama in der dortigen Kathedrale – und von ganz vielen individuellen Dramen.
Und als sie uns schon zum Aufbruch riefen, habe ich noch in der Abteilung Sámische Kultur die magischen Zeichen der vorchristlichen Religion, diverse Wohnstätten aus Naturmaterialien, einen Noaiden beim Trommeln. Als ob das arktische Universum mir auf die Schnelle noch sämtliche Illustrationen hinterherwirft, kurz vor der Rückfahrt. Und dann führt mich die holländische Studentin zum Bücherregal und da fällt doch tatsächlich ein Buch über Europas Hexenprozesse raus. Und eines über Runen, z.B. meine: B für Berkana (Birke).
Gittu! Mange takk!
Muss mich erstmal setzen, auf die nasse Bank im Dunkeln, draußen vorm Museum. Warm wird mir, als ich Franciskas Abschieds-Mail lese, quasi einen Lobgesang auf mein Wesen – mit dem ich ja auch oft anecke:) Mein Bargeld, kontanter heißt das hier, ist alle, die Preise sind dergestalt, dass eine sich am besten nicht drum kümmert; mein tragbares sibirisches Expeditionstelefon mit den großen Tasten, das seit meinem Zwangsaufenthalt an der weißrussischen Grenze, wo mir die Finger so zitterten, dass ich das unsmarte Device mit dem kleinen I nicht bedienen konnte, mit mir reist, kann keine Apps; und wo die Fahrkartenautomaten stehen, hatte ich bis zum letzten Tag nicht herausgefunden. Der Fahrer lächelt und lässt mich auf eigenes Risiko einsteigen. Eigentlich will ich zum Fjellheisen, der Seilbahn auf dem Festland. Aber dann stehe ich an der Haltestelle Skippergate und kehre um. Es sollte nämlich so sein, dass ich noch die kleinen Holzhäuser dort sehe und in jeder Weise aufnehme.
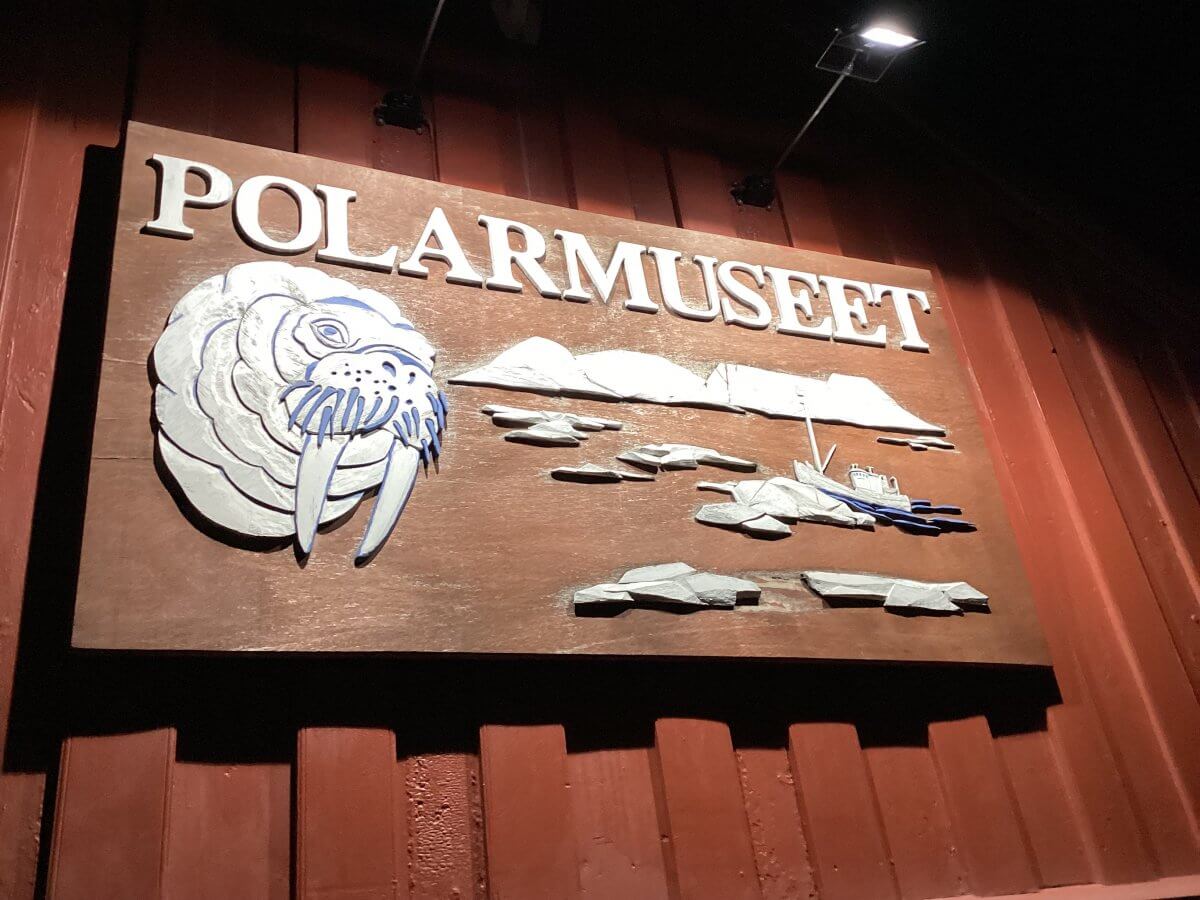
Das geschnitzte Walross überm Eingang des Polarmuseums erinnert mich an den russischen Film, der mir die Notlage der Tierwelt so in die Synapsen gehauen hat, dass die Information dort nicht mehr verloren geht. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür sie in mir bestimmt ist. Sollte auch das holzgeschnitzte Sámi-Paar treffen und die Musik vom utekino (Freiluftkino) hören, wo ich dann in dieser derzeit verregneten Stadt „Singin in the rain“ sah und das Heulen kriegte vor Glück, vor Unglück, berührt, angerührt.

So ein Moment, der mir mein Glück vor Augen führt und in die Seele fließen lässt. Am Kultkiosk auf dem Stortorget hocke ich mich an die verglimmende Feuerschale und fotografiere die schöne 18-Jährige, die ihn 1911 eröffnet hat. Heute ist er ein Wahrzeichen.
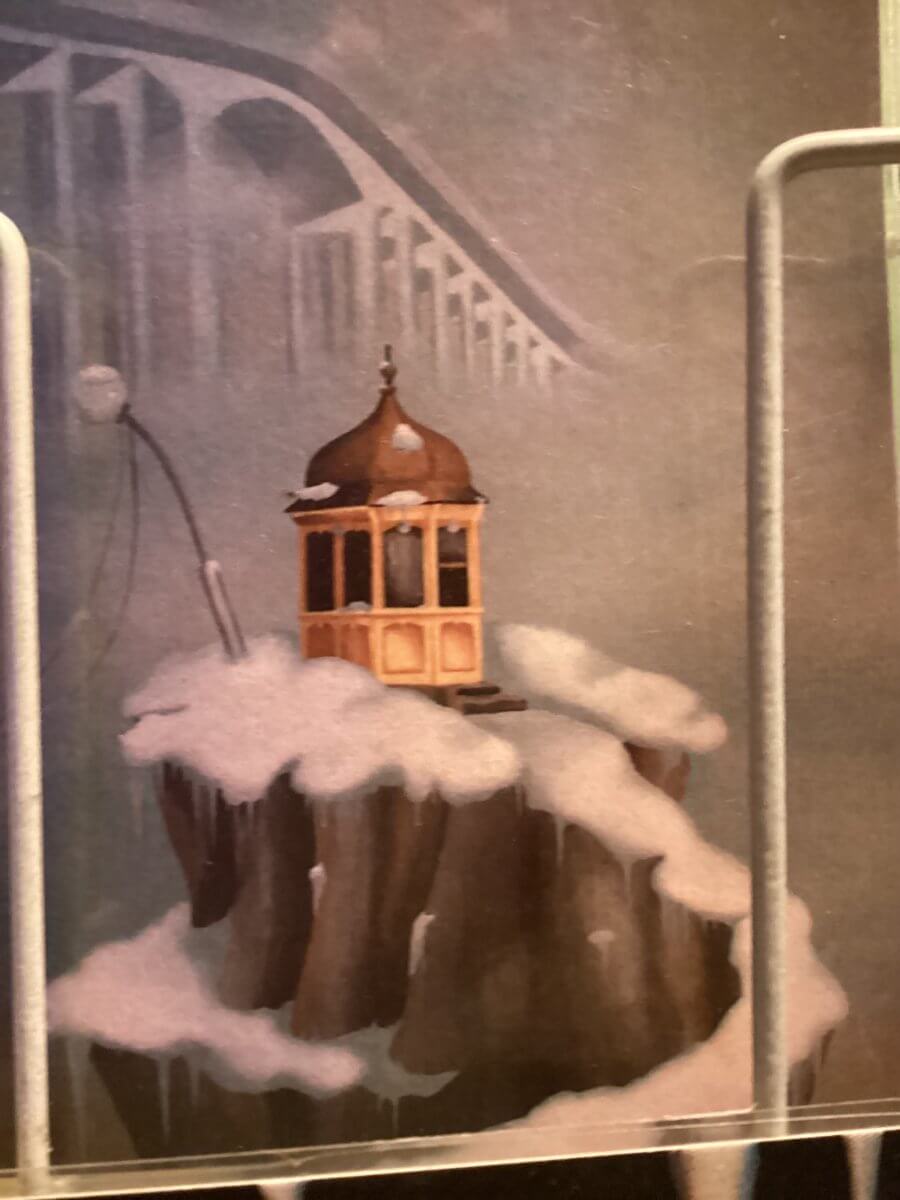
Entschließe mich fürs Kaia. Dort am Hafen, bei Richard, Sabrina … fühle ich mich zu Hause, esse Rentierfleisch, Apfelkuchen, blicke auf die Berge hinter den Booten. 1000 takk!

Versuche, bei der TIFF CLOSING PARTY im Storgata Camping wieder Fuß zu fassen und laufe in Clara hinein, die dort ihren 24. Geburtstag feiert. Wir futtern Pizza, sprechen über gewolltes Alleinsein, tanzen. Auf der Bühne tobt Ella Marie Hætta Isaksens Band ISÁK, sie joikt sich und uns die Seele aus dem Leib und wieder hinein. TIFF-Pressefrau Anne gesellt sich mit ihrer Lebensgefährtin zu mir, wir plaudern über queere Communities hier und dort; dann gerate ich an einen jungen Veganer, der mich fürs Fleischessen rügt, sich aber nicht fürs Fliegen. Womit wir mal wieder bei der vermeidbaren lateralen Aggression wären, von der Deep Green Resistance Aktivistin (Buchtitel auf Deutsch: DEEP GREEN RESISTANCE – Strategien zur Rettung des Planeten) Lierre Keith, geboren 1964 in den USA, Schriftstellerin, Kleinbäuerin, radikale Ökofeministin schreibt: „Wir müssen uns über den Individualismus erheben und in dem Wissen leben, dass wir die einzigen sind, die das Potential im Menschen für das Gute gegen das zerstörerische Machtstreben von Kapitalismus, Patriarchat und Industrialisierung verteidigen werden.“ Sie zitiert Dichterin Adrienne Rich: „Ohne Zärtlichkeit sind wir in der Hölle.“ Wir müssten Möglichkeiten finden, trotz Uneinigkeiten eine ernsthafte – ergänze: so zärtliche wie zielstrebige – Bewegung aufzubauen und unbedingt aus der Geschichte lernen! Eine Kultur, die um individualistische Erfahrung aufgebaut sei, könne den Planeten nicht retten. Also lasse ich den einen oder anderen fliegen:) und auch mal etwas links oder rechts liegen, erinnere mich stattdessen an meinen Schwur, mich für den Erhalt dieses traumhaften Planeten auf meine Weise einzusetzen, den ich auf einer Solo-Skitour über die Hardangervidda geleistet habe, und konzentriere mich auf die Belange der Walrösser, enorm energetisiert durch Ellas Joik, der noch nach Monaten in mir tönt.
Margareta, die im italienischen Bologna Film-Masterclasses betreut und bei Laurens´ Film Solo un pomodoro/Just a tomato mitgewirkt hat; Laurens und ich versuchen, den Bus 34 zu bekommen, der hat sich aber schon in Tromsøs Zentrum mit Feiernden vollgeladen und fährt vorbei. Wir bilden eine kleine Straßenbande und kapern ein Taxi, rollen auf dem Strandvegen zur Sydspissen, zur Südspitze, lassen die Telegrafbukta, die Telegrafenbucht mit ihrem Badestrand (!) links liegen, bewegen uns langsam und sicher auf dem Kvaløyvegen, dem Walinselweg, Richtung Sandnes-Sundet, der diese Insel, die mir gerade mindestens die Welt bedeutet, von der Walinsel und dem Nordpolarmeer trennt, am Stadtteil namens Sorgenfrei vorbei, quatschen über Parties und Filme. Hell wird es draußen an diesem Morgen noch lange nicht, aber in mir schon.
bestärke am Montag, den 23. – 14:43 Narvik 46,6 moh. –
vorher mache ich mich im stillen Haus am Grønlandsvegen um 05:00 an meine Morgenseiten (mindestens drei ungefilterte Herz-, Geist-, Seelenausschütte-DINA4-Blätter, mit Füller geschrieben), die auch einen tintenschwarzen Faden durch meinen Blog ziehen. Schreibe: „TROMSøA (das große norwegische Ö kriege ich gerade nicht aus meiner Tastatur auf den Bildschirm, da ist Füller auf Papier echt einfacher), Grønlandsvegen 48, 23/01/23, 05:15, 5 Grad, Sturm, Finsternis. Sitze am Esstisch meiner Noch-WG auf der Empore, vor mir der Strauß, den Laurens zur Premiere bekommen hat und das MORGENBLADET“. Kurzes Einsprengsel nachträglich: für dieses Blatt, das 1819 zum ersten Mal erschien, schrieb Cora Sandel ihre resebrev – Reisebriefe -, Blogbeiträge des 20. Jahrhunderts, Postings aus Paris u.a..
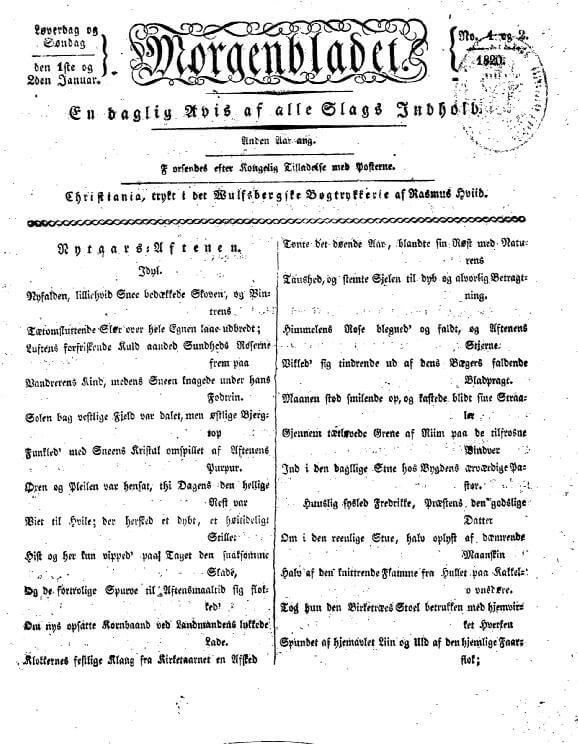
Morgenbladet, 2. Januar 1820
Weiter mit meinen „Morgenseiten“. Die sind, zusammen mit den Notizen in der schwarzen TIFF-Kladde, in die ich auch manchmal im Kino blind schreibe, und den kleineren hosentaschentauglichen Büchlein mein Logbuch. An jenem wehmütigen Abschiedsmorgen lese ich im Morgenbladet Jahrgang 204 ein Interview mit John Mearsheimer. Der US-amerikanische Staatswissenschaftler ist der Auffassung – die nun, wo sich die nationalistischen und imperialistischen Konflikte auf Polen, Weißrussland und das Baltikum ausweiten, wie von vielen Freidensforscher*innen vorhergesagt, besonders erwägens- und erwähnenswert erscheint -, dass die NATO und westliche Staaten den Angriff des derzeitigen russischen Präsidenten auf die derzeitige Ukraine provoziert hätten, indem sie sich dafür aussprachen, dass die ehemals zur Sowjetunion gehören Staaten Mitglieder der NATO werden sollten. Mitglied einer Allianz von 31 westeuropäischen und nordamerikanischen Staaten, die 1949 als Gegenspieler zur Sowjetunion gegründet wurde. Diesen geplanten Vorstoß der NATO hätten einige staatliche Führungskräfte in der Russischen Föderation als existentielle Bedrohung angesehen.
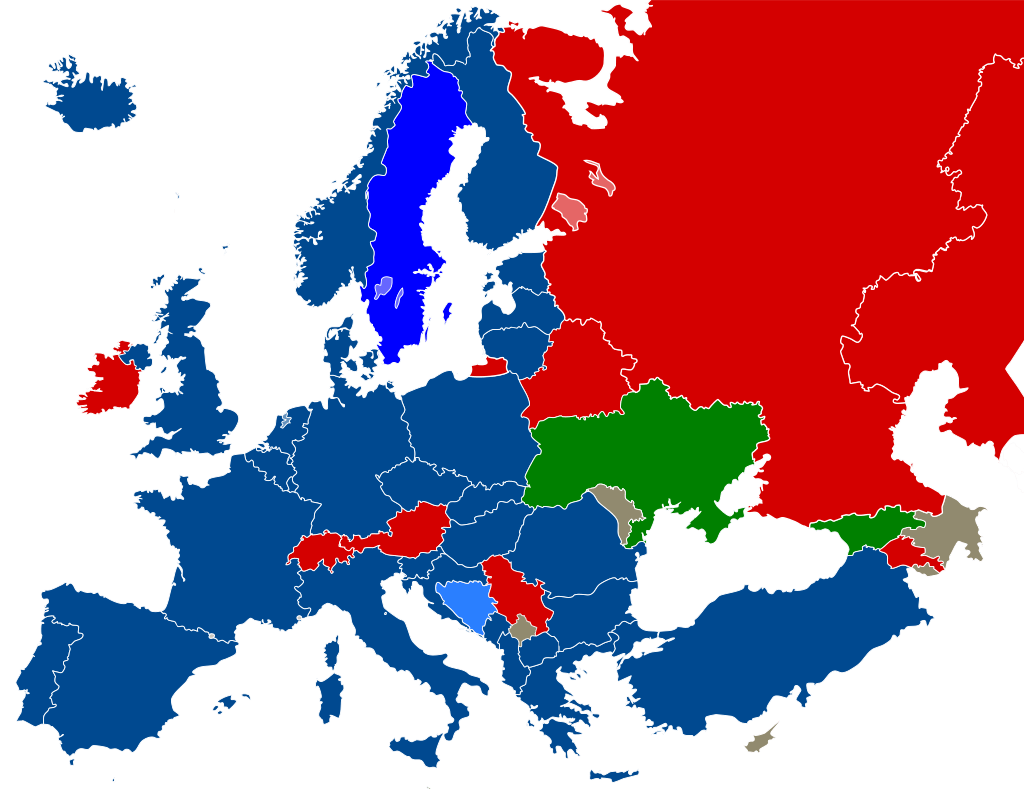
NATO-Vergrößerung
Laut wikipedia.no hätten die USA laut Maersheimer die russischen Warnungen davor ignoriert, die westwärts gerichtete Orientierung der Ukraine zu unterstützen. Die Situtaion habe sich, so der US-amerikanische Wissenschaftler, unter Trump, der unter anderem „defensive“ Waffen an die Ukraine verkauft habe und weiterhin durch Bidens Marineoffensive im Schwarzen Meer. Mearsheimer meine, laut wikipedia.no, dass nicht Putins imperiale Ambitionen und Irrationalität die Kriegsursache seien. Im Februar 2022 habe der Staatswissenschaftler gefordert, dass Russland eine deutliche Botschaft brauche, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werde. Er vergleicht Russlands Verhältnis zur Ukraine mit dem der USA zu Mexico und Kuba, wo die USA niemals akzeptieren würden, dass andere Großmächte Militärallianzen eingehen würden.

Der US-amerikanische Staatswissenschaftler John Mearsheimer gab dem Morgenbladet ein ausführliches Interview.
Und noch wird die Welt ja leider noch von diesen „großmächtigen“, weißen, alten Männern gesteuert, und wir sitzen alle mit in diesem Boot, sinniere ich – und greife mir am Grønlandsvegen, in der ebenfalls von Großmacht-Interessen bedrohten Arktis, zur Stärkung eine Scheibe Kneippbrød. Diese norwegische Spezialität geht auf den bayerischen Pfarrer Sebastian Anton Kneipp, wiegt 750 Gramm, ist aus Weizenschrot gebacken und watteweich.
Keine Denkverbote, denken ich und der norwegische Journalist, der statsviteren (direkt übersetzt Staatenwisser) Maersheimer zitiert, der wiederum denkt und sagt, – in meinen Worten – die mehr oder weniger autoritär regierten europäischen Staaten von Albanien bis Ungarn samt Bündnispartnern jenseits des großen Teiches hätten eine latent aggressive Rolle beim Wiedererwärmen des Kalten Krieges.

Kneippbrød wird aus grobgemahlenem, geschroteten Weizen gebacken und wiegt 750 Gramm. Av Fisle – Eget verk, CC BY-SA 4.0
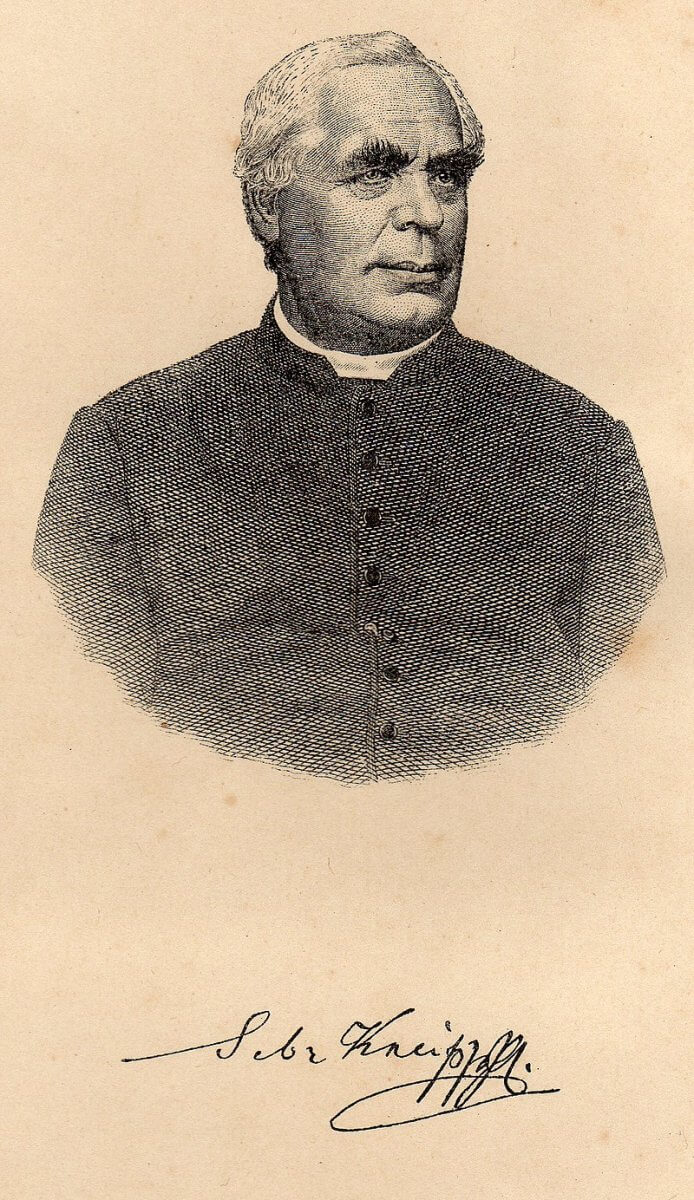
Und wer hat es erfunden? Sebastian Kneipp.
Auf meinem Frühstückstisch steht neben Kneippbrød und Morgenbladet ein großer Becher, verziert mit einem Mumin. Der entführt mich schnurstracks in meine lesehungrige Grundschulzeit. Es gibt ja wirklich Leute, die nicht wissen, was ein Mumin ist, das wundert mich immer wieder. Und für die stelle ich immer wieder meine Kindheitsheldin Tove Jansson – female – brave – fantastic – vor, die finnlandschwedische Schriftstellerin und Zeichnerin, die 1945 diese nilpferdartigen Mitglieder einer Trollfamilie schuf, die sich in einem Schärengarten tummeln und interessante Bekannte haben. Zum Beispiel die Hatifnatten, kleine spargelähnliche Gespenster, die nachts auch unter unserem Stockbett in Hamburg-Eilbek auftraten. Es hatte mich bei der Lektüre nicht überzeugt, dass sie nur bei Gewitter auftreten, die elektrische Ladung von Blitzen suchen und dann selbst geladen sind, sodass man an ihnen einen Schlag bekommen kann, und bei Erdbeben verwirrt werden und die Flucht ergreifen.
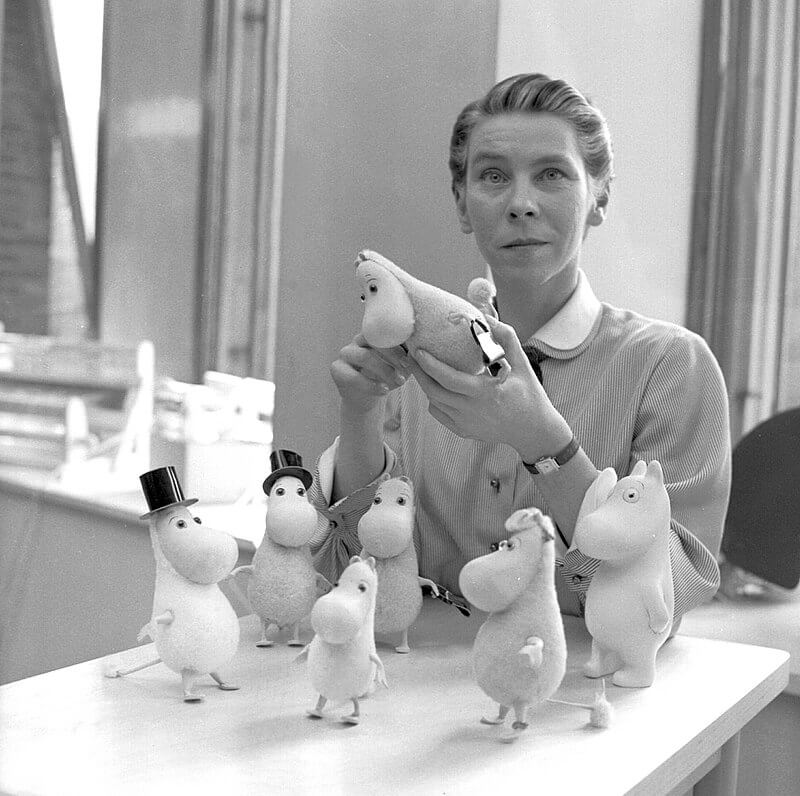
So sah das aus, als ich zwei Jahre alt war. Nur wenige Jahre später wurden mir Tove Janssons Mumins wichtige Kumpel, die wussten nämlich echt Bescheid! Verfasserin und Zeichnerin Jansson schuf in den 1950er-Jahre ein lebensbegleitendes Paralleluniversum.
Zumal wir in Hamburg damals eher Flutkatastrophen als Erdbeben zu befürchten hatten. Aber dass die schwerhörigen, stark kurzsichtigen, fast taubblinden Hatifnatten sich untereinander auf nicht genau bekannte Weise verständigen, habe ich verstanden. Mein persönliches Mumin-Universum enthielt neben solchen Finessen auch lebensbegleitende Infos zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und geschürte oder berechtigte Angst vor Katastrophen (wir wohnten im dritten Stock und weit von der über die Ufer tretenden Elbe entfernt – und niemand hat uns Kindern Angst vor Viren implantiert, eher hingen noch die Katastrophen des Krieges, der bei meiner Geburt ja erst neun Jahre her war, in der Luft, davor bewahrte mich dann manchmal meine Trollwelt). hjärtligt tack, Tove!! Im Muminbecher befindet sich norwegisch aufgegossener, kokemalt, Kaffee. Das ist grobgemahlener Kaffee, der in den Kaffeetrinker*innenländern Norwegen und Schweden traditionell in einer Kanne oder Kasserole aufgekocht wird. So spart eine sich Filter und andere Utensilien. Solche Blechkannen stehen in der Hütte auf dem Ofen. Mir dienten dieser Kaffee und ein Glas Wasser mit solbærsirup, Sirup aus schwarzen Johannisbeeren dazu, den Abschied zumindest bittersüß zu gestalten. Vor mir lag auch das Buch von E. M. H. Isaksen, „Norges hotshot“, wie es im Internet steht über diese künstlerische, kulturelle und politische Botschafterin der jungen Sámi-Generation. Es gibt bisher nur eine norwegische Ausgabe von „Deshalb musst du wissen, dass ich Sámi bin“. Und die nehme ich mit. Als Reiselektüre, als Aufklärungsschrift.
Mein Gepäck sind vier Gebinde: der karierte Koffer, der orange Stoffbeutel von den Nordischen Filmtagen, der auch schon Sibirien bereist hat, ein norwegischer Lederrucksack, der in seinem Herkunftsland sentimentales Schmunzeln auslöst, eine große schwarze Umhängetasche nach Jägerinnenart, die zwar ein sehr scharfes Messer, aber keine Beute enthält.
Habe Laurens zur knallharten, hauchzarten Schöpferkraft der 20plus-Jährigen dieser 20er-Jahre gratuliert und von meinem Ortszeit/KarierterKoffer-Projekt erzählt: hinfahren – eintauchen – über den Ort schreiben, wie er war, ist, vielleicht sein wird. Er zeigt sein Roadmovie von der Trompeterin, die nicht fliegen will möglicherweise im November in Lübeck. Herzlichen Dank, Laurens! Mange mange takk til kollektivet pa grönlandsvegen!
Versinkende Touristen oder Verlockende Umhänge
Irgendwas bringt mich dazu, nicht den von Laurens empfohlenen Bus (Linie 33 Gevaersbukten Richtung Uni) um 09:43 von Alaskasvingen zu nehmen, sondern einen Bus früher. So treffe ich Vibekke, Jahrgangsgenossin Vibekke Torp (ein Hoch auf all die Öffies dieser Welten, diese Verkehrsnetze toppen bezüglich aktueller und traditioneller Infos jedes Internetportal). Wir schwärmen zusammen, während wir am Sandnes-Sund durch den Stadtteil namens Sorgenfrei gleiten, uns chauffieren lassen und zurücklehnen, von unserer dritten Jugend. Wie ich wurde Vibekke 1954 geboren. Aber in ihrer Familie haben die übergriffigen und größenwahnsinnigen Großmachtbestrebungen des damaligen deutschen Reiches andere Verwüstungen hinterlassen als in meiner. Ihre Schwiegermutter wurde von deutschen Soldaten aus der Finnmark deportiert, ihren Hof und ihre Tiere haben diese Kriegsverbrecher niedergebrannt. Vibekke spricht trotzdem Deutsch. Sie hat es in der Schule gelernt und nach der Schule mit einem österreichischen Akzent versehen, in Salzburg. Wir beide schwören auf internationale, friedfertige Begegnungen und bedauern, dass unser Gespräch an der Haltestelle Terminal enden muss. Sie wirft mir aus dem Bus noch schnell zwei meiner Gepäckstücke zu. Wir zwei sind zwar keine volve – obwohl: welche weiß das schon genau? – aber in jedem Fall hat uns das lange Leben ermächtigt. Mange takk, Vibekke!
Steige am Roald Amundsens plass aus. Roald Engelbregt Gravning Amundsen verschwand um den 18. Juni 1928 in der Nähe der Bäreninsel in der Inselgruppe Svalbard (Spitzbergen), er war damals von Tromsø mit einem Flugzeug namens Latham 47 gestartet.

Latham 47 vorm Abflug in Tromsø am 18. Juni 1928. Foto: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum
Über Amundsens Expeditionen zu Wasser schreibt Christoph Ransmayr in Die Schrecken des Eises und der Finsternis, er werde in den Jahren von 1903 bis 1906 „auf der Gjøa zwei Polarnächte überstehen, mit dem Eis driften und die Bering-Straße über die Nordwestpassage erreichen“. Dies sei eine Passage ohne Verkehrsbedeutung und Wert für den Handel, weil sie nur um den Preis einer jahrelangen Eisgefangenschaft zu befahren sei. Und über dessen Statue auf dem nach ihm benannten Platz, sie erhebe sich „drei Meter, vier Meter hoch, „weit über alle Maße des wirklichen Lebens“.
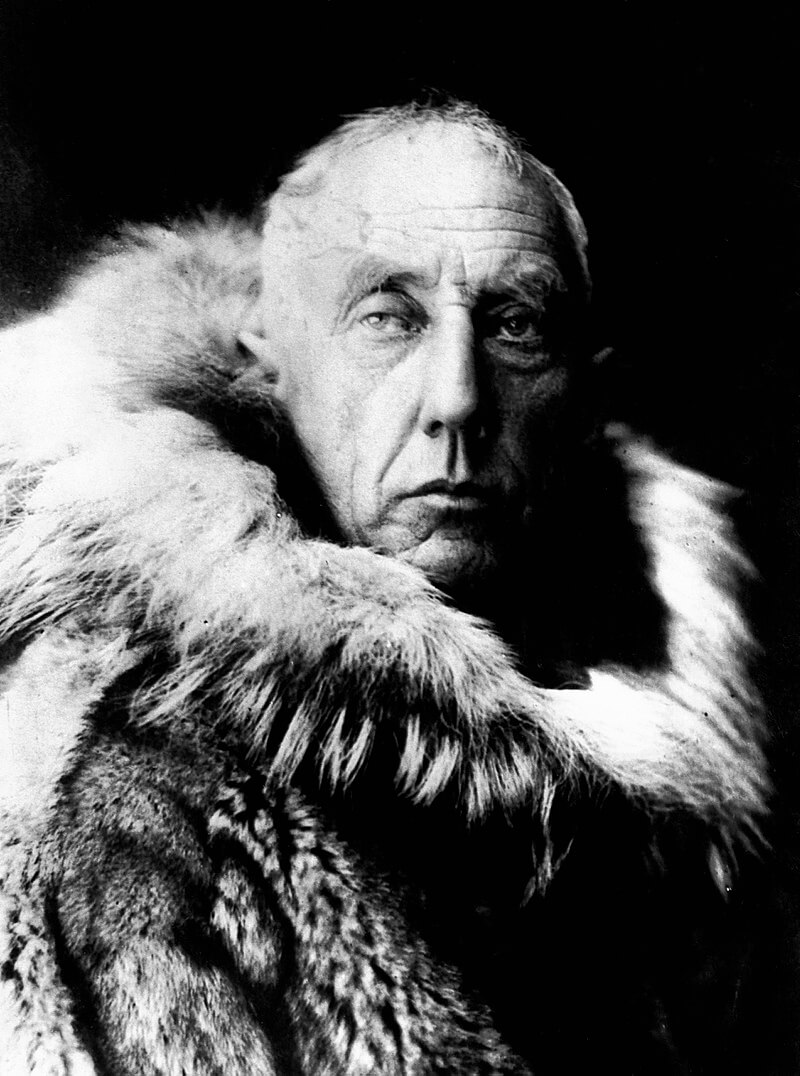
Roald Amundsen (1872-1928) im Pelz
Für die Norweger war und ist ihr polfarer og oppdagelsesreisende (Entdeckungsreisender) ungeheuer wichtig, wurde er doch um 1905, als ihr Land gerade Nation geworden war als deren Held gefeiert. Die muss eine außernorwegische Antiimperialistin erstmal verstehen, die Sache mit den imperialistischen Personalunionen des Landes namens Weg nach Norden oder Land nach Norden, so wird das altnordische Wort norðrvegr übersetzt; des Landes entlang der schmalen Fjorde, hergeleitet vom Wort norvegr, dessen erste Silbe auf das Wort nor zurückgeht, das Meerenge, auch schmaler enger Sund, Belt, Fjord bedeutet. Das dachte ich schon als Studierende, als ich neben Physik, Chemie, Zoologie und Botanik Norwegisch lernte und mir ein norwegischer Linker und Staatskritiker, unser Dozent, die für sein Land so bedeutsamen Verbindung von selbstständigen Staaten durch ein gemeinsames Staatsoberhaupt verklartüdelte, die nach allgemeiner Staatslehre als Personalunion bezeichnet wird. Zu solcherart Vereinigungen, wo auch immer besiegelt, gehörte das sagenhafte Land seit 1380. Bis zum 17. Mai (heute Nationalfeiertag) 1814 währte die Union mit Dänemark, es folgten eine kurze Unabhängigkeit, 91 Jahre staatliche Verbindung mit Schweden, neuerliche Unabhängigkeit ab 1905. Da begann die Zeit der Nationalhelden, zu denen Amundsen zählt. Den es allerdings vom Staat entlang der schmalen Fjorde aufs Stärkste wegzog. So richtig gut verbunden war der Forscher und Seemann vielleicht nur mit Tromsø, wo er auf einer Werft die Gjøa fand, das erste Fahrzeug, das durch die Nordwestpassage segelte. Genauer, das erste, dessen Fahrt offiziell gefeiert wurde. Ransmayr erstellt im oben genannten Roman eine Chronik des Scheiterns von Passagensuchern und beginnt diese mit einem Hinweis auf all die verschollenen Walfänger und Tranjäger, „die das Nördliche Eismeer jährlich befuhren, ohne ihre Unternehmungen mit dem emphatischen Namen einer Expedition zu versehen.“ Auch sie hätten Entdeckungen gemacht, die allerdings Kosmographen lange verborgen blieben, „sie kannten das Eis und schiffbare Routen besser als die Vertreter der Akademien“, aber was „sind zehn verschwundene Robbenschlägerfregatten gegen ein einziges Expeditionsschiff, das im königlichen Auftrag segelt und sinkt?“ Wer seine Arbeit auf einem Fangschiff verrichtet, hat keinen Anspruch auf Ruhm. Aber den Expeditionen, und seien sie noch so erfolglos, ein Denkmal.“
Womit wir wieder auf dem Roald Amundsens plass landen und beim gefeierten Passagensucher und seinen Verbindungen zu Tromsø, wo sein guter Freund, der Apotheker Zapffe tätig war, von wo er auf Spitzbergen-Expedition aufbrach und auf seine letzte Reise. Auch für die gibt es ein Denkmal auf dem Platz, Lathammonumentet. Es erinnert ans Flugboot Latham, mit dem Amundsen am 18. Juni 1928 startete, um nach Umberto Nobile zu suchen, der mit dem Luftschiff Italia nach dem Flug zum Nordpol havariert war. Nobile wurde gerettet, aber niemand weiß, was mit der Natham geschah, weder Mannschaft noch Flugboot wurden gefunden.
Auch ein weiteres Denkmal auf diesem Platz erinnert an einen Mann, an den 1777 in der Nähe von Tromsø geborenen Eidis Hansen. Zunächst galt er als eher kränklich und schwach und soll dann aber zu enormen Kräften gekommen sein, die ihn in den Stand setzten, nach einer Kneipen- und Brandwein-Auseinandersetzung einen Felsen von 371 Kilo zu versetzen. Sagenhaft.
Ich ignoriere all die legendären Kerle und steuere schräg über den Platz das Ufer von Prostneset an, die Spitze der Landspitze (nes). Im Namen steckt auch ein Probst, denn das Areal am Sund, südlich der bereits im 13. Jahrhundert errichteten Domkirche gehörte der Kirche. Und ich stoße zwischen all den Herren auf eine, die die alte Kirche gemalt, und das Prädikat female – brave unbedingt verdient hat: Kirstine Aas, født (geborene) Colban. Zunächst finde ich Erwähnungen als Nordnorwegens erste Amateurmalerin, die 1820 einen Prospekt für die Stadt Tromsø erstellt und auch einiges geschrieben habe. Den Frauen werden in der Regel nicht so riesige digitale Monumente errichtet, aber ich nehme die Fährte auf. Und finde bei nb.no ein Foto einer Malerei, das 1929 in der Zeitung Nidaros (einer Zeitung, die in der Stadt Trondheim, deren alter Name Nidaros war, von 1909 – 1990 erschien) abgedruckt war. Es zeigt Colban (darauf, dass die Zeichnerin und Autorin zu diesem Zeitpunkt verheiratet war, deutet die Haube, die verheiratete Europäerinnen ihrerzeit trugen) im grönländischen Asyl.
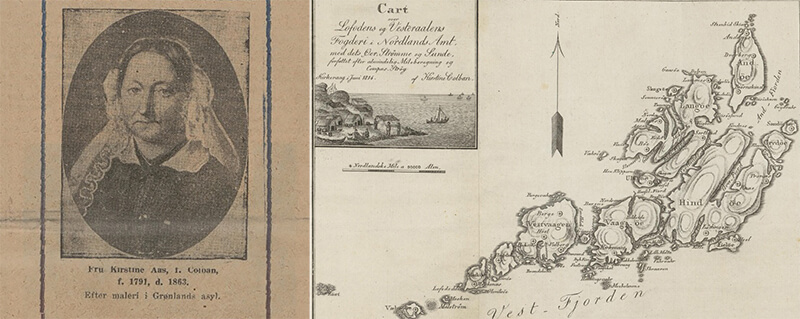
Wie sie dorthin geraten ist, klären wir später. Die Karte „over Lofoten og Vesterålen“ zu ihrer Rechten ist spannender. Lofoten hatten wir. Vesterålen ist ein Inselreich nördöstlich der Lofoten. Und Colban ist laut Artikel der norwegischen Journalistin Live Vedeler Nilsen, die für die Nationalbibliothek Web-Inhalte erstellt, die erste norwegische Kartenzeichnerin, die erste weibliche Kartograf*in Norwegens also. Multikünstlerin Coban kartierte und verfasste auch Gedichte und Lieder über die von ihr kartierte Umgebung: „Helt oppe i Norrige, langt mod Nord, Paa hiinside Vestfjordens Lede, Der findes en hob af Øer saa stor, At et Fogderie de berede …“. Hoch oben in Norwegen, weit im Norden, jenseits des Vestfjords (kein Fjord, eher eine breite Bucht zwischen den Lofoten und dem Festland), findet sich ein Haufen Inseln, so groß, dass, ja was? Fogderi hießen die von einem Vogt regierten Bezirke in Norrige (so nennt Colban ihr Land entlang der schmalen Fjorde, ihr wisst schon); und berede heißt bereiten. Da enden meine Kenntnisse. Ich aufbereite frei: diese große Menge Inseln dort oben taugen mindestens für einen Bezirk. Und füge mal schnell doch noch einen Mann ins Bild: Edvard Otto Rossing Skari, Marinemaler aus Kristiania, wie das heutige Oslo in seinem Jahrhundert, dem 19., hieß.
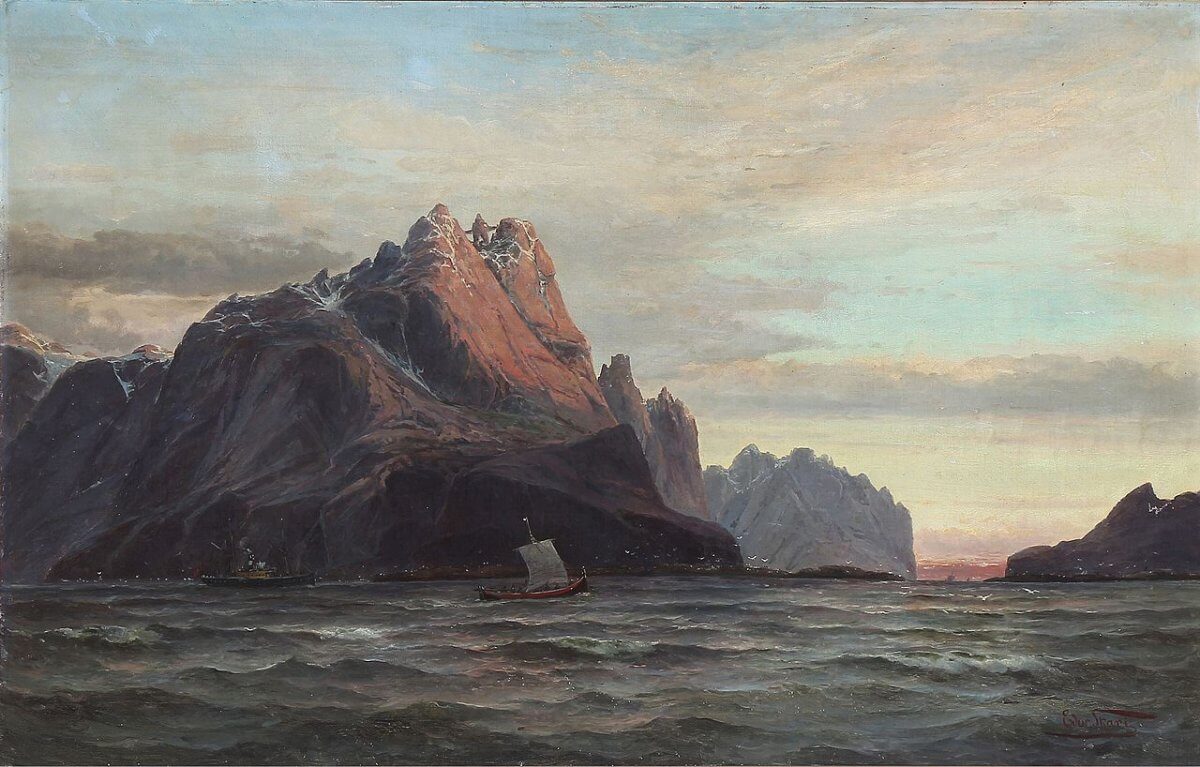
Vestfjord, Edvard Otto Rossing Skari
Der hat uns nämlich das allerschönste Bild vom Vestfjord beschert, dass ich finden konnte. Von Autorin Nilsen erfahre ich, dass diese wilde Landschaft, in der Colban aufwuchs, deren Malerei und Poesie inspiriert hat. Die älteste gedruckte Landkarte dieses Bereichs der Inselgruppen Lofoten und Vesterålen, so sagt Benedicte Gamborg Briså vom Kartografie-Zentrum der norwegischen Nationalbibliothek, stamme von Colban. Sie zeichnete sie im Alter von 23 Jahren. Und signierte sie mit einer Spirale, einem Symbol für den Moskenesstraumen, sagt Briså. Der Moskenstraumen (norw. Moskenesstraumen oder Moskstraumen), ein Gezeitenstrom zwischen den Lofoten-Inseln Moskenesøy und Værøy ist sozuschreiben die Mutter aller Mahlströme und taucht in historischen Bildern und Büchern auf, bei Olaus Magnus, Edgar Allan Poe, Jules Verne. Und bei Petter Pettersen Dass, hva sier gamle Petter Dass? sangen wir mit den norwegischen Trink-Kommiliton*innen. Was sagte Autor und Theologe Dass im 17. Jahrhundert? In den 16 Strophen seiner Dichtung ditt dyre navn og ære, „deinen Tieren Name und Ehre“, einem Lobpreis der Schöpfung, führt er unter anderem alle vor der Küste des heutigen Distriktes Helgeland im Süden des heutigen Bezirkes Nordland lebenden Fische namentlich an. Und was singt Colban, die den Mahlstrom als Signet und Icon wählte, 200 Jahre später? Auch sie preist die Schöpfung, als Multikünstlerin und Kartografin. Wie schreibt die Dichterin? Ihre geglückte Immitation des mittelalterlichen Dichtertones sollte eine/r nicht verkennen, schrieb 1843 über Aas’ alias Colbans Gedichte die 1902 von Alfred Eriksen, Mitglied der Arbeiterpartei, Journalist, Priester, Politiker usw. gegründete Zeitung Nordlyset. Und die weiß Bescheid: nordlys.no bespielt bis heute Nordnorwegens wichtigste Medienkanäle. Und druckte damals Colbans Gedicht über den Berg Vågakallen. In Norges arktiske universitetsmuseum (uit.no) liegen zwei von Colban, die in der norwegischen wiki Kristine Kristine Stine Grøn Aas heißt und deren posthume Gedichtsammlung Nogle dikte, die Autorinnenbezeichnung Stine Aas bekommt, die 1829 ihre Erinnerungen des Probstes Erik Andreas Colban anonym herausgab, gestaltete Prospekte über Tromsø.
Und da müssen jetzt wieder hin. Wo waren wir stehengeblieben? Auf der Landspitze Prostneset. Dort eröffnete 2018 eröffnete gläserne havneterminal. Tromsø hat ja keinen Bahnhof, deswegen ist das Terminal Prostneset, wo Hurtigrute und die Überlandbusse ablegen für uns Passagiere so wichtig. Und inzwischen weiß ich als hörende und sehende Passagierin auch, dass der Personentransport mit der Hurtigroute von dort zu den oben beschriebenen Inselgruppen bezahlbar ist, wenn eine keine Kreuzfahrt bucht sondern ein öffentliches Seeverkehrsmittel. Das erfahre ich von George Alexander, 62 Jahre. Er macht erstmal ein prima Foto von mir, im Busterminal. „ARE YOU LOST?“ steht dort auf der Tafel.

No! I don´t get lost, because I meet such beautiful people, or in fact: they meet me, somehow. He loved the way I was calling him by his name. And I loved his ways: Er sitzt mit mittelgroßem, eher kleinem Gepäck in der Wartehalle für die Busse. Ich frage ihn, ob er auf den karierten Koffer aufpasst, während ich Kaffee hole. Da hat George eine bessere Idee, läuft rüber zum Hotel, in dem er arbeitet – es ist The Edge und verfügt über Tromsøs einzige Skybar und größten Konferenzsaal (siehe unten) – und organisiert uns exquisite Getränke.

Auf der Busfahrt nach Narvik, über die Brücke zum Festland; am Sund, der wegen der starken Strömung nicht zufriert; am Meer; wo es laut George zu viele Quallen gibt zum Baden – wie Cora Sandel steht er auf die Telegrafbukta – an steilen Bergwänden und tauenden Gewässern entlang, versorgt mich mein Reisegefährte mit Stories.
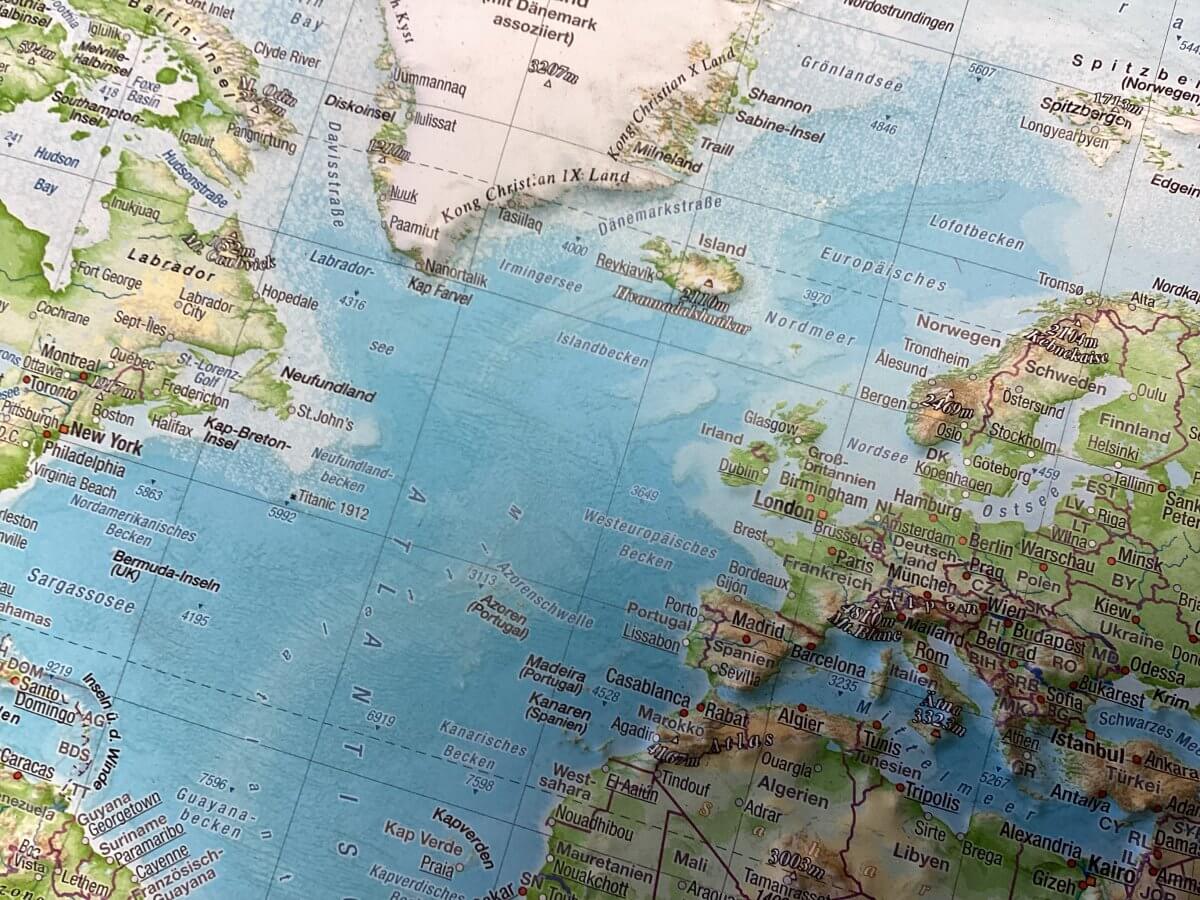
George stammt von den sogenannten West Indies vor den Amerikas, die nur so heißen, weil Christoph Kolumbus in dieser Gegend eigentlich den Seeweg nach Indien suchte, von den windward islands, den Inseln in Luv, windwärts, übersetzt Inseln unter dem Winde. So nennen von Europa kommende Seefahrer den Teil der Antillen, der dem feuchtigkeitsspendenden Einfluss ebenfalls aus östlichen Richtungen kommenden Passatwindes ausgesetzt ist.
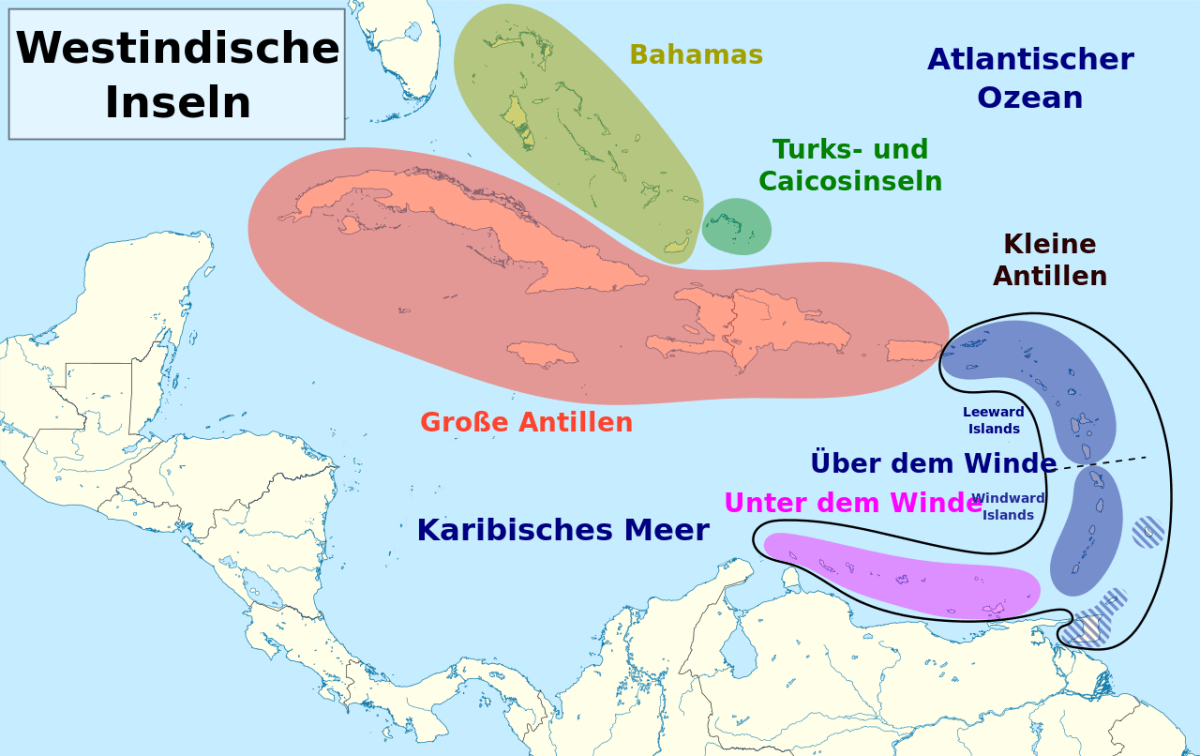
Seine Insel Barbados wurde zunächst von Arawak (Aruak, Arawaken) und Kariben – eine Bezeichnung für mehrere indigene Völker Süd- und Mittelamerikas – bewohnt. Nach den Kariben sind der westliche, nördlich des Äquators gelegene tropische Teil des Atlantiks und seine Inseln benannt.

Eine Arawak, die Gravur stammt von John Gabriel Stedman, geboren 1744 in Flandern als Sohn einer Niederländerin und eines Schotten. Stedman wurde er als Soldat nach Südamerika beordert, um dort Sklavenaufstände niederzuschlagen. In seinem illustrierten Narrative of a five years‘ expedition against the revolted Negroes of Surinam bezeichnet er die zu verkaufenden Sklaven, die in der holländischen Kolonie Surinam eintreffen als fellow creatures, sieht sie als ebenbürtige Geschöpfe, die den Europäern keinesfalls unterlegen seien, und äußert die Meinung, die in seinem kulturellen Umfeld sowohl wissenschaftlich umstritten als auch ziemlich progressiv war, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung hätten.
Seine Heimat war mit Regenwald bedeckt, bevor die Europäer dort in größtem Stil Zuckerrohrplantagen errichteten und sie in christliche Kirchspiele unterteilten wie Saint Lucy im Norden, wo George geboren wurde.

St. Lucy, der Norden von Santa Lucia, der nördlichste Punkt der Insel Barbados, Von Jonathan Wilkins – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
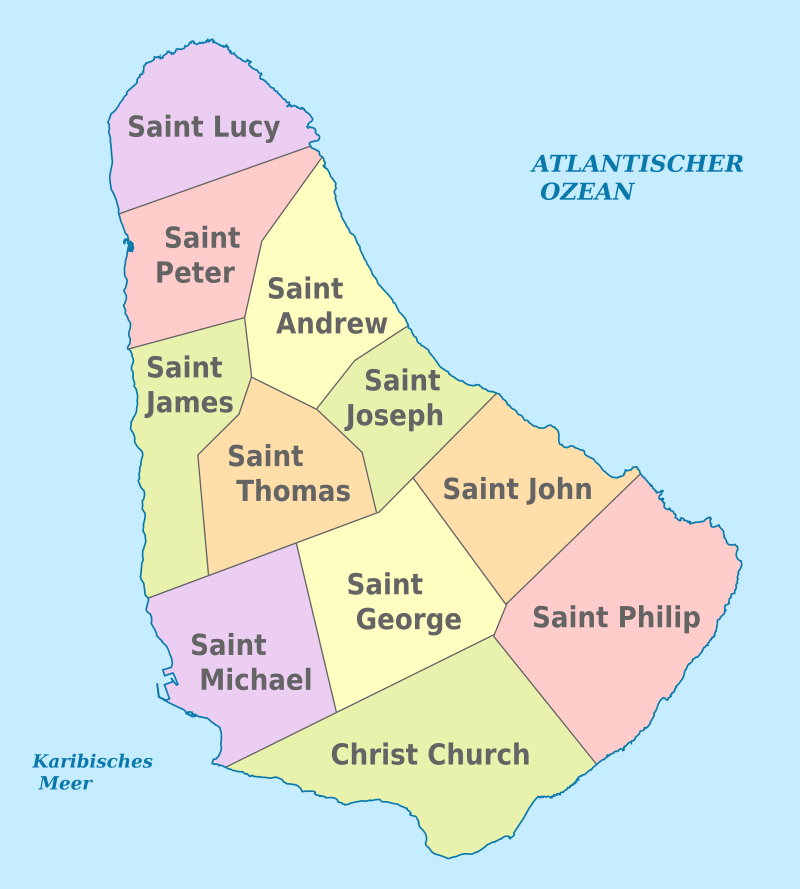
In Saint Lucy erlebt George, wie die britische Kolonie 1966 unabhängig wurde, allerdings weiterhin in Personalunion, durch eine gemeinsame Königin, mit der britischen Krone verbunden war. „The british are killers“ oder „I hate the queen“.

Königin Elizabeth II und die Premierminister aus dem Commonwealth auf dessen Konferenz 1960, Windsor Castle
Mit solchen Ansagen ist George großgeworden. Später verschafft ihm sein 2013 geborener Namensvetter George Alexander Louis of Wales, einen Brief und ein Geschenk der Urgroßmutter gewordenen Königin.
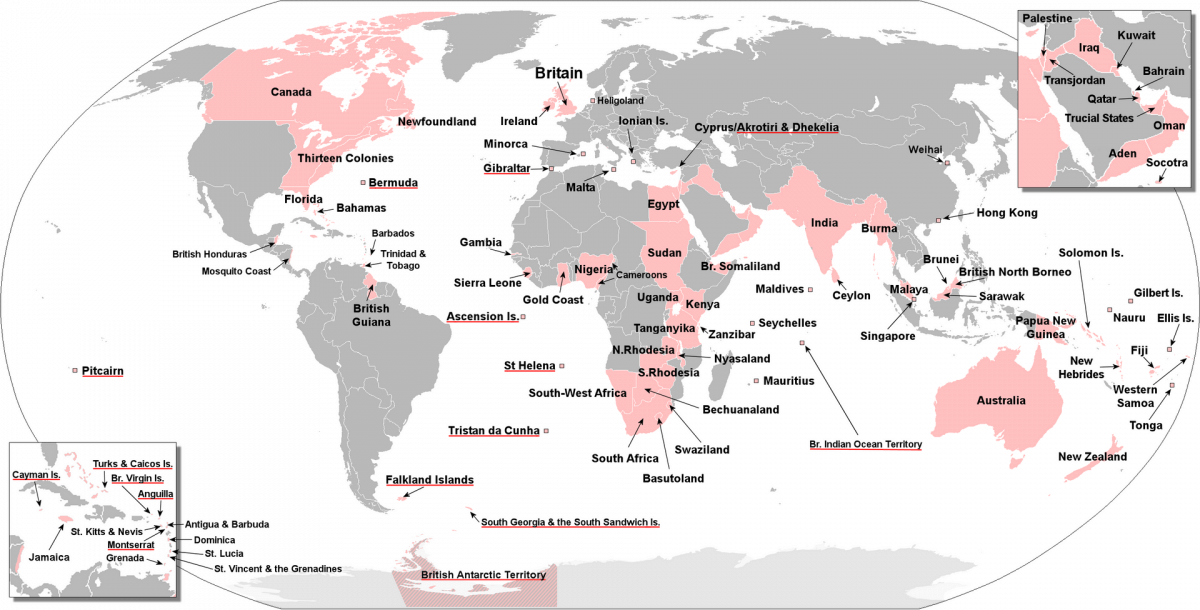
Gebiete, die ehemals Teil des Britischen Weltreichs waren (heutige Territorien sind rot unterstrichen)
Die erste Heimat von „meinem“ George Alexander gehört zum Commonwealth of Nations. Common wealth bedeutet gemeinsamer Reichtum. Aber darum ging es sicher nicht, als der größte Inselstaat Europas, das vereinigte Großbritannien und Nordirland in seinem Weltreich, zu dem Anfang des 20. Jahrhunderts ein Viertel der Weltbevölkerung zählte – die Bewohner der Dominions, der Herrschaftsgebiete dieses europäischen Königreichs, wurden schlicht British subjects, Untertanen, genannt – als die leader in London beschlossen, ehemalige Kolonien, vor allem die mit starken Autonomiebestrebungen, enger an ihr empire zu binden, mit Hilfe einer Vereinigung von Staaten, deren Wohlstand im Gegensatz zum vielversprechenden Namen kein gemeinsamer war.
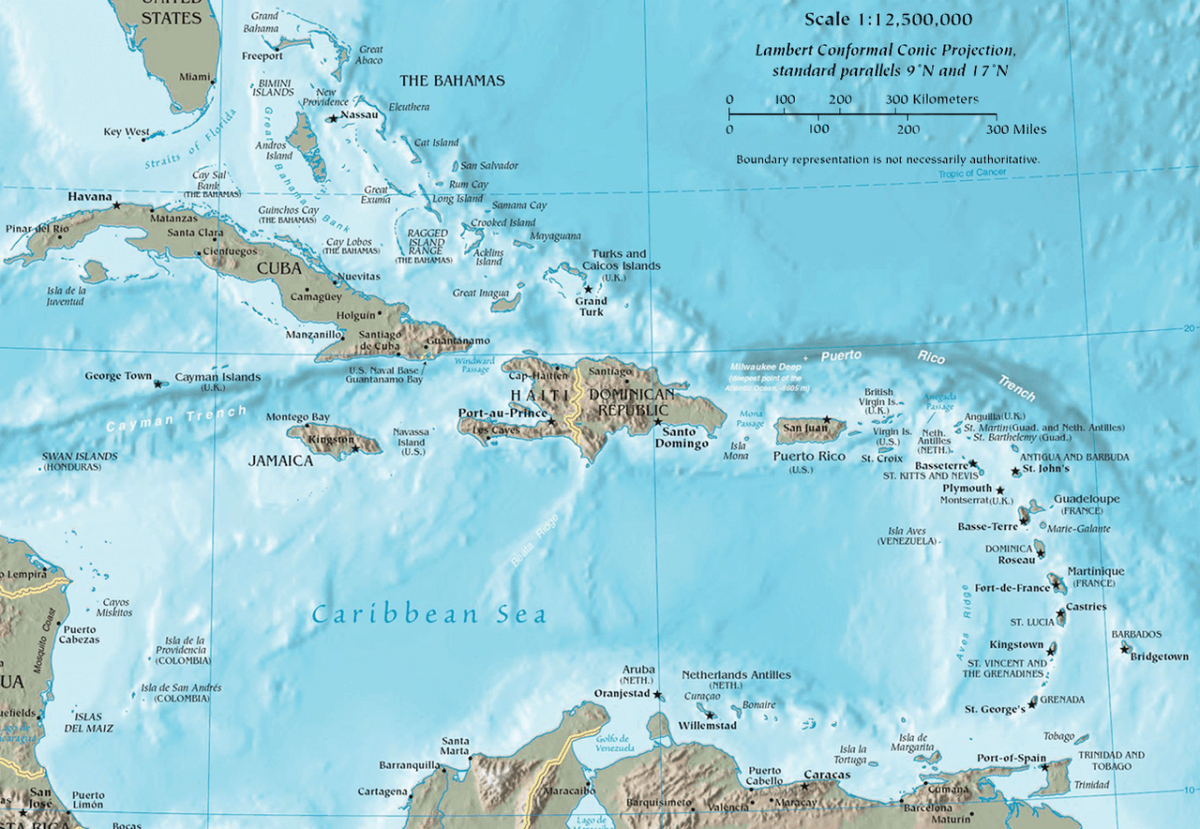
Karibik, südlich das Karibische Meer, nordwestlich der Golf von Mexiko, östlich der offene Nordatlantik
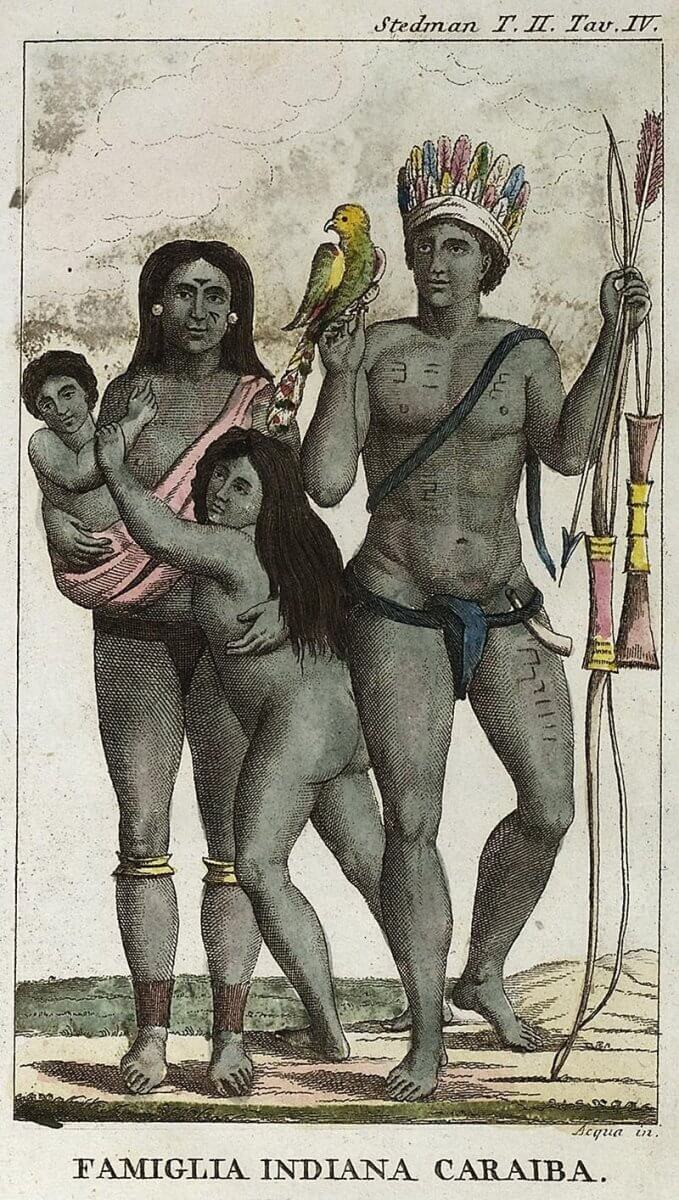
Kariben, John Gabriel Stedman
George wächst als eines von 13 Kindern einer alleinerziehenden und -ernährenden Mutter auf und muss Geld verdienen, sobald es irgendwie möglich ist. Mit 15 Jahren nimmt er die Arbeit auf, im Steigenberger Cariblue Hotel. Namensgeber Albert Steigenberger kaufte in der Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts den Europäischen Hof in Baden Baden, spezialisierte sich dann auf Herbergen mit negativem Kontostand und begründete die Hotel Group, die sich heute Deutsche Hospitality nennt. Mit zunehmendem Flugverkehr steuerten die deutschen Hoteliers die Karibik an. In den 1960-ern errichtete Steigenbergers Sohn das Haus in St. Lucia, das Cariblue.
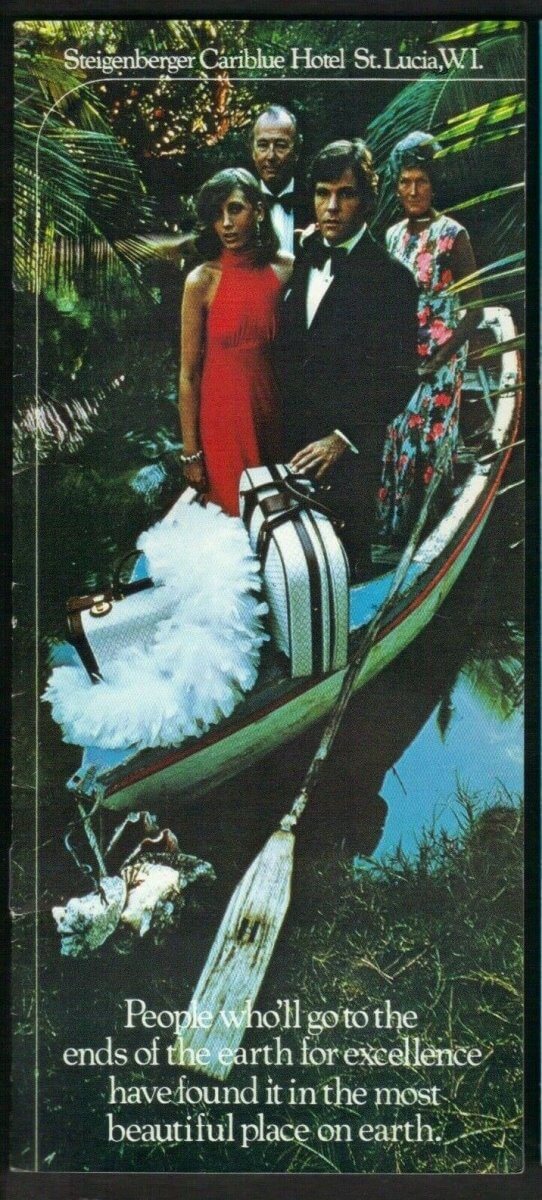
1970´s STEIGENBERGER CARIBLUE HOTEL St. Lucia (West Indies), Werbebroschüre
Nach exquisiten und sicher auch extrem anstrengenden Erfahrungen in der Hotellerie geht es für George weiter bei der British & North American Royal Mail Steam Packet Company, der 1840 vom Kanadier Samuel Cunard gegründeten Reederei.
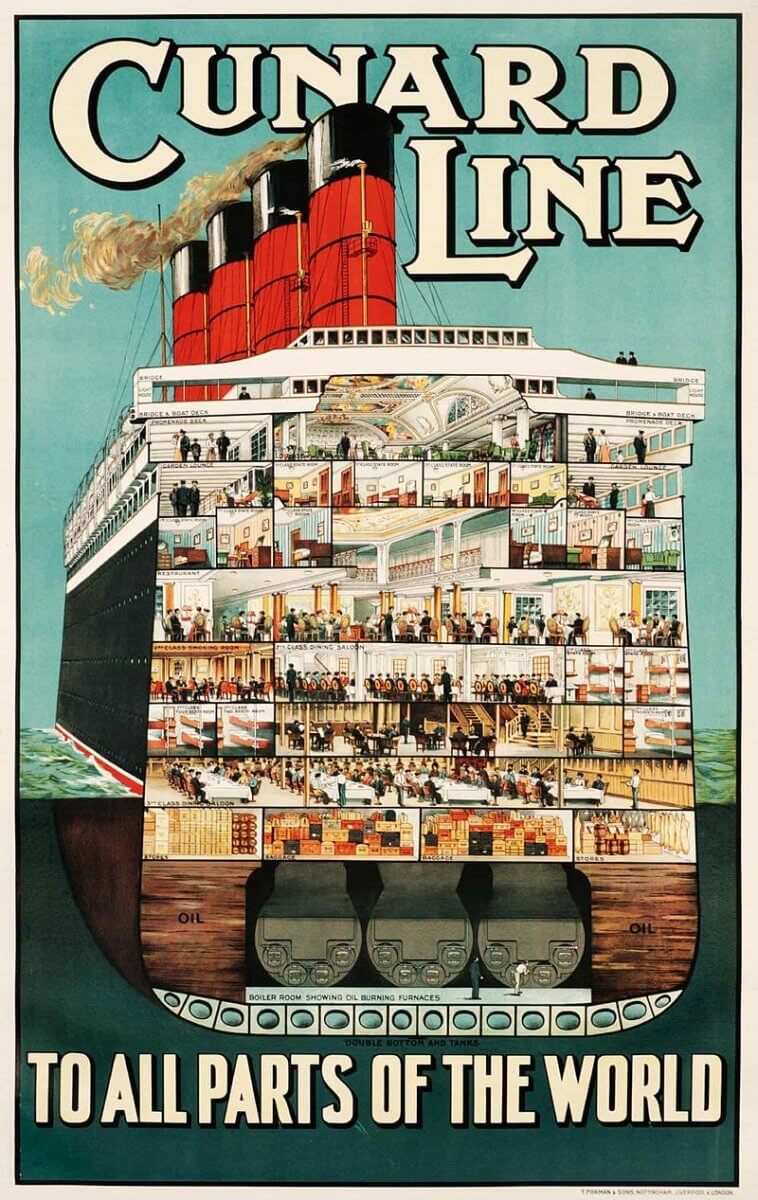
Die Liniendienste hatte Cunard Lines Ltd., wie sie nun offiziell hieß, damals weitgehend eingestellt, und war mit der Queen Elizabeth ins werdende Kreuzfahrtgeschäft eingestiegen. Da stieg auch George mit ein und diese Fahrenszeit, so erzählt er auf der Busfahrt, „opened my eyes“, sie öffnete seine Augen für die große weite Welt, öffnete offensichtlich auch sein großes weites Herz für Menschen aus aller Welt.

RMS Queen Elizabeth (1921-2001) in Southhampton 1960, Von George John Edkins – Original transparency, scanned and colour corrected, CC BY-SA 4.0
In Norwegen arbeitet er ab 2021 als Krankenpfleger, wofür er eine weitere Fremdsprache fließend erlernt und sein profundes Dienstleistungswissen „einfach“ in ein anderes Setting einfließen lässt. Im Alter von 61 Jahren hört George in der Universitätsklinik von Tromsø auf. Und fängt im Hotel „The Edge“ an. Jetzt ist er 62, geht angeln – auch er zeigt mir ein Foto von einem Riesen-Heilbutt – und pflückt massenhaft Multebeeren.
In Buktamoen steigt gegen halb eins mein inzwischen richtig lieb gewonnener Reisegefährte aus – in dieser Region werden winters Hundeschlittentouren angeboten – und verrät mir vorher sogar, wo sich seine Hytta befindet, aber das verrate ich natürlich nicht. Vor allem, weil er mir auch noch von molte-steder erzählt, Plätzen, an denen Rubus chamaemorus (norwegisch molte, eller multe, dänisch: multebær, schwedisch: hjortron, deutsch Moltebeere, Multebeere, Multbeere, Schellbeere, Sumpfbrombeere, Torfbeere) wächst, die es feucht und moorig liebt. Er steigt aus, macht sich auf zum Einkaufen und zum nächsten Bus.

Seine Heimatinsel ist nun, wo durch die von eher reicheren Menschen verursachte Klimakatastrophe seine Heimatinsel vom schwächer werdenden Passatwind nicht mehr ausreichend von Feuchtigkeit versorgt wird, ist sie von Austrocknung bedroht. Das lese ich aber erst später. Und erinnere mich an die Tipps meines Reisegefährten. Wenn einer was vom Reisen versteht, dann George Alexander, also: Die Lofoten sind überfüllt. Touristen fallen dort und anderswo von den Bergen und versinken mit Snowboards im Eis. Und zur Lebensreise allgemein: „The young people are going to change the world – the old men are afraid. Invest in knowledge!“
Thank you so much, dear George Alexander!

Rubus chamaemorus: die Pflanzengattung Rubus gehört zu den überall gefeierten Rosengewächsen und es gibt mindestens hunderte von Rubus-Arten, die bekanntesten sind Him- und Brombeeren; der botanische „Nachname“ von Rubus chamaemorus ist griechisch: chamai bedeutet auf der Erde und mōros Maul-/Brombeere, macht zusammen Bodenbrombeere (in meinem Handwörterbuch Norwegisch steht allerdings Berghimbeere, nur so zur Verwirrung).
Im TRAVEL GUIDE Narvik REGION 2023 finde ich sie später wieder, auf Englisch heißen die orangefarbenen Beeren Cloudberries: „Under the August and September sun, clusters of alluring cloud berreis appear in their beautiful golden cloaks. Yellow and juicy, they lie in close proximity to the marshes and the slopes, clling to us, and luring us higher up an farther in. And we are lured.“ So schreiben Norweger über Multebeeren. Und sind jedes Jahr wieder „lured“, angelockt, geködert.

Die Skandinavier*innen gehen eher auf die Beschaffenheit der Frucht ein, die Dän*innen nennen sie multebær, die Norweger*innen molte oder multe, was zurückgeht aufs Verb smelte (schmelzen). Übers Dänische gelangte der Name für diese in ihrer Reife sehr weiche Frucht ins Deutsche: Molte- oder Multebeere. Im Englischen erhebt frau/man sie als cloudberry über die Wolken. Eine Handvoll reifer Moltebeeren, Von Christoph Müller – Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de

Und für hausgemachte Multebeer-Marmelade legen manche manchen Kilometer zurück – zu Recht! Av Ankara – Eget arbete, CC BY-SA 3.0
Magiske Malmbanan oder Geschäftsförderlicher Golfstrom
Narvik war einmal eine sehr schöne Stadt. Von hier wurde Eisenerz aus Schweden exportiert, besonders im Winter, wenn die Bottenwiek (schwedisch Bottniska viken, Bottenviken; finnisch Pohjanlahti, Perämeri), der nördlichste Teil der Ostsee, zugefroren ist. Der Hafen von Narvik am Ofotfjord bleibt dank des Golfstromes ganzjährig eisfrei.

Narviks Bahnhofsgebäude bei der Einweihung 1903
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verbindet ihn die Ofotbanen (Malmtåg), wie das norwegische, Malmbanan (Malm ist Eisenerz), wie das schwedische Teilstück heißt, als nördlichste Strecke, die mit dem europäischen Eisenbahnnetz verbunden ist, mit Luleå am Bottnischen Meerbusen. Von dort verläuft die Erzbahnstrecke in nordwestlicher Richtung zu den nördlich des Polarkreises liegenden Bergbaugebieten von Gällivare und Kiruna. Der 1902 in Betrieb genommene Bahnhof Narvik wurde damit der der nördlichste im Personenverkehr erreichbare Regelspurbahnhof Europas. Und die Stadt war die einzige an die Eisenbahn angebundene nördlich des Polarkreises.

Erzzug am Torneträsk
Das Erz hat Narvik Unglück gebracht, zum strategischen Ziel gemacht, zum Ort der größten Kriegshandlungen auf norwegischem Boden. Wie in heutigen Kriegen gewinnt schließlich niemand, nachdem im April 1940 an Bord von Zerstörern 2000 österreichische Gebirgsjäger den Ofotfjord anliefen. Norwegens Alliierte, Engländer, Franzosen und Polen, stießen zur Schlacht, die sich dort dann Soldaten aus fünf Ländern lieferten. Sie brachte 8500 Menschen um und machte Narvik dem Erdboden gleich.

Mehr als 80 Jahre später trotte ich hinter Marie und Marin her zum Bahnhof. Es gibt absolut keine Hinweisschilder, eine muss sich an einem Einkaufszentrum entlang drängeln, über Eishügel hinweg und steht dann auf einem Bahnhof mit Aussicht.

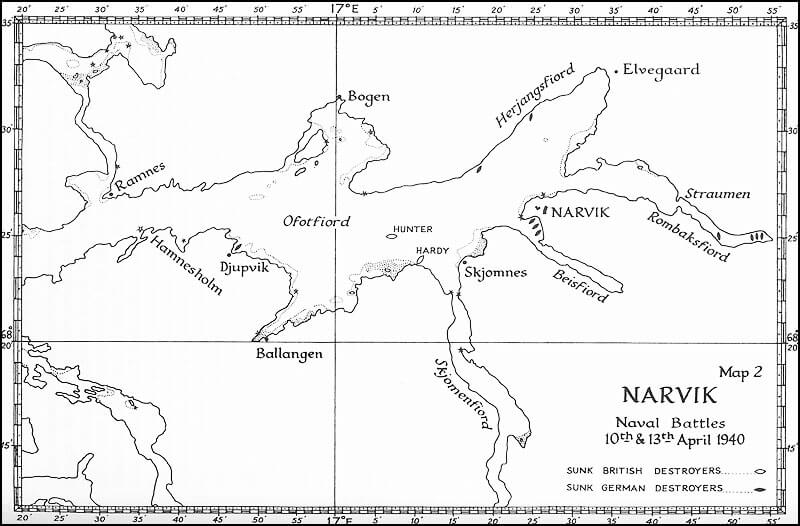
Ofotfjord, britische Karte mit den verzeichneten Schiffswracks, Von Government of the UK. – http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-NWE-Norway/maps/UK-NWE-Norway-2.jpg, Gemeinfrei
Im heutigen Bahnhofsgebäude, es stammt aus den 1950ern verweist ein riesiges Filmplakat auf Kampen om Narvik – Hitlers förste nederlag. Narvik war nämlich auch der Ort für Hitlers erste Niederlage.
Das Klo öffnet sich nur mit Kreditkarte, und auch damit nicht, jemand lässt mich rein. Die beiden Filmemacherinnen, die mit mir auf den Zug warten, Isabella und Alma-Online, auf dem Weg zu ihrem Doku-Projekt über einen Poesieworkshop für Mädchen mit Missbrauchserfahrung, studieren in Kabelvåg, wo auch Franciska und Laurens studierten, wo Camilla unterrichtet, deren Kurzfilm über SM & Alltag ich so großartig fand. Die beiden bestätigen, dass sie eine großartige Filmemacherin und Lehrerin ist, mit „sensitiver, taktiler Kameraführung“.
„Mostly women – mostly young – mostly brave“, berichte ich von NARRAN 360 Grad und Alma wünscht sich diesen Slogan im Falle eines verfrühten Ablebens auf ihrem Grabstein. Sie friert in ihrem dünnen blauen Anorak. Ihre Freundin und Kollegin Izabella hat von einem Seemann einen orangen Overall geschenkt bekommen und friert nicht. Sie bestätigt, dass meine Generation ein ökologisches und soziales Schlachtfeld hinterlasse. Sie bekommen beide heißen Tee mit Honig von Laurens´ Großvater. Die aufmerksame Frau in dem leuchtenden Overall prophezeit Kollaps, wir sprechen generationenübergreifend über den Weg ins Ungewisse. Ich beschließe, diesen Blog zu übersetzen und an sie alle zu senden. Will unbedingt bestärken!

Meine Bahn, über die es bei der schwedischen SJ – die Abkürzung steht für statens järnvägar = staatliche Eisenbahnen – der 1856 gegründeten und heute extrem nachhaltigen Bahngesellschaft, die die modernsten Nachtzüge Europas bietet, und damit nicht nur die DB überflügelt: „Wenn du dir für deinen nächsten Urlaub ein Abenteuer wünschst, ist die Strecke Stockholm – Luleå – Narvik eine gute Reiseroute. Dieser Nachtzug verlässt die schwedische Hauptstadt und führt die Fahrgäste entlang des Bottnischen Meerbusens in Richtung Narvik an der bergigen Westküste Norwegens“, hat eine Stunde Verspätung, also lasse ich den karierten Koffer auf dem Bahnsteig stehen, bei Izabella und Alma-Oline, die mir berichten, dass sie in Kabelvag an der Kunsthochschule studieren, gerade an einem Film über einen Poesie-Workshop mit Mädchen mit Missbrauchserfahrungen arbeiten, um 05:00 morgens aus dem Nattoget aussteigen werden und mir ihre Mailadressen aufschreiben, damit ich ihnen den Blog zukommen lasse und sie in Kabelvag besuche, und schaue mich um, blättere in Prospekten. Der TRAVEL GUIDE Narvik REGION 2023 verlockt mich dazu, den Aufenthalt in dieser aufregenden Region das nächste Mal zu verlängern. Um zum Beispiel beim Sámischen Koch Vegard Stormo zu essen, dessen Hingabe Ingredenzien im Originalzustand gehört. Ein chinesisches Filmteam hat er kurzerhand an Narviks Küste mitgenommen, wo ein Taucher Meeresfrüchte direkt in den Topf auf dem offenen Feuer warf. Meine Weihnachtstraum sind nun Romjuljazzen, Nordnorwegens größtes Jazz Happening seit mehr als 30 Jahren: fünf Stunden durchgehend Musik am Fjord, bequem mit der Bahn erreichbar (das Interrailticket für Senior*innen macht übrigens auch Nachtzugreisen finanzierbar) und die Wölfe im nördlichsten Tierpark der Welt. Ganz sicher werde ich mir als Friedensfreundin die dortigen Nazi-Bunker ansehen und mit der Seilbahn zum Nordlicht fahren.

Gulo gulo gehört zur Familie der Marder. Seinen deutschen Namen verdankt dieses Raubtier des nördlichen Eurasiens dem hansischen Fellhandel des 15. Jahrhunderts. Vielfraß ist wahrscheinlich eine umgangssprachliche Umbildung des altnorwegischen fjeldfross sei, was Felsen- oder Bergkater bedeutet.
Im Wartesaal ist auch ein vom Zug überfahrener Vielfraß ausgestellt. Laut Wikipedia ist die etablierte Annahme, dass dieser über den hansischen Fellhandel des 15. Jahrhunderts in deutsches Gebiet gekommene Raubtier aus der Familie der Marder seinen deutschen Namen der Umbildung des altnorwegischen fjeldfross verdanke, was so viel wie Felsenkater oder Bergkater bedeutet.
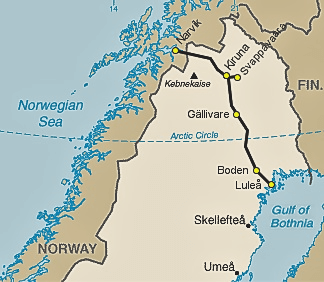
Ich reise ein Stück auf der Strecke des Erzzuges
Glänzende Geschäfte oder Unvernünftiger Umweltkrieg
Im Nattåget Norrland komme ich in ein leeres Abteil … und dachte, ich hätte das Ganze für mich. Habe doch glatt vergessen, was ich auf der Hinfahrt lernte: die Tourist*innen steigen an der KIRUNA TURIST STASJON aus und ein. Ich würde Riksgränsen vorziehen in jener Gegend, als Grenzgängerin …
Der karierte Koffer, mein praktischer und prächtiger Reisegefährte, passt unter jede Bank.
– Ponys, ein Gehöft, eine feine Puderzucker-Schnee-Häkeldecke liegt über Schweden.Die schwarzbraunen Ponys mit dem dicken Fell erinnern mich an Franciskas Film, in dem die beiden Schwestern sich aus den Wirren ihres Elternhauses lösen und an die Tiere lehnen.
Habe mich in den Speisewagen gesetzt. Habe geschrieben. Ein alter Herr steigt zu, der mir zunächst unheimlich war in seiner Ausstrahlung, der aber kurz vorm Aussteigen mein diszipliniertes Schreiben lobte. So hatten wir doch noch eine feine, kleine Konversation. Mit dem Blog, dem Nordland-Blog (der nun Romsa-Blog heißt) komme ich im Zug weiter, langsam. Nehme alle Fäden auf, wie Stickerin Britta. Knüpfe auch Verbindungen zu meiner Vergangenheit als Biologin, Aktivistin, Autorin – u.a. von kämpferischen Broschüren. Der karierte Koffer fährt nach Norden, so lautet der Obertitel. Es geht schnell und langsam voran. Schnell kommen die Eingebungen und Verknüpfungen an, langsam puzzle und knote ich den Text zusammen. So sei es. Möge die Übung gelingen, werde ihn ins Englische übersetzen. Werde fleißig sein.
Schon in den Worten zum Montag, dem 16. Januar, die Ella Isaksen galten, hatte ich Verbindung zum Riehpovuoujohka, Repparfjordelva, aufgenommen, wo nach Auskunft der samischen Aktivistin und Autorin durchs Errichten einer Kupferhütte sowohl die Rechte ihres Volkes, als auch die der Tier- und Pflanzenwelt übergangen würden. Im Nachtzug bringen mich zwei junge Mitreisende auf den neuesten Stand.

Zur Vor- und Frühgeschichte: Im Aktionslager gegen den Grubenbau – es entwickelte sich zum längsten Protestlager in Norwegens Geschichte – finden sich dort im Sommer 2021 in der Finnmark neben den Städter*innen aus Oslo Fischer*innen aus Kvalsund ein.
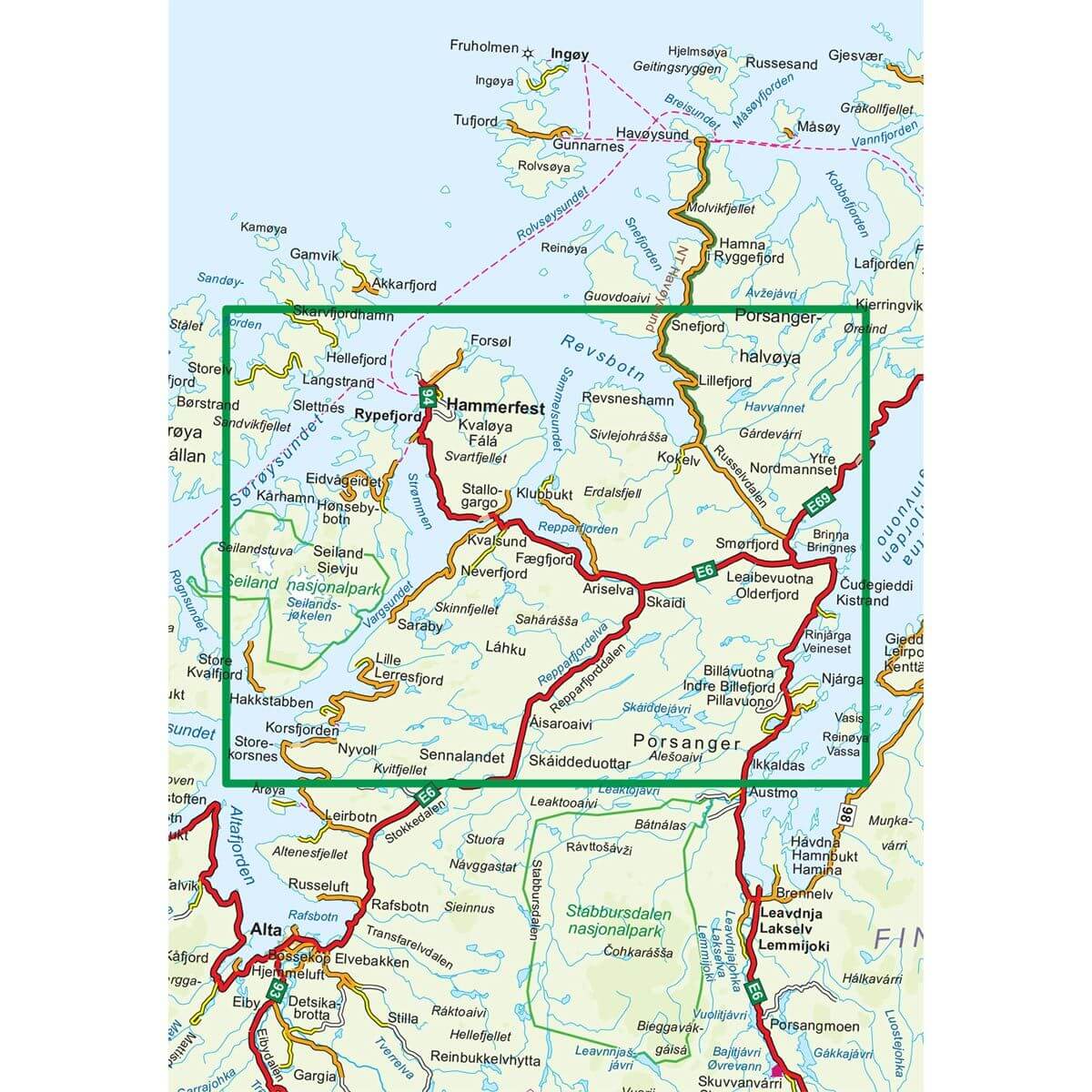
Da muss ich nachgucken, meine Landkarte Scandinavie Finlande, die vor mir am Aktenschrank hängt, verzeichnet Kvalsund an der Finnmark-Küste gut hundert Kilometer südlich des Nordkaps. Kval (hval) ist das norwegische Wort für Wal und die norwegische Wiki schreibt von Kvalsund Tettsted und fischen einen neuen Begriff aus dem Netz: tettsted. Tett bedeutet dicht und die norwegischen Worte tettsted beziehungsweise by deuten unabhängig von Verwaltung, Politik, Herrschaftsform auf bebautes und bewohntes Gebiet hin. Gewohnt wird dort schon lange, zumindest zeitweise. Auf Samisch heißt die Siedlung Ráhkkerávju, auf Norwegisch wurde sie seit alters her Finnbyen genannt, wobei Finne (Plural finner) die alte norwegische Bezeichnung für Sámi ist. Diese Gegend vor allem an der „Ecke“ des nordSámischen Namens Skáidi, der eine Stelle bezeichnet, wo sich zwei Flüsse treffen, war laut norwegischer Wikipedia eine der größten Hüttenkommunen der Finnmark, mit den Siedlungen Ráhkkerávju (Kvalsund), Áhpenjárga (Revneshamn), Skáidi und Guoikejohka (Kokelv). Ein Foto von 1884 zeigt Anwohner*innen: Kvalsundværinger (vær bedeutet übersetzt: Aufenthaltsort von Fischern). Der Ethnograf Roland Bonaparte zeigt sie auf die damals praktizierte Art, als gehörten sie zu einer anderen Art. Vielleicht erschienen sie dem französischen Schriftsteller und Wissenschaftler, der sich sehr gut mit Pflanzenarten auskannte, denn er unterhielt auch das größte Herbarium der Welt, bei seiner Finnmark-Expedition so, vielleicht war er ein Rassist. Zeige die Bilder der ersten Annäherungen von Europäern aus westlicheren Gegenden dennoch, denn sie zeigen etwas.

Übung am Fördefjord
Dort, wo der Riehppovuonjohka (norwegisch Repparfjordelva) Skáidi passiert, galt und gilt er als besonders lachsreich, weshalb das Miljødirektoratet, Norwegens staatliche Umweltaufsichtsbehörde ihn den nationalen Lachsfjorden zuordnet und anmahnt, dass der dortige Lachs-Bestand vor Eingriffen geschützt werden müsse. Das sehen die Kvalsund-Fischer*innen genauso, ihr Protest hat eklige Gründe: der Abraum der Grube soll in den Fjord gekippt werden – Norwegen ist das europaweit das letzte Land, das so ein Dumping, das Verklappen von Schwermetallen ins Meer erlaubt. Genauer, in den Repparfjord, das ist der Meeresarm, in den der Lachs-Fluss Riehppovuonjohka (norwegisch Repparfjordelva) mündet, der Meeresarm, über den die Lachse aufsteigen, als Wanderfische, die im Meer aufwachsen und die Flüsse emporschwimmen, um sich in deren Oberläufen paaren und dort ihren Laich absetzen. Noch genauer – bis auf die Nanopartikel genau: Trotz aller Proteste wurde die Genehmigung erteilt, 17 Laster Abraum pro Stunde, zwei Millionen Tonnen Schwermetallhaltigen Grubenschlamm pro Jahr in den Fjord zu kippen. Das werde die Umwelt dort ruinieren, schreibt der naturvernforbund, Norwegens Zweig von Friends of the earth. Das staatliche Meeresforschungsinstitut stimmt zu, dieses Dumping bedeute eine ernstzunehmende Verunreinigung des Fjordes. In 15 Jahren Grubenbetrieb würden etwa 30 Millionen Tonnen Giftschlamm anfallen, als meterdicke Schicht am Grund des Fjordes in der Finnmark alles Leben ersticken. Und das Gift würde mit der Strömung und den wandernden Tieren in die weltweite Nahrungskette geraten.


Auch am Førdefjord/Fördefjord gibt es Auseinandersetzungen. Karte von Ulamm, http://www.maps-for-free.com/, CC BY-SA 3.0
Kvalsund hat heute knapp 300 Einwohner*innen und ist ein Stadtteil von Hammerfest. Diese Gegend, auf NordSámisch heißt sie Fálesnuori gielda, liegt südöstlich von Hammerfest, nordSámisch Hámmerfeastta. Dieser im 18. Jahrhundert angelegte Hafen verdankt seinen Namen den Anlegemöglichkeiten am sogenannten Berghammer und dem Festmachen für Boote und Schiffe – galt als der Welt nördlichste Stadt, bis es 1996 von Honningsvåg getoppt wurde. Ein trauriges Drama verbindet beide Orte: sie wurden im Zuge des deutschen Angriffskrieges in den 1940ern vollständig zerstört.
Den Fischer*innen stehen bei ihren Protesten von Anfang an die Renntierhirt*innen zur Seite. Sie kommen von den Bergen und Plateaus oberhalb der oben genannten Siedlungen aus dem Gebiet Nussir. Dieses nordSámische Wort bezeichnet eine Gebirgsformation. Ironischerweise gab sich die Bergbau-Gesellschaft, die bei Kvalsund eines von Norwegens größten Kupfervorkommen ausbeutet und die giftigen Abfälle in den Repparfjord kippt, sich einen Sámischen Namen: Nussir ASA. Der norwegischen Wiki ist zu entnehmen, dass die Firma Nussir sich auf zwei Weidegebieten für Rentiere und einem Areal, wo Rentiere kalben, betätigt. Und die Sámischen Rentierhalter*innen befürchten, dass der Bergbau die seit Jahrhunderten von ihnen genutzten Flächen zerstört.
Hinzufügen möchte ich noch, dass die Sámi von Ráhkkerávju, Áhpenjárga, Skáidi und Guoikejohka dort ursprünglich in egalitären lokalen Gemeinschaften (siida) gelebt haben, die nicht auf die Gewinnmaximierung Einzelner ausgerichtet waren.
Der Hamburger Konzern Aurubis – zu Zeiten meiner Aktivitäten gegen die Industrialisierung der Unterelbe bei Hamburg, als Aurubis noch die Norddeutsche Affinerie und eine solche Dreckschleuder war, dass wir Umweltschützer*innen im Kanal vor der Kupferhütte Bergbau-Claims abstecken wollten, die Schwermetalle liefen die Spundwände hinab in den Kanal und weiter Richtung Elbe und Nordsee und verursachten Fischkrankheiten u.a. – hat mittlerweile vorbildliche Nachhaltigkeitsstandards und ist deretwegen 2021 vom Vertrag für die Mine in Norwegen abgesprungen. Aber Kupfergräber Øystein Rushfeldt, Direktor von Nussir ASA legte weiterhin die Hand aufs Herz dafür, dass der Repparfjord und die Umgebung mit allem gut zurechtkommen werde. Soviel Optimismus ist einen Rückblick wert: Unsere Uni-Umweltschutzgruppe Physik/Geowissenschaften schreibt 1985 in „Glänzende Geschäfte – Umwelt hin – Geld her“ über Europas größte Kupferhütte, die Norddeutsche Affinerie, „die Affi“ und das „Industriesystem“, dass wir uns seit über fünf Jahren mit der Vergiftung der Gewässer beschäftigen und uns die Affi immer wieder als Hamburgs größter Schwermetallverschmutzer auffiel.
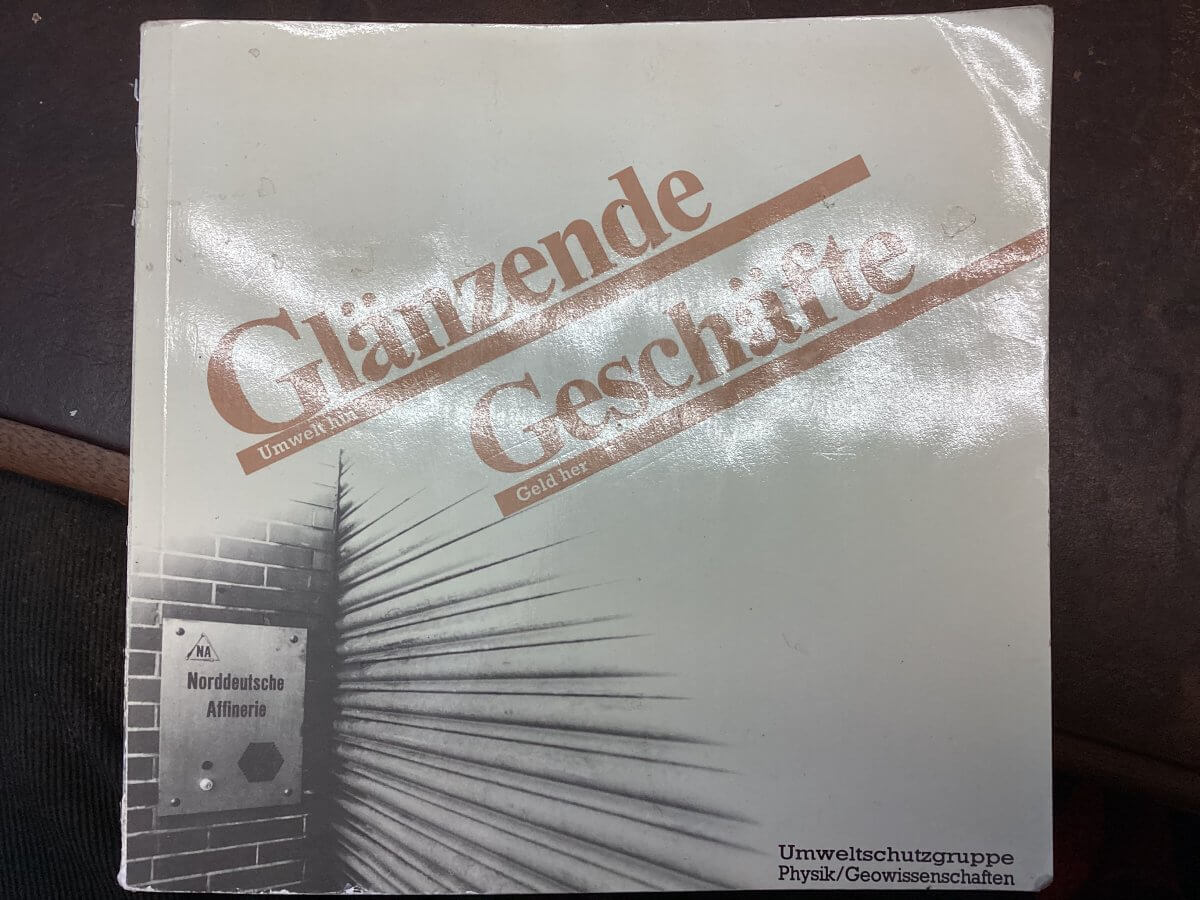
Uns wurde „Industriefeindlichkeit“ vorgeworfen. Wir waren junge Wissenschaftler*innen und richteten unser Augen- und Ohrenmerk auf unvernünftige Verfahren; kostenträchtige Abfallbeseitigung, deren Kosten nicht von den Verursachern aufgebracht werden; Kaltschnäuzigkeit, mit der die momentanen Produktionsverfahren als schicksalhaft und unabänderlich hingestellt werden; skrupellose Gesundheitsgefährdung am Standort; Trägheit der staatlichen Kontrollorgane; Gläubigkeit an die „Selbstheilungskraft“ des Betriebes („durch Subventionen natürlich“); Mutlosigkeit der Regierenden, verbunden mit der unsachlichen Reaktion auf ihre Kritiker*innen.

Sintereinlauf 1982, aus Rissen und Spalten der Kaianlage der Norddeutschen Raffinerie (heute Aurubis) gelangen Schwermetalle in die Hafenbecken Hamburgs. Von Schrajo – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Probenahme 1982, Mitglieder meiner Umweltschutzgruppe Physik-Geowissenschaften bei der Probennahme aus den Wassereinleitungen der Norddeutschen Affinerie (heute Aurubis) in Hamburg, Von Schrajo – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
Und – als Hinweis einer Älteren an die nachfolgenden Generationen -: wir leisteten uns öffentlich interne Widersprüche, und grenzten uns auch damit von Beschimpfer*innen ab, die als monolithischer Block auftraten: Wir alle, Biolog*innen, Boden- und Gewässerkundige, Physiker*innen, Chemiker*innen, gingen schon vor mehr als 40 Jahren davon aus, dass es sich nicht um einzelne Unfälle oder Unvernunft Einzelner handelte, sondern „um unausweichliche Folgen industrieller Produktion“. Unter Letzterer verstanden wir (verstehe ich auch heute noch, angesichts der Herstellung von Wegwerf-Elektronik) die kapitalintensive Massenproduktion unter ingenieurwissenschaftlich konzipierten Verfahren. Soweit waren wir uns in den interdisziplinären Umweltorganisationen – zu denen damals auch die GAL, die „Grün-Alternative Liste“ gehörte, von 1984 bis 2012 Hamburger Landesverband der Grünen – einig. Aber wo „die systematischen Ursachen des herrschenden Umweltkrieges (den derzeit in Hamburg übrigens Bauspekulant*innen gegen die allerletzten Reste von Naturräumen führen, siehe Vollhöfer Wald und Überschwemmungsgebiet auf der Veddel, wir protestieren weiter an der Elbe Auen! gegen Geldmacher*innen und Pfeffersäcke!) liegen“, wurde, wie in der Einleitung zur Broschüre „Glänzende Geschäfte“ steht, „bei uns nicht einheitlich beurteilt. Und war Gegenstand laufender Diskussionen, die wir zwar nicht nach den Regeln der gewaltfreien Kommunikation führten – da flogen schon mal Zigarettenschachteln übern Tisch -, aber unter ausdrücklicher Pflege der Meinungsvielfalt. Und wir plädierten „für eine kenntnisreiche Diskussion über unsere Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsorganisation“, für die wir die Kenntnisse bereitstellten, auch wenn sie verwickelt waren. Zugute halten muss ich den heutigen Umweltschützer*innen, dass wir uns bei all diesen Verwicklungen nicht auch noch mit den Fallstricken von Twitter und Co rumschlagen mussten, als wir 1985 schrieben, wir wollten einen Beitrag leisten zu den vielerorts anstehenden tiefgreifenden Veränderungen, „die noch in diesem Jahrtausend wirksam werden müssen“. Wir wissen alle, dass dieser tiefgreifende Wandel nicht gelungen ist. Sonst ständen wir heute ganz woanders.
Auf mehr als 200 Seiten setzten wir uns mit dem auseinander, was heute die kundigen jungen Frauen in Norwegen beschäftigt, die sich mit alten Autokraten und neuen Technologien bestens auskennen und aus anderen Landesteilen anreisen, seit Nussir ASA 2019 die Konzession zum Fjell-Aufreißen und Fjord-Dumping bekam. Wir haben übrigens zur Probenahme im Hamburger Hafen damals ein altes Motorboot wieder fahrtüchtig gemacht, Spaß muss ja auch unbedingt sein! Aber wir haben auch die kranken Fische aus der Elbe unter die Lupe genommen, die auch mal ein berühmter lakselv, ein Lachsfluss gab, an dem die Arbeitgeber die Auflage erhielten, ihren Beschäftigten nicht täglich Lachs zu servieren.
In Sachen Kupferhütte möchte ich ergänzen, dass die Affi, heute Aurubis, wirklich umgelenkt hat. Zwar gilt die Aurubis AG (vormals Norddeutsche Affinerie AG), börsennotierter Kupferproduzent und -wiederverwerter mit Hauptsitz Hamburg weiterhin der größte Schwermetallemittent im norddeutschen Raum, betreibt aber ausführlich Umweltschutz. Und ich entdecke, dass meine alte AG Eingang in Wikipedia gefunden hat, wo steht: „1985 kam es zum Arsenskandal, als bekannt wurde, dass sich im Osten Hamburgs, besonders in den landwirtschaftlich genutzten Bereichen, Schwermetalle in den Böden angereichert hatten. Zum Skandal wurde es durch die Verheimlichung der Hamburger Behörden. Die Umweltschutzgruppe Physik-Geowissenschaften zeigte mit eigenen Wasser- und Bodenproben, dass sich Arsen, Cadmium, Kupfer, Zink und andere Schwermetalle im Hafenschlick vor dem Werk stark angereichert hatten und noch 2005 aus Rissen und Spalten der Kaianlage in die Elbe gelangten. Auch wurden besonders Arsen und Cadmium in den Abwassereinleitungen und in der Abluft der Essen nachgewiesen.Im Anschluss an den Skandal schloss Aurubis mit der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt auf freiwilliger Basis fünf Verträge zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Steigerung der Energieeffizienz. … Im August 2020 unterzeichnete Aurubis einen Vertrag mit dem norwegischen Bergbauunternehmen Nussir ASA. Das Unternehmenplant, in den nächsten 15 Jahren jährlich etwa 2 Millionen Tonnen Kupfererz abzubauen.Mehrere Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, darunter die gesellschaft für bedrohte Völker kritisierten das Projekt. Das indigene Volk der Samen sah seinen Bestand der Rentierherden durch das Projekt bedroht und konnte dadurch den Bergbau der Mine, deren Fläche sie als „Kreißsaal“ ihrer Herden bezeichnete,noch bevor dieser beginnen konnte, stoppen.“ Und so landen wir wieder bei Frauen wie der vormaligen Leiterin von Natur og Ungdom (nu.no), der Jugendorganisation von Norwegens ältestem und größten Natur- und Umweltschutzverband, des 1914 gegründeten Naturvernforbundet, Therese Hugstmyr Woie und ihrer Nachfolgerin Gina Gylver. „In der letzten Phase, bevor Aurubis sein Vorhaben mit Verweis auf „bestimmte soziale Aspekte“ beendete“, so steht es in wikipedia.de, wurden die Samen von Natur og Ungdom („Natur und Jugend“) vor Ort mit Aktionen des zivilen Ungehorsams unterstützt.

Therese Hugstmyr Woie, die frühere Leiterin von Natur og Ungdom (nu.no), der Jugendorganisation von Norwegens ältestem und größten Natur- und Umweltschutzverband, des 1914 gegründeten Naturvernforbundet, Av Nordlandsbanen – Eget verk, CC BY-SA 4.0
Hugstmyr Woie bestätigt gleich zu Anfang der Kampagne für die Fjorde (zum Repparfjord kommt der Førdefjord (auch Sunnfjord)im Westen von Norwegen, den eine Titan-Grube und eine Unterwasserdeponie bedrohen), dass Metalle für neue Technologien gebraucht würden, vor allem, um mittels Elektrifizierung den Ausstoß von Klimagasen zu senken, mahnt aber auch einen sorgsameren Umgang mit den Rohstoffen, langlebigere Produkte und Wiederverwertung an, weist darauf hin, dass in Norwegen 30 Kilogramm „elektronik“ pro Person und Jahr weggeworfen würden. Ihr Verband NU wünscht sich (heftig; Ergänzung der alten Bloggerin:)), dass mehr der Mineralien, die wir verbrauchen – zu denen auch die Metalle wie Kupfer und Titan zählen, lokal gewonnen werden; zugleich aber die Eingriffe in die Natur und die Rechte der Urvölker minimiert und der Umgang mit Abfällen und Chemikalien in der Wirtschaft sich grundlegend ändert.
Gylver warnt davor, dass das Dumping von Grubenabfällen das Leben am Meeresgrund vernichten werde und „brüllt“ uns digital an: Bli med i kampen for rene fjorder!
Da bin ich dabei, lerne ich doch schon seit 50 Jahren ständig mehr über das einzigartige Leben in den Meeren, die Grenzen des Wirtschaftswachstums, das dringend notwendige Runterfahren von Material- und Energieverbrauch. Klingt vielleicht ein wenig vintage, aber: Wie wärs mal wieder mit Energiesparen? Da geht noch was!!! Z.b. verwende ich ein altes (russisches:)) Mobiltelefon, das nur Anrufen, schriftliche Kurznachrichten und Taschenlampe kann, das ich in den Fjord werfen und „lebend“ wieder rausfischen kann und fast nie aufladen muss (exzellenter Expeditionsgefährte, nachhaltig statt nervig).
Und spreche sowieso am liebsten mit den Menschen, die direkt – und nicht als Avatar auf dem Bildschirm – vor mir stehen oder sitzen. Gerade als ich über die neuen „Kampfplätze“ im Norden schrieb, nahmen Marie und Maren mit je einem Dosenbier gegenüber Platz. Und konnten mir helfen. Und wir konnten den Faden des Filmfestivals in Tromsø weiterspinnen, das ebenfalls sehr stark von jungen Macherinnen geprägt war: Mostly women – mostly young – mostly fantastic. weiterspinnen. Denn ich finde im Nachtzug heraus, dass a) die Aktivitäten am Repparfjord überwiegend in den Händen junger Frauen liegen – die beiden hatten schon überlegt, wie sie Männer mobilisieren könnten und ich warf ein, dass diese sich vielleicht in einer Art Selbstfindung befinden wie z.B. der junge Mann im Kurzfilm Into the fog, der den Proviant vergisst, sich dafür bedauern lässt, eine Weile braucht, um ihr Nein zu verstehen und den Heiratsantrag abgeschmettert bekommt – die beiden Frauen integrieren diese ihnen bisher unbekannte Sichtweise und berichten, dass b) die Aktivistinnen am Repparfjord aus gegebenem Anlass gerade ein neues Zeltlager dort planen. Vi gir aldri opp Repparfjord! Wir geben nicht auf! Nirgendwo.

Dann geben Marie und Maren mir Bescheid, dass dieser Wagen, der Speisewagen, in Boden abgekoppelt wird, und nicht nach Stockholm weiterfährt. Ein wenig panisch trage ich mein Mikrowellen-heißes Rentierragout mit Preißelbeeren und Kartoffelmus über die altertümlichen Übergänge zwischen den Waggons, wo eine jedesmal mindestens drei Türen öffnen muss, ziehend, drückend, schiebend. Mir sind Züge dennoch so lieb.
Über Izabella und Alma-Oline, die den karierten Koffer hüten und über die jungen Reisegefährtinnen, die mich auf der Fahrt mit aktuellen Infos über die Proteste gegen den Grubenbau am Repparfjord in der Finnmark, die seit August 21 fast ausschließlich von jungen Frauen getragen werden, notiere ich am nächsten Morgen, im Nattoget Norrland, beglückt rückblickend: „Ich bestärke sie, die jungen Künstlerinnen, Aktivistinnen. „Mostly women – mostly young – mostly fantastic“, habe ich gestern zu den beiden Kabelvåg-Studentinnen (Nordic School of Arts…) gesagt, über die Sámischen Filmemacherinnen.“ Diese Laudatio webe ich weltumspannend durch den Blog.
Im Zug gibt es Rökt Ishavskaviar, Reinsdyrpölse, Rekesmörbröd, Kremet Fiskesuppe, Hvalbiff, Finnebiff.
Und am nächsten Morgen, schon in Hamburg-Altona, fließt mir aus der Feder: „Der Nattoget Norrland, so heißt es, ist gut darin, Verspätungen aufzuholen, das hat er gestern (24/01) auch geschafft. In Narvik hatte er eine Stunde Verspätung und wir kamen pünktlich in Stockholm an. Mein Abteil habe ich mit einem jungen Mann geteilt, der eine Station vor Stockholm in affenartiger Geschwindigkeit vom obersten Bett in die Wintersachen sprang und ausstieg …
Das war weit hinter Gävle, im landsdel Norrland, dem nördlichsten der drei schwedischen Landesteile, von denen auch Lagerlöf erzählt, die ich mit dem Nattåget Norrland durchfahre, südlich schließen sich in dieser Reihenfolge Svealand und Götaland an. Norrland umfasst unter anderem einen Teil der europäischen Landschaft Lappland, wie sie auf Schwedisch und Norwegisch heißt (finnisch Lappi, russisch Лапландия Laplandija), in dem Schwedens höchster Berg, der von Lagerlöfs Adler bewohnet Kebnekaise liegt; macht fast 60 Prozent von Schwedens Fläche aus; ist dünn besiedelt und etwas woanders als der norwegische Bezirk Nordland, auf LuleSámisch Nordlánnda, auf SüdSámisch Nordlaante, auf Nordsamisch Nordlánda. Werde zwar gefahren – auf einer Strecke, die als eine von Europas allerschönsten gilt – will aber wissen, wo ich war. Zur organischen Orientierung.
Bei der wirtschaftlichen und politischen Orientierung helfen mir nach dem Erwachen im Nachtzug Sabine & Johannes. Sie möchten diesen Blog lesen – wussten ja nicht, wie ellenlang der wird, wusste ich ja auch nicht 🙂 – notieren in die mittlerweile ziemlich zerfledderte TIFF-Kladde mit dem Rentiergeweih: „Getroffen im Nachtzug von Kiruna nach Stockholm. Schöne Unterhaltung über Nachhaltigkeit und Organisationen. Vielen Dank für den Kaffee.“ Sabine ist Studentin der Organisationsentwicklung, Johannes Student der Nachhaltigkeit. Die beiden haben ein Auslandssemester in Schweden hinter sich. Das mit dem Kaffee kam so: im Speisewagen, gleich nach dem Aufwachen, traf ich Sabine, sie hatte an diesem Dienstag eine Text-Deadline. Und Johannes habe ich von dort einen Gratis-Kaffee mitgebracht und dann mit ihm über Müll, Verbrennung, Erdöl und all diese unnatürlichen Zyklen geredet: raus aus der Erde, rein in den Supermarkt, raus aus der Mülltonne, rein in die schwedische Müllverbrennungsanlage und die Atmosphäre. Er sagt, dass wir bald mal „aus dem Erdöl aussteigen“, dass Müllverbrennung (Schweden importiert (!) Müll und lässt sich die Verbrennung bezahlen) eher Müll erzeugt. Mir stinkt´s. Sabine kam dazu und interessierte sich für OE in Non-Profit-Organisationen wie Genossenschaften und Vereinen. Sie sagt, überall wären die alten Strukturen nur schwer aufzubrechen. Wie schon die Alten sungen …. Naja, hätte meine Oma in ihrem ostpreußischen Singsang gesagt. Sabine sagt, Parallelorganisation, Macht ohne Mandat, habe manchmal etwas mit Innovation zu tun. Kann aber auch alles ausbremsen, denke ich. Da geht noch was, schreibe ich an jenem Dienstag: „Aber erst ab heute Nachmittag. Meine Seele ist noch mit den Sámischen Schamaninnen in deren nordischer Weite unterwegs.“
umsteige Dienstag, den 24. – 10:03 Stockholm
Anderswo notiere ich mir: „habe im Supermarkt im Stockholmer Bahnhof ein refill für meinen orangen Futterbeutel (57. Nordische Filmtage Lübeck 04. – 08.11.2015, war schon mit in Sibirien) besorgt. Mehrere Tafeln Marabou apelsin krokant, KEX CHOKLAD; DILLKAVIAR, EKOLOGISK BRIE, LEVERPASTEJ original (wäre ne gute Idee, 1 Glas Preißelbeeren auf die Reise mit zu nehmen, für alle Fälle:) alle?:)“. Was immer ich mir dabei gedacht habe. War vielleicht der Zuckerkoller, denn sogar die Leberpastete wird in Schweden gesüßt. Ergänze noch das Brot: Malax Limpan SINCE 1893, LAKTOSFRI, MJÖLKFRI, FIBERRIK. Das schwedische Limpa-Brot enthält keine Milch, aber Hefe, braunen Zucker, Anis, Orangenabrieb, Roggenmehl.
Wieder anderswo steht: „In Stockholm habe ich mich im Supermarkt (siehe oben bzw. unten) mit Plastikverpackungen verschiedener Inhalte eingedeckt (Anmerkung: Meine Lieblingspostkarte zur Jahreswende war „FUCK PRODUCT VARIETY“). Was für ein Scheißjob, den Leuten beim Einscannen zuzuschauen. Wieviel schöner war es/wäre es, eine Händlerin zu sein, die Dinge in die Hand nimmt, sich mit ihren Waren identifiziert, im Austausch mit den Kund*innen ist.“ Die Angestellte im Discounter im durchgehend elektrisch beleuchteten Untergrund von Stockholm freute sich sichtlich über meine realexistierende Bitte, auf den karierten Koffer und den orangen Stoffbeutel aufzupassen. Wir machen nicht mehr mit, sagt Marlene. Das ist der erste Schritt. Ansonsten starren wir die Probleme gemeinsam an und imaginieren uns weiter.
Im Zug nach Malmö höre ich die verstörende Ansage: „we have all the information about your journey, if you are sitting on the right seat“. Sitze richtig: Wagen 6, Platz 45, am Fenster. Und habe glücklicherweise noch nicht alle Informationen über meine restliche Reise. Wo kämen wir denn da hin?
Die Redaktion AFTONBLADET rast vorbei. Das 1830 von einem Pionier der freien Presse gegründet, Lars Johan Hierta, der die Monarchie, besonders die persönliche Macht des Königs kritisierte, bewegte sich das Blatt „im Wind“. Während der Nazizeit in Deutschland schlugen die Redakteure dieses Stockholmer Abendblattes sich auf die Seite der deutschen Faschisten. In den 1950ern wurde AFTONBLADET das Sprachrohr der schwedischen Sozialdemokrat*innen, seit 2009 gehören nur noch 9 Prozent der Aktien der zur Aktiengesellschaft gemachten Boulevardzeitung dem Gewerkschaftsbund. Über den Rest herrschen norwegische Online-Händler*innen. Der Konzern Schibsted macht Milliarden mit der Kombi Werbung schalten & (Kunden)Daten sammeln & Meinung machen. Es war einmal eine freie Presse.
Die Hauptstadt rast vorbei. Kirchenglocken läuten. Wir fahren an einem großen Wasser mit Dampfern entlang, ich hole meine Karte raus. Das breite Gewässer war Gälöfjärden. Das schwedische Wort fjärd bezeichnet den offenen Teil eines Schärengartens oder einen Meerbusen. Die Brücke führt über den Södertälje-Kanal. Bei genauerer Betrachtung waren wir im Zug von den Busen und Buchten recht weit entfernt, aber mir beschert diese Betrachtung romantische Erinnerungen an Segelabenteuer in marinen Felsengärten.
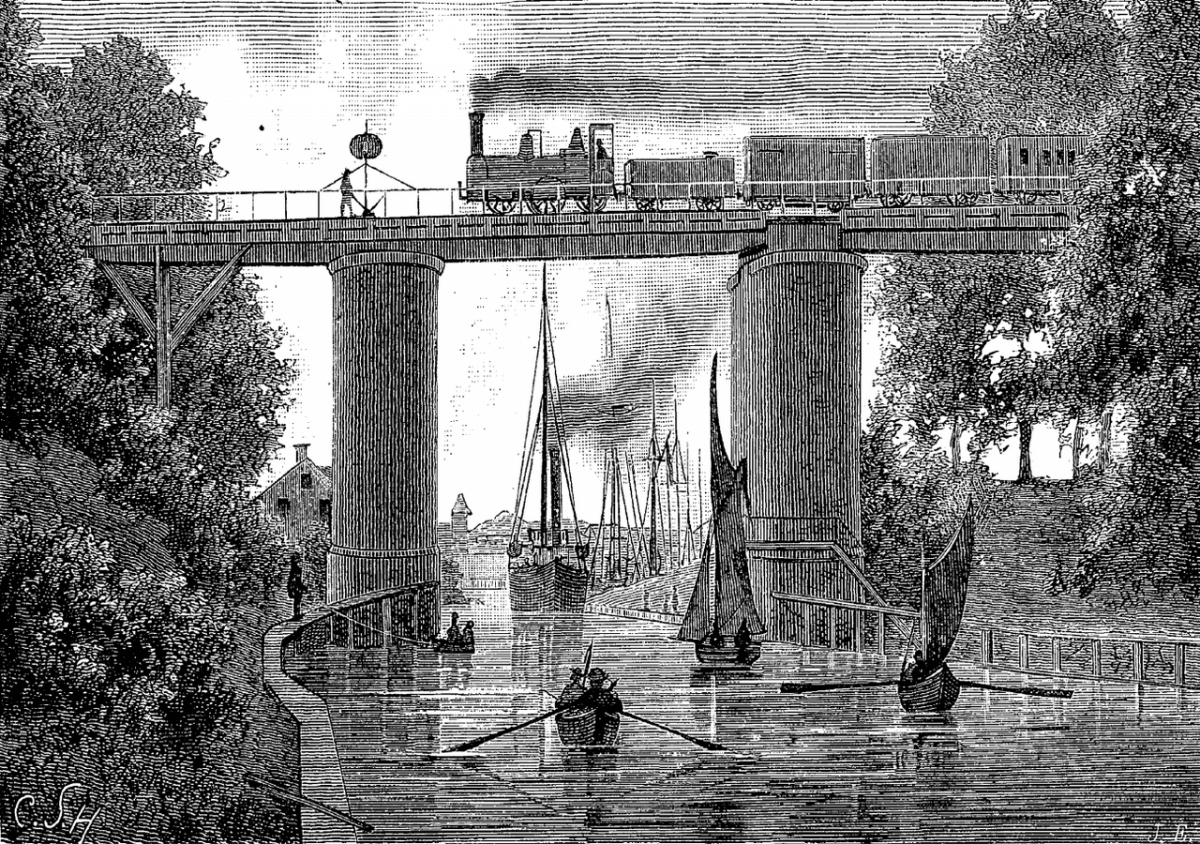
Die erste Eisenbahnbrücke über den Södertälje-Kanal, 1881
Im Zug nach Malmö saßen die Urbanen, gebeugt über ihre winzigen Displays, die ihnen die Welt bedeuten. Die Zeit der weitblickenden Begegnungen scheint vorbei. Wie abstoßend zu sehen, dass die Großmutter gleich nach dem Einsteigen der Enkelin Kopfhörer überstülpt (wie ein Dealer Drogen ausgibt) und ihr ein bunt blinkendes quiekendes Device vor die Nase knallt, statt ihr eine Geschichte zu erzählen, aus dem Fenster auf die schöne schwedische Landschaft zu schauen und ein Stück von Nils Holgersons Reise nachzuvollziehen. Nein, die Alte holt selbst so ein unnützes kleines Ding raus und fummelt sich ihr Mini-Universum zurecht. Let it be.
Ich esse erstmal meine Tunnbrödrulle aus dem Nattåget Norrland. Tunnbröd heißt dünnes Brot, es wird in der Pfanne gebacken und gerollt, daher rulle. Mein Traditions-Wrap enthält renstek (Rentierschinken), pepparrot (Merrettich), färskost (Frischkäse), ruccola och prästost (regionalen Hartkäse) und trägt den Titel A taste of Norrland. The last one:(, notiere ich.
Nun purzeln ja die Infos über den Widerstand gegen Umweltzerstörung in den letzten unberührten Gebieten Europas, das Joiken, die Trommeln, die Flüsse, die heiligen Berge von allen Seiten – punktgenau erscheinen Informant*innen auf der Bildfläche und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Es gilt, aus dem flirrenden Reich der Intuition heraus, die richtige Frage zur richtigen Zeit zu stellen. Das kann ich:)

Östergötland, Frau in Tracht von vorne und von hinten, großformatiges Aquarell von J.W Wallander
In NORRKÖPING notiere ich, liegt schräg gegenüber von Gotland (und mir fällt ein Segeltörn mit viel Aroma und Paloma ein:)). Es liegt in der historischen Provinz Östergötland, umfasst mittelschwedische Senke und südschwedisches Hochland, viele Hügel, Täler, Seen und eine schöne Schärenküste. Und es wohnen Persönlichkeiten dort.

Der Bauer A. J. Gustafsson, 75 Jahre alt, mit Fahrrad, 1945, Provinz: Östergötland, Kommune: Norrköping, Einar Erici
Im Zug nach Malmö werden varme kanelbullar – warme Zimtschnecken – angeboten, und ich bekomme plötzlich mit, dass ich wieder ins Kallbadhuset gehen kann!:). Mein Nachtzug nach Hamburg geht erst um 23:25…


Als es mal wirklich kalt war beim Kaltbadhaus, Marlene Stadie
In Malmö wusste ich schon, wie´s geht mit dem Schließfach (schließlich erschließen sich auch mir die digitalen Verschlüsselungen allerorten), habe auf einer abgelegenen Bank umgepackt und mich mit Saunaausrüstung (incl. Schloss fürs Wertsachenfach, karierter Unterlage, Latschen, Lektüre, Seife …) per Taxi zum Kallbadhuset aufgemacht. Bin nicht das einzige Weib, dass in diesen Ort verknallt ist, eine andere schreibt gerade ein Buch über „kvinnerne pa kallis“, die Frauen in Malmös Strandsauna. Die redeten gestern französisch, englisch, deutsch, schwedisch, oder gar nicht, in der Schweigesauna. Hab den Blick von dort, und auch vom Steg, auf mein Meer getrunken, gesoffen. Bin dreimal reingestiegen. Habe im Buch der Joikerin Ella gelesen, die so gut schreibt wie sie joikt. Brauchte wohl die Worte einer Jungen, fast könnte sie mir Urenkelin sein, um meine eigene Missbrauchserfahrung hautnah an mich heranzulassen. Nachdem ich von ihrem psychisch und sexuell gewalttätigen On-off-„Partner“ und den Folgen dieser „Beziehung“ gelesen habe, auf der grünlackierten Holzbank, auf dem neuen karierten Tuch der alten Saunagängerin, konnte ich in einer Art Spontanheilung im Kreis dieser wunderschönen und wunderbaren Frauen die Erkenntnis in mich aufnehmen, ausschwitzen und in die Ostsee versenken.
Auf dem Rückweg über unseren Anti-Modell-Laufsteg habe ich mich vor der Mondsichel verbeugt. Zehn Tage zuvor hatte ich den Planeten um Verwandlung gebeten. Und so ist es geschehen .… Transzendenz, grenzenüberschreitend; Transformation auf vielen Ebenen; Anbindung an unsere europäischen schamanischen Ahninnen. Mille grazie a la luna! Gittu! Takk so mykke! Tusen takk!

Und als es taute in Malmö, Marlene Stadie
Bin dann auf der Radler*innen- und Fußgänger*innen-Promenade Richtung Stadt marschiert und hab fürs letzte Stück zum Bahnhof (Centralen) den Bus genommen. Konnte wieder nicht bezahlen, weil ich die EC-Karte nicht einstecken konnte. Die Durchdigitalisierten erledigen willig die Arbeit der Dienstleister, die sie bezahlen (die an ihnen verdienen), schaffen ständig neue elektronische Geräte an, produzieren Schrottberge, Umweltzerstörung, Energieverbrauch etc., wischen drauf rum statt in Kontakt mit ihrer Umgebung zu gehen, werfen mit QR-Codes um sich und werden zur Nummer. Lässt sich wohlmancherorts nicht vermeiden, andernorts schon. Z.B. kann eine zu Fuß gehen und alles ausschalten außer ihrem wilden Geist.
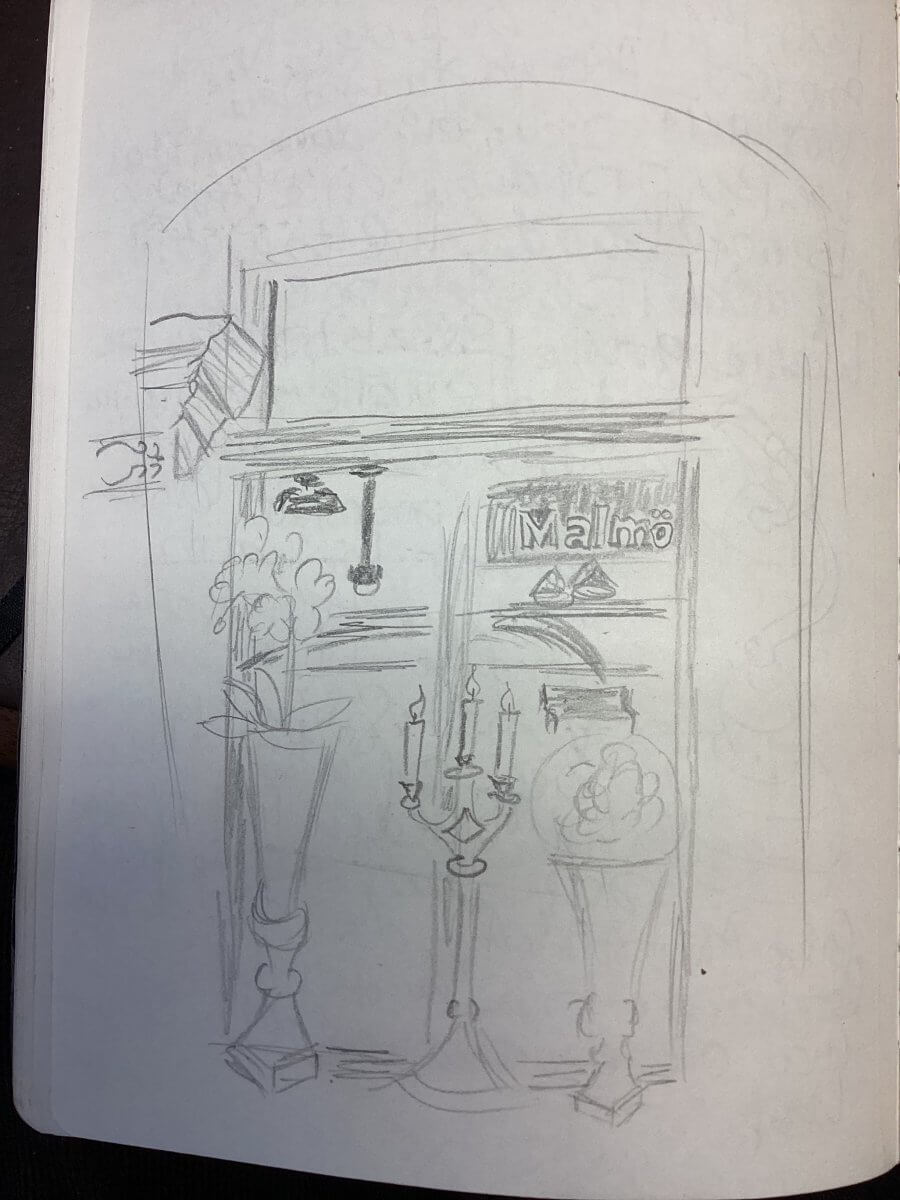
Einen ganz anderen Ort habe ich gestern Abend auf dem schönen alten Hauptbahnhof von Malmö gefunden: die königliche Wartehalle. Habe dort königlich gespeist und gezeichnet. Noch eine Weile in der nagelneuen Bahnhofshalle zwischen SmartPhoneUsern gehockt und noch ein Stück weitergeschrieben, auch tolle Bilder gefunden.
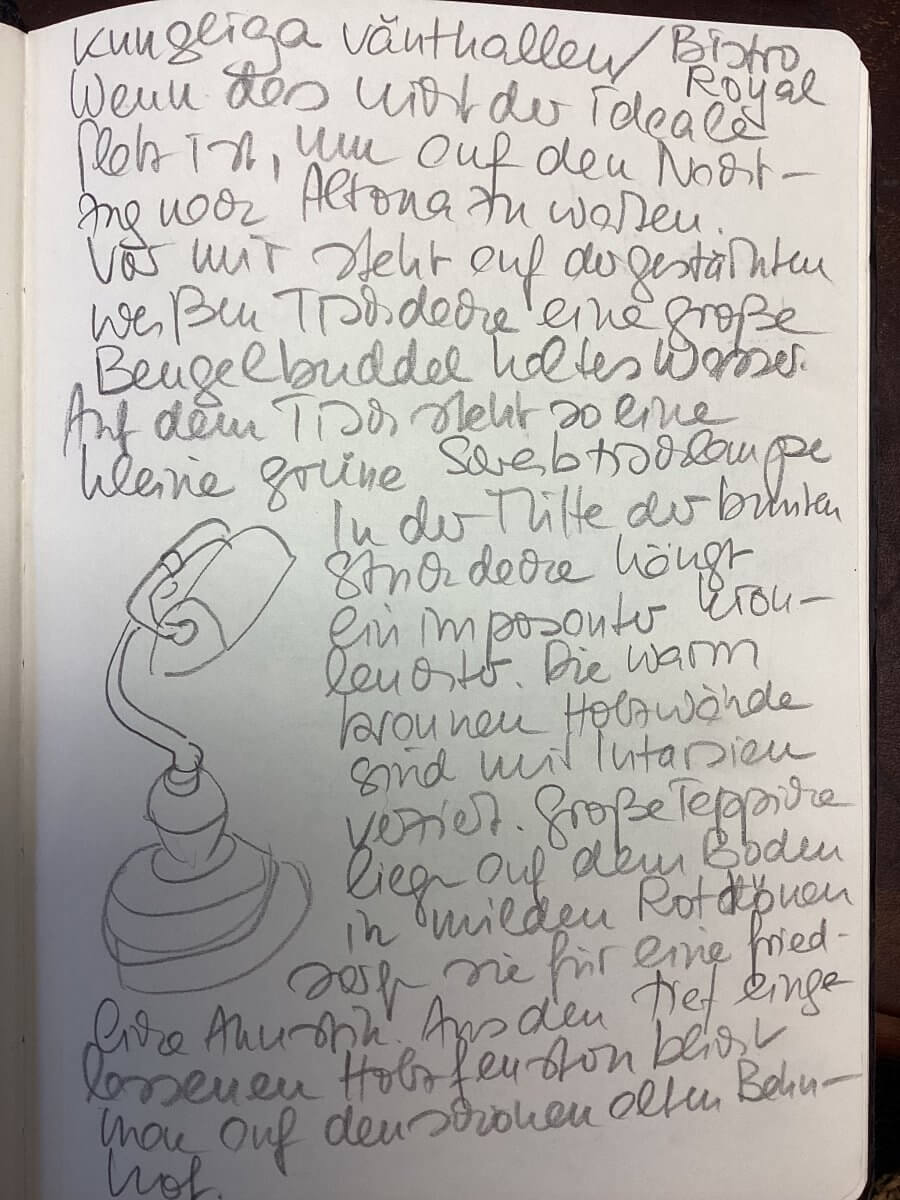
Und dann hat mir der Schaffner ganz am hinteren Ende von Gleis 5 ein eigenes Abteil aufgeschlossen. So konnte ich meinen Schlafsack auf der Bank ausrollen, eine große Tafel Marabou Appelsin Krokant und noch ein Kapitel aus Isaksens junger Autobiografie verschlingen. Und bin dann nur in Padborg kurz aufgewacht, weil der Zug stand. 23:25
Bei der wirtschaftlichen und politischen Orientierung helfen mir nach dem Erwachen im Nachtzug Sabine & Johannes. Sie möchten diesen Blog lesen – wussten ja nicht, wie ellenlang der wird, wusste ich ja auch nicht 🙂 – notieren in die mittlerweile ziemlich zerfledderte TIFF-Kladde mit dem Rentiergeweih: „Getroffen im Nachtzug von Kiruna nach Stockholm. Schöne Unterhaltung über Nachhaltigkeit und Organisationen. Vielen Dank für den Kaffee.“ Sabine ist Studentin der Organisationsentwicklung, Johannes Student der Nachhaltigkeit. Die beiden haben ein Auslandssemester in Schweden hinter sich. Das mit dem Kaffee kam so: im Speisewagen, gleich nach dem Aufwachen, traf ich Sabine, sie hatte an diesem Dienstag eine Text-Deadline. Und Johannes habe ich von dort einen Gratis-Kaffee mitgebracht und dann mit ihm über Müll, Verbrennung, Erdöl und all diese unnatürlichen Zyklen geredet: raus aus der Erde, rein in den Supermarkt, raus aus der Mülltonne, rein in die schwedische Müllverbrennungsanlage und die Atmosphäre. Er sagt, dass wir bald mal „aus dem Erdöl aussteigen“, dass Müllverbrennung (Schweden importiert (!) Müll und lässt sich die Verbrennung bezahlen) eher Müll erzeugt. Mir stinkt´s. Sabine kam dazu und interessierte sich für OE in Non-Profit-Organisationen wie Genossenschaften und Vereinen. Sie sagt, überall wären die alten Strukturen nur schwer aufzubrechen. Wie schon die Alten sungen …. Naja, hätte meine Oma in ihrem ostpreußischen Singsang gesagt. Sabine sagt, Parallelorganisation, Macht ohne Mandat, habe manchmal etwas mit Innovation zu tun. Kann aber auch alles ausbremsen, denke ich. Da geht noch was, schreibe ich an jenem Dienstag: „Aber erst ab heute Nachmittag. Meine Seele ist noch mit den Sámischen Schamaninnen in deren nordischer Weite unterwegs.“
umsteige Dienstag, den 24. – 10:03 Stockholm –
Anderswo notiere ich mir: „habe im Supermarkt im Stockholmer Bahnhof ein refill für meinen orangen Futterbeutel (57. Nordische Filmtage Lübeck 04. – 08.11.2015, war schon mit in Sibirien) besorgt. Mehrere Tafeln Marabou apelsin krokant, KEX CHOKLAD; DILLKAVIAR, EKOLOGISK BRIE, LEVERPASTEJ original (wäre ne gute Idee, 1 Glas Preißelbeeren auf die Reise mit zu nehmen, für alle Fälle:) alle?:)“. Was immer ich mir dabei gedacht habe. War vielleicht der Zuckerkoller, denn sogar die Leberpastete wird in Schweden gesüßt. Ergänze noch das Brot: Malax Limpan SINCE 1893, LAKTOSFRI, MJÖLKFRI, FIBERRIK. Das schwedische Limpa-Brot enthält keine Milch, aber Hefe, braunen Zucker, Anis, Orangenabrieb, Roggenmehl. In Schweden Malaxlimpan oder Malax Limpa genannt, hat dieses Ostbottnische Roggenbrot eine lange Geschichte. Es heißt nach dem Ort Malax in der Nähe von Vasa und gilt vor Ort als typisches Schärengartengebäck mit langer Haltbarkeit. Erfunden hat es dort 1906 Anna Malmberg, die Tochter von Karl Malmberg. Malaxlimpa wurde zunächst von der Familie mit dem Rad ausgefahren.

Karl Malmberg als junger Bäcker in den USA
Wieder anderswo steht: „In Stockholm habe ich mich im Supermarkt (siehe oben bzw. unten) mit Plastikverpackungen verschiedener Inhalte eingedeckt (Anmerkung: Meine Lieblingspostkarte zur Jahreswende war „FUCK PRODUCT VARIETY“). Was für ein Scheißjob, den Leuten beim Einscannen zuzuschauen. Wieviel schöner war es/wäre es, eine Händlerin zu sein, die Dinge in die Hand nimmt, sich mit ihren Waren identifiziert, im Austausch mit den Kund*innen ist.“ Die Angestellte im Discounter im durchgehend elektrisch beleuchteten Untergrund von Stockholm freute sich sichtlich über meine realexistierende Bitte, auf den karierten Koffer und den orangen Stoffbeutel aufzupassen. Wir machen nicht mehr mit, sagt Marlene. Das ist der erste Schritt. Wir zaubern und imaginieren weiter.
Im Zug nach Malmö höre ich die verstörende Ansage: „we have all the information about your journey, if you are sitting on the right seat“. Sitze richtig: Wagen 6, Platz 45, am Fenster. Und habe glücklicherweise noch nicht alle Informationen über meine restliche Reise. Wo kämen wir denn da hin?
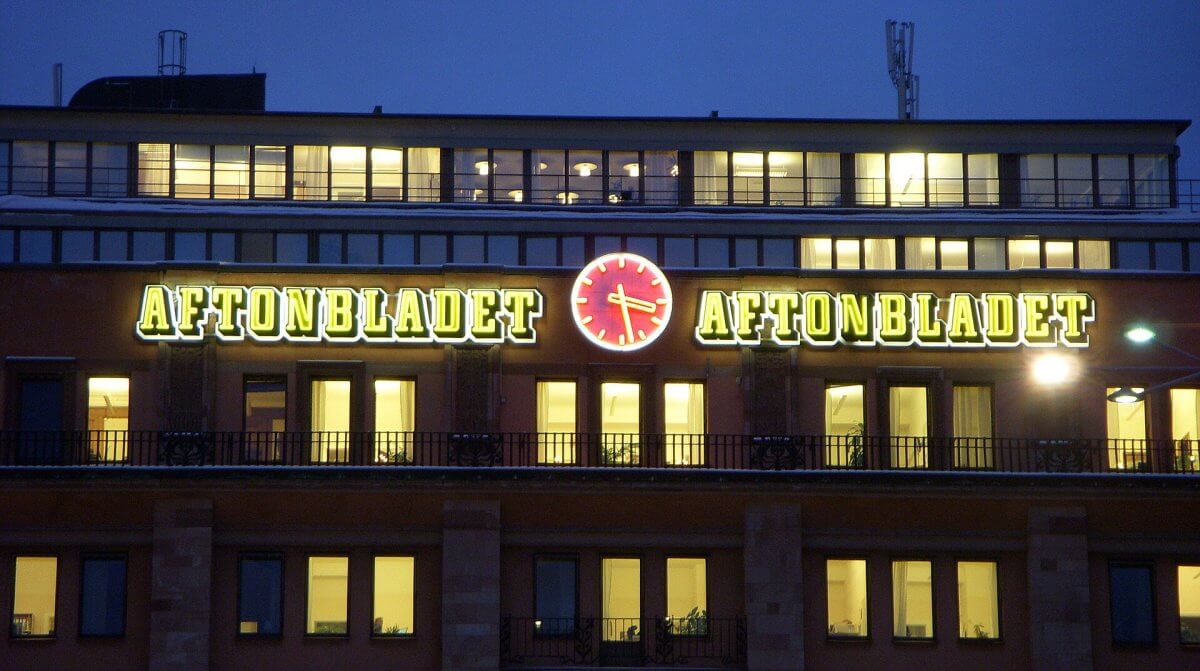
Die Redaktion AFTONBLADET rast vorbei. Das 1830 von einem Pionier der freien Presse gegründet, Lars Johan Hierta, der die Monarchie, besonders die persönliche Macht des Königs kritisierte, bewegte sich das Blatt „im Wind“. Während der Nazizeit in Deutschland schlugen die Redakteure dieses Stockholmer Abendblattes sich auf die Seite der deutschen Faschisten. In den 1950ern wurde AFTONBLADET das Sprachrohr der schwedischen Sozialdemokrat*innen, seit 2009 gehören nur noch 9 Prozent der Aktien der zur Aktiengesellschaft gemachten Boulevardzeitung dem Gewerkschaftsbund. Über den Rest herrschen norwegische Online-Händler*innen. Der Konzern Schibsted macht Milliarden mit der Kombi Werbung schalten & (Kunden)Daten sammeln & Meinung machen. Es war einmal eine freie Presse.
Die Hauptstadt rast vorbei. Kirchenglocken läuten. Wir fahren an einem großen Wasser mit Dampfern entlang, ich hole meine Karte raus. Das breite Gewässer war Gälöfjärden. Das schwedische Wort fjärd bezeichnet den offenen Teil eines Schärengartens oder einen Meerbusen. Die Brücke führt über den Södertälje-Kanal. Bei genauerer Betrachtung waren wir im Zug von den Busen und Buchten recht weit entfernt, aber mir beschert diese Betrachtung romantische Erinnerungen an Segelabenteuer in marinen Felsengärten.
Im Zug nach Malmö saßen die Urbanen, gebeugt über ihre winzigen Displays, die ihnen die Welt bedeuten. Die Zeit der weitblickenden Begegnungen scheint vorbei. Wie abstoßend zu sehen, dass die Großmutter gleich nach dem Einsteigen der Enkelin Kopfhörer überstülpt (wie ein Dealer Drogen ausgibt) und ihr ein bunt blinkendes quiekendes Device vor die Nase knallt, statt ihr eine Geschichte zu erzählen, aus dem Fenster auf die schöne schwedische Landschaft zu schauen und ein Stück von Nils Holgersons Reise nachzuvollziehen. Nein, die Alte holt selbst so ein unnützes kleines Ding raus und fummelt sich ihr Mini-Universum zurecht. Let it be.
Ich esse erstmal meine Tunnbrödrulle aus dem Nattåget Norrland. Tunnbröd heißt dünnes Brot, es wird in der Pfanne gebacken und gerollt, daher rulle. Mein Traditions-Wrap enthält renstek (Rentierschinken), pepparrot (Merrettich), färskost (Frischkäse), ruccola och prästost (regionalen Hartkäse) und trägt den Titel A taste of Norrland. The last one:(, notiere ich.
Nun purzeln ja die Infos über samische Rituale, den Widerstand gegen Umweltzerstörung in den letzten unberührten Gebieten Europas, das Joiken, die Trommeln, die Flüsse, die heiligen Berge von allen Seiten – punktgenau erscheinen Informant*innen auf der Bildfläche und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Es gilt, aus dem flirrenden Reich der Intuition heraus, die richtige Frage zur richtigen Zeit zu stellen. Das kann ich:)
In NORRKÖPING notiere ich, liegt schräg gegenüber von Gotland (und mir fällt ein Segeltörn mit viel Aroma und Paloma ein:)). Es liegt in der historischen Provinz Östergötland, umfasst mittelschwedische Senke und südschwedisches Hochland, viele Hügel, Täler, Seen und eine schöne Schärenküste.
Im Zug nach Malmö werden varme kanelbullar – warme Zimtschnecken – angeboten, und ich bekomme plötzlich mit, dass ich wieder ins Kallbadhuset gehen kann!:). Mein Nachtzug nach Hamburg geht erst um 23:25…
In Malmö wusste ich schon, wie´s geht mit dem Schließfach (schließlich erschließen sich auch mir die digitalen Verschlüsselungen allerorten), habe auf einer abgelegenen Bank umgepackt und mich mit Saunaausrüstung (incl. Schloss fürs Wertsachenfach, karierter Unterlage, Latschen, Lektüre, Seife …) per Taxi zum Kallbadhuset aufgemacht. Bin nicht das einzige Weib, dass in diesen Ort verknallt ist, eine andere schreibt gerade ein Buch über „kvinnerne pa kallis“, die Frauen in Malmös Strandsauna. Die redeten gestern französisch, englisch, deutsch, schwedisch, oder gar nicht, in der Schweigesauna. Hab den Blick von dort, und auch vom Steg, auf mein Meer getrunken, gesoffen. Bin dreimal reingestiegen. Habe im Buch der Joikerin Ella gelesen, die so gut schreibt wie sie joikt. Brauchte wohl die Worte einer Jungen, fast könnte sie mir Urenkelin sein, um meine eigene Missbrauchserfahrung hautnah an mich heranzulassen. Nachdem ich von ihrem psychisch und sexuell gewalttätigen On-off-„Partner“ und den Folgen dieser „Beziehung“ gelesen habe, auf der grünlackierten Holzbank, auf dem neuen karierten Tuch der alten Saunagängerin, konnte ich in einer Art Spontanheilung im Kreis dieser wunderschönen und wunderbaren Frauen die Erkenntnis in mich aufnehmen, ausschwitzen und in die Ostsee versenken.
Auf dem Rückweg über unseren Anti-Modell-Laufsteg habe ich mich vor der Mondsichel verbaugt. Zehn Tage zuvor hatte ich den Planeten um Verwandlung gebeten. Und so ist es geschehen .… Transzendenz, grenzenüberschreitend; Transformation auf vielen Ebenen; Anbindung an unsere europäischen schamanischen Ahninnen. Mille grazie a la luna! Gittu! Takk so mykke! Tusen takk!
Bin dann auf der Radler*innen- und Fußgänger*innen-Promenade Richtung Stadt marschiert und hab fürs letzte Stück zum Bahnhof (Centralen) den Bus genommen. Konnte wieder nicht bezahlen, weil ich die EC-Karte nicht einstecken konnte. Die Durchdigitalisierten erledigen willig die Arbeit der Dienstleister, die sie bezahlen (die an ihnen verdienen), schaffen ständig neue elektronische Geräte an, produzieren Schrottberge, Umweltzerstörung, Energieverbrauch etc., wischen drauf rum statt in Kontakt mit ihrer Umgebung zu gehen, werfen mit QR-Codes um sich und werden zur Nummer. Lässt sich wohlmancherorts nicht vermeiden, andernorts schon. Z.B. kann eine zu Fuß gehen und alles ausschalten außer ihrem wilden Geist.
Einen ganz anderen Ort habe ich gestern Abend auf dem schönen alten Hauptbahnhof von Malmö gefunden: die königliche Wartehalle. Habe dort königlich gespeist und gezeichnet. Noch eine Weile in der nagelneuen Bahnhofshalle zwischen SmartPhoneUsern gehockt und noch ein Stück weitergeschrieben, auch tolle Bilder gefunden.
Und dann hat mir der Schaffner ganz am hinteren Ende von Gleis 5 ein eigenes Abteil aufgeschlossen. So konnte ich meinen Schlafsack auf der Bank ausrollen, eine große Tafel Marabou Appelsin Krokant und noch ein Kapitel aus Isaksens junger Autobiografie verschlingen. Und bin dann nur in Padborg kurz aufgewacht, weil der Zug stand. 23:25
kombiniere Mittwoch, den 25. – 18:40 Altona –
Bei der Einfahrt nach Hamburg suchten Ina und Irina aus der Donets-Region, sie reisen mit Riesenrollkoffern, karierten Taschen auf Rollwägen und einer Katze, meine Hilfe. Wollten nach Uelzen. Das muss eine erstmal raushören (da ging es mir wohl wie den hilfreichen russischen Frauen, die zu verstehen versuchten, wohin ich wohl wollte). Habe sie mit Haoua aus Kurdistan verkuppelt, der wollte nach Harburg und half beim Schleppen. Nun also wieder hier. Und weitermachen.
Und jetzt füge ich alles zusammen (25/01). That´s my job. I´m a writer, not a fighter. (Anmerkung: fighting with my writing?). Kann mich vom Schreiben und Forschen kaum losreißen zur Zeit. Trotzdem habe ich die Fahrt durch Schweden genossen – in (nicht allzu) vollen Zügen:)